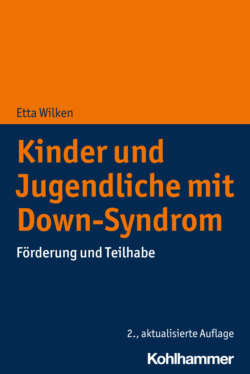Читать книгу Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom - Etta Wilken - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Geschwisterbeziehungen
ОглавлениеDie besondere Familiensituation von Geschwistern behinderter Kinder hat zunehmend Beachtung gefunden, und es gibt bereits vielfältige Literatur zu diesem Thema. Häufig wird jedoch die Auffassung vertreten, »dass Familien mit behinderten Kindern sich untereinander weitgehend ähneln. Dementsprechend wird in vielen Studien darauf verzichtet, Differenzierungen der betroffenen Familien zum Beispiel nach Art und Ausmaß der Behinderung, Schichtzugehörigkeit, Familiengröße, Geschlecht und Altersabstand der Geschwister vorzunehmen« (Kasten 2001, 177). Aber es ist wichtig zu reflektieren, wie unterschiedliche Ausprägungen und Ursachen von Behinderungen mit entsprechendem besonderen Hilfebedarf sich auswirken und wie spezielle Vorurteile oder Annahmen über einige Behinderungen nicht nur zu verschiedenen physischen und psychischen Belastungen der Eltern führen, sondern auch für die Geschwister unterschiedliche Konsequenzen haben. Auch individuelle Faktoren und Ressourcen spielen bei der Verarbeitung der Familiensituation eine Rolle. Achilles (2014, 36) berichtet von ihrer Erfahrung mit betroffenen Geschwistern, »wie unterschiedlich sich die Belastung durch die Behinderung auswirkt. Für manche Geschwister war die besondere Situation in der Familie eine Chance zu persönlichem Wachstum. Sie wurden lebenspraktischer, sozial kompetenter, selbstbewusster. Für andere war der Alltag mit der behinderten Schwester oder dem Bruder eine Bürde, an der sie vermutlich lange tragen«. Aber auch bei dieser Aussage ist unbedingt zu berücksichtigen, dass die Belastung zwar nicht nur von der Art und Schwere der jeweiligen Behinderung abhängig ist, dass aber manche gravierenden Beeinträchtigungen und vor allem ausgeprägte Verhaltensstörungen sich oft erheblich auswirken.
Deshalb ist es wichtig, differenziert zu ermitteln, was es bedeutet, einen Bruder oder eine Schwester mit Down-Syndrom zu haben und welche besonderen Erfahrungen die Geschwister mit ihrer Familiensituation erlebten. Allerdings gibt es bisher wenige behinderungsspezifische Studien, die die besonderen Bedingungen bei den verschiedenen Behinderungsursachen differenziert erfassen.
Bei Kindern mit Down-Syndrom führt das erkennbar abweichende Aussehen oft zu Neugierverhalten und Stigmatisierung. Auch wenn sich das alte stereotype Bild über die Behinderung deutlich verbessert hat, erleben viele Geschwister noch immer, dass unbekannte Menschen ihren Bruder oder ihre Schwester undistanziert anstarren. Manchmal werden ihnen dumme und verletzende Fragen gestellt oder sie hören negative Kommentare, mit denen sie sich auseinander setzen müssen.
»Wir wurden immer angegafft, manche Leute drehten sich um oder blieben stehen mit offenem Mund. Manche verglichen uns miteinander. Glotzten uns nacheinander ins Gesicht, so als überlegten sie, ob wir wohl beide geistig behindert seien oder nur eine von uns.« (Neumann, 2001, 88)
Die besondere Situation von Brüdern und Schwestern der Kinder mit Down-Syndrom sowie ihre Erfahrungen in ihrer Familie und in der Gesellschaft zu kennen ist wichtig, um eine angemessene Beratung sowohl den Kindern als auch den Eltern anbieten zu können.
Aus diesem Grund habe ich eine entsprechende Erhebung bei Geschwistern durchgeführt, die sich ausdrücklich nicht allgemein an Geschwister behinderter Kinder, sondern speziell an Geschwister von Kindern mit Down-Syndrom richtet (Wilken 2002a). Die Fragebögen wurden über die Zeitschrift ›Leben mit Down-Syndrom‹ verschickt. Insgesamt kamen 207 auszuwertende Fragebögen zurück, davon 116 von Schwestern und 91 von Brüdern. Das Alter der Geschwister lag zwischen 12 und 49 Jahren, ihre Brüder oder Schwestern mit Down-Syndrom waren zwischen sechs und 46 Jahre alt. Einige Geschwister haben ergänzend zum Fragebogen noch ihre Erfahrungen und ihre Meinung ausführlich dargestellt.
Die Antworten von Brüdern und Schwestern unterschieden sich kaum in der Bewertung der Geschwisterbeziehungen, allerdings wurden die Auswirkungen und das Erleben der besonderen Familiensituation deutlich unterschiedlich wahrgenommen.
Im Fragebogen wurde ausgeführt, dass Kinder mit Behinderung oft besondere Therapien und Hilfen benötigen und danach gefragt, ob die Geschwister sich dadurch benachteiligt fühlten. Diese Frage haben die Geschwister überwiegend verneint. Interessant waren besonders einzelne ergänzende Anmerkungen dazu.
Ein Bruder (36 Jahre) stellte fest: »Erst heute verstehe ich richtig, welche Leistung meine Eltern geschafft haben, unsere behinderte Schwester so gut zu fördern und uns nicht zu vernachlässigen!«
Und eine Schwester (20 Jahre) schrieb: »Ich habe zwei Brüder, einer hat `nen Fußballfimmel und der andere das Down-Syndrom. Ich fand Fußball meistens nerviger als Down-Syndrom!«
Nur wenige Geschwister fühlten sich manchmal benachteiligt. Sie verstehen durchaus, dass das behinderte Kind mehr Unterstützung benötigt. »Ungleichbehandlung ist also die Regel. Zur Gefahr wird sie, wenn sie ständig zu Lasten des nicht behinderten Geschwisters geht« (Achilles 2014, 37). Als häufigster Grund für erlebte Benachteiligung wurde genannt, dass die Mutter oder die Eltern insgesamt zu wenig Zeit haben.
Gefühl der Benachteiligung:
Viele Antworten betonten, dass das Geschwisterkind mit Down-Syndrom oft im Mittelpunkt steht und mehr Aufmerksamkeit erhält, Leistungen der Geschwister würden dagegen weniger oder gar nicht beachtet.
In der Häufigkeit von Streit mit Geschwistern wurde überwiegend kein Unterschied zu anderen Familien festgestellt.
Eine Schwester (drei Mädchen im Alter von 18, 17 und 15 Jahren, die älteste hat das Down-Syndrom) meinte jedoch: »man streitet anders. Wenn ich mich über meine jüngere Schwester ärgere, sage ich ganz locker ›dumme Kuh‹, bei meiner älteren Schwester habe ich dann gleich ein schlechtes Gewissen«.
Eine andere Schwester berichtete, dass es zwar nicht häufiger Streit gab, dass aber die Gründe andere waren. Sie war der Meinung, ihre Eltern wären der Schwester mit Down-Syndrom gegenüber zu tolerant gewesen und hätten ihr zu viel durchgehen lassen: »Auch von uns wurde viel Rücksicht gefordert, wenn sie z. B. Sachen kaputt gemacht hat, oder wenn Freunde da waren und sie immer mitspielen wollte (…) man wollte mal einfach in Ruhe gelassen werden.«
Ein Bruder stellte fest, dass es keine wirklichen Konkurrenzsituationen gab und deshalb wohl weniger Streit. »Natürlich konnte ich schneller laufen, besser rechnen als mein Bruder – obwohl er älter war …, deshalb spielten bei uns irgendwie andere Dinge eine Rolle …, aber die Eltern waren gerecht – meistens, wohl wie bei anderen auch.«
Geschwister verstehen durchaus, dass das behinderte Kind mehr Unterstützung benötigt und fühlen sich deshalb selten benachteiligt.
Oft betonten die Geschwister, dass die Sturheit ihres Bruders, ihrer Schwester mit Down-Syndrom »nervig« sein kann. Interessant war die Feststellung, dass nach Meinung vieler Geschwister die Eltern sich häufig von dem behinderten Kind »austricksen« lassen und ihm unnötige Hilfe geben.
Übereinstimmend antworteten alle Geschwister, dass sie bei Einladungen von Freunden keine negativen Reaktionen erlebt haben und dass sie auch keine abfälligen Bemerkungen über die behinderte Schwester oder den behinderten Bruder hörten. Ein Grund dafür ist sicher, dass bereits bei der Auswahl der Freunde deren Einstellung eine Rolle spielte: »Bestimmte Typen wollte ich gar nicht als Freund haben!«
Probleme bei Einladungen von Freunden:
Negative Bemerkungen von Freunden:
Auch sonst haben die Geschwister relativ wenig negative Reaktionen erlebt, aber fast alle haben einzelne Erfahrungen dieser Art gemacht – zumeist auf der Straße, beim Einkaufen oder ganz allgemein mit Fremden.
Negative Reaktionen im sozialen Umfeld:
Ein Bruder berichtet über unerfreuliche Reaktionen in seiner Schule, die auch von seiner Schwester mit Down-Syndrom in einer Integrationsklasse besucht wurde. Ein anderer Bruder hörte in der Schule öfter abfällige Bemerkungen über Behinderte – auch von Lehrern; die waren zwar nicht persönlich gemeint, aber er erlebte sie als beleidigend.
Vor allem die Art, wie manche Leute sie anstarren, wird von etlichen Geschwistern als unangenehm empfunden – selbst wenn einige schreiben, sie hätten sich daran gewöhnt und hätten sich eine »Elefantenhaut« zugelegt.
Interessant ist, dass etliche Schwestern in der Pubertät Schwierigkeiten hatten – aber nur ein Bruder. Ihre Probleme konnten diese Jugendlichen zwar nach einigen Jahren überwinden, aber es verdeutlicht, dass manche Geschwister besonders in diesem Alter einfühlsame Unterstützung benötigen, weil in der Pubertät gerade die Wertschätzung in der Peergruppe eine besondere Bedeutung hat und Abgrenzung von der Familie zur Entwicklung einer eigenen Identität wichtig ist.
Die Frage, ob das Aufwachsen mit einem behinderten Bruder oder einer Schwester besondere Probleme bereitet, wurde von fast allen Geschwistern bejaht. Dabei nannten sie vor allem die vermehrte Rücksichtnahme auf den behinderten Bruder bzw. die Schwester und die besondere Aufmerksamkeit, die dem behinderten Geschwister entgegen gebracht wird.
Ein Bruder hatte »diffuse Schuldgefühle, weil der Bruder weniger konnte«, aber auch wegen »unklarer Vorstellungen über die Genetik«.
Ein Bruder fand, dass »das Dauerthema Down-Syndrom manchmal nervig« war.
Eine Schwester schrieb: »Einige Probleme, die sich unter anderen Geschwistern ergeben können, treten bedingt durch seine Behinderung bei uns gar nicht auf, dafür aber möglicherweise andere Schwierigkeiten. Insgesamt sehe ich unser Verhältnis jedoch als unproblematisch an.«
Eine Schwester (16 Jahre älter als die Schwester mit Down-Syndrom) schrieb, sie hätte »schmerzlich« gelitten und »viel geweint«, als sie beim Vergleich mit anderen kleinen nicht behinderten Kindern verstanden hätte, wie behindert ihre Schwester ist.
Ein Bruder meinte: »Vieles in unserer Familie war durch die behinderte Schwester schon anders – aber das war nicht nur problematisch.«
Dem entspricht, dass 89 Prozent der Schwestern und 80 Prozent der Brüder in ihrer besonderen Familiensituation auch positive Aspekte sehen. Während einige die entsprechende Frage lediglich bejahten, haben etliche ergänzende Anmerkungen dazu gemacht. »Mein Bruder und ich haben uns eigentlich immer gut verstanden. Ich hab durch ihn gelernt, eher über manches nachzudenken.«
Ein Bruder, der zwei Schwestern mit Down-Syndrom hat, schrieb: »Ich würde meine Geschwister gegen nichts in der Welt eintauschen.« Auch andere Geschwister betonten positive Aspekte. »Ich habe früher gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Das sehe ich heute zwar nicht nur positiv, aber insgesamt schon.« »Man gewinnt andere Perspektiven.« Ein Bruder stellte fest, dass er durch seine Schwester mit Behinderung den »Blick für das Wesentliche im Leben« entwickelte.
Das Aufwachsen mit einem Geschwisterkind mit Down-Syndrom wird überwiegend als Chance gesehen – auch wenn es manchmal Probleme gibt.
Einige Geschwister haben sehr ausführliche ergänzende Briefe geschrieben, die beeindruckende Erfahrungen und Einstellungen vermitteln.
»Mein Bruder benötigte viel Aufmerksamkeit, aber ich wurde dadurch nicht benachteiligt … Außerdem wurden mir andere Aufmerksamkeiten zuteil, an denen er nicht beteiligt war. Dass das so gewesen ist, liegt jedoch an meinen Eltern und an der Art und Weise, wie sie mit meinem Bruder und mir umgegangen sind. Insgesamt denke ich, sind wir mit allem normal umgegangen. Seine Behinderung und die notwendigen Therapien waren, so habe ich es zumindest empfunden, weder ständiges Thema bei uns, noch war mir seine Behinderung immer bewusst. Er ist eben so wie er ist.«
Einige kritische Anmerkungen betrafen die Unterschiede zwischen der Alltagserfahrung innerhalb der Familie und der Einstellung außenstehender Menschen zur Behinderung. »Weder meine Eltern noch ich fühlten uns dazu berufen, das Down-Syndrom meines Bruders übermäßig zu problematisieren, geschweige denn, seine Behinderung zum Anlass zu nehmen, uns selbst zu verwirklichen.«
»Mir erschien und erscheint es auch heute vielfach so, dass Mitmenschen von mir erwarten, bedingt durch die Behinderung meines Geschwisters, Probleme zu haben. So wurde ich häufig von anderen gefragt, ob ich mich benachteiligt fühle. Verneinte ich diese Frage, wurde mir gesagt, ich könne es doch ruhig zugeben, nur hatte ich nichts zuzugeben. Diese Erwartungshaltung anderer kann mitunter störender sein als die Behinderung eines Geschwisters – die für einen selbst zum Alltag gehört.«
Auch wenn viele Geschwister eines Kindes mit Down-Syndrom feststellten, dass es in der Familie spezielle Probleme geben kann, ist doch offensichtlich, dass die meisten ihre besondere Familiensituation gut verarbeitet haben.
Oft wird vermutet, dass Geschwister behinderter Kinder häufiger einen sozialen Beruf wählen. Entsprechend sahen die befragten Brüder und Schwestern die Auswirkung ihrer Familiensituation auf ihren Berufswunsch bzw. ihre Berufswahl unterschiedlich.
Während nur ein Bruder schrieb, dass seine Familiensituation seine Berufswahl beeinflusst hat, bestätigten 34 Prozent der Schwestern eine solche Auswirkung. Vergleicht man jedoch die tatsächlich gewählten Berufe von Brüdern und Schwestern mit der allgemein typischen Berufswahl von Männern und Frauen, so zeigen sich keine entsprechenden deutlichen Unterschiede in der sozialen Ausrichtung. Es handelt sich somit eher um eine subjektiv andere Wahrnehmung der beeinflussenden Wirkung.
Vielen Geschwistern war es wichtig, ihre Erfahrungen noch differenzierter zu kommentieren. Dabei beschrieben sie sowohl positive als auch negative Aspekte. Bedeutsam erscheinen mir der häufig betonte Zeitfaktor und die erlebte elterliche Aufmerksamkeit bezogen auf eigene Bedürfnisse. Wenn so viele Geschwister das Gefühl haben, ihre Mutter bzw. ihre Eltern hätten zu wenig Zeit für sie gehabt, dann sollten die Familien versuchen, dieses Problem zu besprechen und machbare Lösungen zu finden. Auch Achilles (2014, 45) hält den Zeitfaktor für wesentlich: »Kinder sollten möglichst nie zu hören bekommen: ›Ich habe jetzt keine Zeit‹ – die Geschwister behinderter oder chronisch kranker Kinder erst recht nicht. Sie stecken so oft zurück, da ist die Ansprechbarkeit der Eltern für sie von allergrößter Wichtigkeit.«
Solche Forderungen sind jedoch zu relativieren, damit nicht unangemessene Ansprüche entstehen und noch mehr Druck auf die Eltern erfolgt. Auch in anderen Familien ist Zeit nicht beliebig verfügbar und oft müssen für unvorhersehbare Probleme mühsam kreative Lösungen gefunden werden.
Einige Geschwister berichteten von interessanten Ideen, die ihre Familien entwickelt haben. So schrieb eine Schwester, dass sie mit ihrer Mutter einmal in der Woche ihren gemeinsamen Frauentag gestalteten, an dem sie beispielsweise ins Kino gingen oder zum Schwimmen und in die Sauna. Manchmal verlebten sie miteinander auch nur einen ungestörten (!) Klönabend zu Hause. Alle Freundinnen hätten sie um diesen besonderen Abend beneidet. Oft spielt eben nicht nur die tatsächlich miteinander verbrachte Zeit eine Rolle, sondern wichtig ist die Qualität der gemeinsam gestalteten Zeit.
Ähnliches gilt für die Aufmerksamkeit gegenüber den Kindern. Es lohnt schon, über die Reihenfolge nachzudenken, in der sie Zuwendung oder Aufmerksamkeit erhalten. So ist es zum Beispiel nicht nötig, dass jeder Besuch sich zuerst dem behinderten Kind widmet oder sich nach ihm erkundigt (»selbst meine Patentante«). Oder dass die Großeltern, wenn sie kommen, sich zuerst dem behinderten Kind zuwenden und danach erst den übrigen Geschwistern.
Auch das Verhalten und die einzelnen Leistungen der Geschwisterkinder sollten angemessen beachtet und gelobt werden. So erfreulich Entwicklungsschritte eines behinderten Kindes sind, die Geschwisterkinder brauchen in gleicher Weise die Erfahrung, dass ihre Leistungen entsprechend gewürdigt werden.
Von erwachsenen Geschwistern wurden öfter Fragen gestellt, die sich auf altersbedingte Veränderungen in der Familiensituation bezogen und auf mögliche neue Verantwortung und Pflichten, die sich daraus für sie ergeben. So können alt gewordene Eltern manchmal nicht mehr alles für das behinderte Geschwister regeln. Es gibt Schwierigkeiten bei der Alltagsgestaltung zu Hause. Krankheit oder Tod eines Elternteils erfordern oft neue Regeln des Miteinanderlebens. Es sind Entscheidungen über den künftigen Lebensort zu treffen. Manchmal kommen gesundheitliche Probleme des behinderten Geschwisters hinzu und erfordern spezielle Lösungen. Einige Geschwister wünschen sich einen Themen bezogenen Austausch – vor allem wenn sie keine weiteren nicht behinderten Geschwister haben und sich allein für ihre Familiensituation verantwortlich fühlen. Es kann deshalb sinnvoll sein, dass Geschwister sich in bestehenden Internetforen austauschen (www.erwachsene-geschwister.de) oder speziell angebotene Veranstaltungen für erwachsene Geschwister zum Austausch von Erfahrungen und aktuellen Fragen nutzen.
Die Antworten in den Fragebögen weisen ganz deutlich darauf hin, welche Schritte und Einstellungen für die Familien hilfreich sind: Je besser es den Eltern gelingt, ihre besondere Familiensituation zu bewältigen, um so mehr können sie auch den Geschwistern vermitteln, ihre Familie als »normal« zu erleben und mit auftretenden Schwierigkeiten umzugehen. Dazu gehört auch, den Geschwistern in altersangemessener Form Informationen über das Down-Syndrom und die damit verbundenen Beeinträchtigungen zu vermitteln.
Hilfreich können für jüngere Geschwister die verschiedenen angebotenen Bilderbücher sein. Geeignet sind z. B. Planet Willi (Müller, 2012) oder Einfach Sontje (Irl, Sattler, Hilgner 2014). Für größere Kinder können Broschüren, die von den verschiedenen Selbsthilfegruppen herausgegeben wurden, Basisinformationen bieten. Auch das Heft »Down-Syndrom und ich«, das eigentlich vor allem für Jugendliche und Erwachsene mit Down-Syndrom geschrieben wurde, kann – gerade mit der beiliegenden DVD – auch Geschwistern gute Informationen vermitteln (Halder 2011).
Ohne mögliche Probleme zu verdrängen, ist die besondere Situation mit dem behinderten Bruder oder der Schwester für die meisten Geschwister keine zu große Belastung, wenn es den Eltern gelingt, die verschiedenen Bedürfnisse und Ansprüche in der Familie hinreichend ausgewogen zu berücksichtigen. Die Geschwister akzeptieren fast immer nötige Mehrbelastungen und die Übernahme zusätzlicher Verantwortung. Allerdings sollte man ihnen nicht zu große Verpflichtungen oder zu häufige Rücksichtnahme zumuten und ihnen ein Anrecht auf »eigenes Leben« zugestehen. Wenn Geschwister dagegen erleben, geliebt und gleichberechtigt zu sein, ist eine Haltung möglich, wie sie ein 15-jähriges Mädchen bezüglich ihres älteren Bruders mit Down-Syndrom zum Ausdruck bringt: »Ich sehe das Leben mit meinem Bruder als Herausforderung und Bereicherung an« (Wilken 2001a).