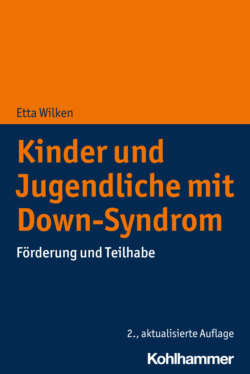Читать книгу Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom - Etta Wilken - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.4 Selbsthilfe
ОглавлениеEltern von Kindern mit Down-Syndrom haben viele regionale und überregionale Selbsthilfegruppen gebildet, um Erfahrungen auszutauschen, Informationen zu vermitteln, Unterstützung und konkrete Hilfen anzubieten. Mittlerweile gibt es allein in Deutschland rund 250 solcher Selbsthilfegruppen (vgl. Verzeichnis medandmore 2016). Einige haben Broschüren zur Information neu betroffener Eltern erstellt, um ihnen die schwierige erste Zeit der Auseinandersetzung zu erleichtern und selbst erlebte problematische Erfahrungen zu erleichtern. Eltern, die aufgrund eigener Betroffenheit bereit sind, anderen Eltern beim Beginn des Zusammenlebens mit ihrem behinderten Kind zu begleiten, können wesentliche Hilfen zur Verarbeitung der besonderen Situation vermitteln und positive, aber realistische Perspektiven aufzeigen.
Das machen entsprechende Texte sehr deutlich: »Wir wissen, ein behindertes Kind anzunehmen ist schmerzhaft, doch lassen Sie sich versichern, die meisten Eltern schaffen es! Wir möchten Ihnen (…) über die Unsicherheit der ersten Zeit hinweghelfen und Ihnen eine Orientierung geben (…). Außerdem wollen wir Ihnen Mut machen, sich auf Ihr besonderes Kind einzulassen (…). Sie werden durch dieses Kind sehr bereichert, mehr als Sie sich jetzt vorstellen können.« (Bundesvereinigung Lebenshilfe 1998, 2)
»Aber dann drängte sich dieses Häuflein Kind, das uns zuerst so unglücklich gemacht hatte, immer mehr in unser Leben hinein und wurde zu einem quirligen Mittelpunkt, ohne den wir um keinen Preis mehr sein wollen!« (Halder 1999, 4)
Gerade die Aufklärungsarbeit und das Engagement betroffener Eltern können helfen, nicht nur die schwierige erste Zeit mit dem Kind weniger belastend zu erleben, sondern auch bei sehr speziellen Schwierigkeiten zu unterstützen und angemessen zu beraten. Auch das angebotene vielfältige Bild-, Text- und Filmmaterial für die Eltern ermöglicht, dass erforderliche Informationen und Beratung heute insgesamt differenzierter und einfühlsamer erfolgen als früher. Es gibt zahlreiche Publikationen von verschiedenen regionalen Selbsthilfegruppen, spezielle Zeitschriften mit differenzierten Berichten von Fachleuten und von Eltern (Leben mit Down-Syndrom, Kids Aktuell, Leben Lachen Lernen-Österreich) und weitere informative Broschüren, Lern- und Fördermaterial, Bücher und Filme.
Die Erfahrung, dass das eigene Kind anders als erwartet ist und sich deutlich abweichend entwickelt, wird immer schwer zu verarbeiten sein. Die Bewältigungsprozesse, welche die Eltern zu leisten haben, werden jedoch ganz wesentlich beeinflusst von den Informationen und Hilfen, die sie erhalten und von den Möglichkeiten, gute Bedingungen für ihr Kind zu finden und passende Lösungen für ihre Familie. Zudem spielt eine wesentliche Rolle, welche Einstellung zur Behinderung ihres Kindes sie im Lebensalltag, beim Arzt oder in der Öffentlichkeit erleben. Langfristig beeinflusst werden dadurch auch die familiären Möglichkeiten, neue Lebensperspektiven mit dem Kind aufzubauen und andere, nicht überwiegend leistungsorientierte Wertvorstellungen zu entwickeln sowie das eigene Familienleben selbstbestimmt zu organisieren und weniger abhängig von Durchschnittserwartungen und Normen zu sein.
Vor allem können Begegnungen mit anderen Eltern und ihren Kindern mit Down-Syndrom, der Erfahrungsaustausch mit ihnen und intensive Gespräche über aktuelle Probleme und Schwierigkeiten im Familienalltag oder auch der Austausch in Internetforen sehr hilfreich sein. Manchen Eltern gelingt es dadurch, ihre oft sprachlose Betroffenheit zu überwinden, über ihre Situation und über ihre Schwierigkeiten zu sprechen und ihre bisherige Lebensplanung den veränderten Bedingungen anzupassen.
Die kooperative Elternarbeit, wie sie in speziellen Familienseminaren erfolgt (Wilken 2014, 214 ff) oder von den verschiedenen regionalen Elternselbsthilfegruppen angeboten wird, vermittelt nicht nur differenzierte Informationen über die Behinderung des Kindes und über Ziele und Möglichkeiten der Förderung, sondern bietet den Eltern vor allem einen wichtigen allgemeinen Erfahrungsaustausch. Auch die gemeinsame Reflektion verschiedener medizinischer und therapeutischer Angebote und die Diskussion eigener Ziele bezogen auf das Kind und die Familie vermag ihnen wesentliche Orientierungshilfen zu geben.
Teilnehmer eines solchen Seminars für Eltern von kleinen Kindern mit Down-Syndrom stellten bei der abschließenden Diskussion fest: »Es war mein erster Kontakt mit Eltern, die dasselbe Problem wie ich haben. Das hat mir sehr geholfen, über alles zu reden.« »Für mich war die Erfahrung wichtig: Ich bin nicht allein! Der Austausch mit den anderen Eltern gibt Mut und neue Motivation.« »Es erleichtert und ist gut zu erfahren, dass auch andere Eltern denken, dass man nicht alles tun muss, was man machen kann.«
Die allgemeinen erheblichen Veränderungen der Lebens- und Familienformen haben deutliche Auswirkungen auf den Lebensalltag aller Familien sowie auf die Möglichkeiten der verwandtschaftlichen Unterstützung und spontanen Hilfe bei Bedarf. Immer mehr Familien sind angewiesen auf externe Betreuung ihrer Kinder schon im Babyalter und auf entsprechende Angebote im Kindergarten- und Schulalter. Das gilt zunehmend auch für Kinder mit Down-Syndrom. Im Unterschied zu früher wollen heute immer mehr Eltern sich die Familienaufgaben möglichst teilen, und die Verantwortung für die gelingende Entwicklung gerade des behinderten Kindes wird nicht vorwiegend der Mutter zugewiesen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht mehr allein das Wohlergehen des behinderten Kindes, sondern es geht den Eltern auch um »eine Wiedereroberung von Normalität« (Sarimski 2016, 17).
»Seit drei Monaten arbeite ich wieder. Das haben viele Bekannte nicht verstanden und sehr negativ kommentiert. Aber mein Kind geht gern in die Krippe und fühlt sich wohl zwischen den anderen Kindern. Und ich habe wieder täglichen Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen. Das tut mir gut. Das bedeutet jetzt für mich Integration!« (Mitteilung einer Mutter)
In einem »Rechtsratgeber für Mütter mit besonderen Herausforderungen« (Kruse 2015) wird betont, dass zu einem gelingenden Familienleben beiträgt, wenn »die Mutter und der Vater ein erfülltes Leben führen können. Dazu gehört auch die Verwirklichung eigener Lebensvorstellungen, eine eigene Berufstätigkeit«. Allerdings werden die besonderen Probleme von Familien mit einem behinderten Kind gesehen, die »die ohnehin vorhandenen Schwierigkeiten noch verschärfen« (ebd. 3). Die Informationsschrift bietet deshalb einen differenzierten Überblick über rechtliche und finanzielle Hilfen.
Es ist wichtig zu betonen, wie viel Kinder im normalen Familienalltag, im Zusammenleben mit Geschwistern, in der Kindertagesstätte, aber auch bei zufälligen Kontakten auf dem Spielplatz oder in der Nachbarschaft lernen. Nicht alles ist nur durch spezielle Förderung zu erreichen, sondern kann durchaus auch bei gemeinsamen Tätigkeiten und in kindgemäßen Spielen gelernt werden. Gerade die Teilhabe am normalen Familienleben, gemeinsames Spielen mit anderen Kindern in der Krippe oder bei der Tagesmutter, im Kindergarten oder in der Schule bieten vielfältige Lernmöglichkeiten – auch wenn die besonderen Unterstützungsbedürfnisse nicht ausgeblendet werden sollten.
Die gemeinsame Diskussion solcher Fragen ermöglicht den Eltern, eigene Entscheidungen für das Kind und für sich selbst zu treffen und entlastet sie von dem oft empfundenen Druck, das Kind ständig fördern zu müssen und trotzdem nicht genug zu machen.