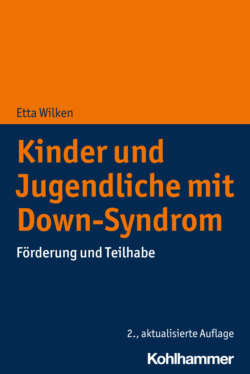Читать книгу Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom - Etta Wilken - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3 Häufigkeit
ОглавлениеDas Down-Syndrom gehört zu einem der häufigsten angeborenen Syndrome. Überall auf der Welt, auf allen Kontinenten und in allen Ländern leben Menschen mit Down-Syndrom, allein in Europa sind es etwa 600.000 und insgesamt wahrscheinlich etwa vier Millionen. Weltweit werden jährlich über 200 000 Kinder mit Down-Syndrom geboren, allein in Deutschland ist jährlich mit etwa 1000 Geburten zu rechnen bei der aktuell ermittelten jährlichen Geburtenzahl von durchschnittlich 670 000 Kindern (vgl. LmDS 2009, 6). Allerdings ist damit zu rechnen, dass aufgrund vermehrter Anwendung von pränataldiagnostischen Verfahren, insbesondere dem nicht invasiven Bluttest (Pränatest), sich langfristig deutliche Veränderungen ergeben werden.
Wahrscheinlich hat es Menschen mit Down-Syndrom schon immer gegeben. Wie hoch ihr Anteil in unserer Gesellschaft in Zukunft sein wird, ist abhängig von den möglichen Auswirkungen verschiedener Entwicklungen in der Diagnostik, der gesundheitlichen Betreuung und der sozialen Akzeptanz.
Immer mehr Frauen nehmen neue und differenziertere Verfahren der vorgeburtlichen (pränatalen) Diagnostik in Anspruch und bei einem pathologischen Befund entscheiden sich viele für einen Schwangerschaftsabbruch. Daher könnte die Häufigkeit der Geburten von Kindern mit Down-Syndrom langfristig erheblich abnehmen. Eine umfangreiche Datenauswertung prä- und postnatal erfasster Fälle von Trisomie 21 in der Deutsch-Schweiz ergab allerdings, dass »die Häufigkeit der mit Trisomie 21 geborenen Kinder seit 1985 konstant ist, obwohl in der Periode 1992 bis 1996 rund ein Drittel aller Fälle infolge Schwangerschaftsabbruch nach pränataler Diagnose nicht zur Welt kamen« (Binkert, Mutter, Schinzel 1999, 19). Dass trotzdem nicht weniger Kinder mit Down-Syndrom geboren wurden, wird begründet mit einer »Rechts-Verschiebung der Altersverteilung der Mütter bei der Geburt« (ebd.). Diese Tendenz hat sich weiter fortgesetzt, so dass im Jahr 2012 in Deutschland Frauen ihr erstes Kind mit durchschnittlich 29,2 Jahren bekamen und 2.011 Mütter 45 Jahre oder noch älter waren (Stat. Bundesamt 2014). Mit diesem heute insgesamt erhöhten Lebensalter von Müttern nimmt die relative Wahrscheinlichkeit für die Geburt eines Kindes mit Down-Syndrom deutlich zu. Auch bewirkt eine insgesamt positivere Einstellung zu Menschen mit Down-Syndrom, dass mehr Mütter bzw. Eltern nach pränatal festgestelltem Down-Syndrom eine Beratung in Anspruch nehmen und sich dann bewusst für ihr Kind entscheiden (vgl. Hennemann 2014, 77).
Bei einer Schweizer Untersuchung wurden von insgesamt 1.118 Fällen von Down-Syndrom 396 pränatal und 722 postnatal erkannt. Der Anteil der pränatalen Erfassung stieg dabei mit zunehmendem Alter der Mutter (Binkert, Mutter, Schinzel 1999), weil in dieser Gruppe vermutlich eine erhöhte Bereitschaft zur Inanspruchnahme entsprechender Angebote besteht. Durch Ultraschall- und Serum-Screening-Methoden sowie Bluttests werden mittlerweile auch bei den 25 bis 29-Jährigen schon ein Viertel und bei den 30- bis 34-Jährigen ein Drittel der Fälle pränatal diagnostiziert (ebd.). Diese Entwicklung wird sich durch den angebotenen und zunehmend in Anspruch genommenen Bluttest (Praenatest) weiter erheblich verstärken. Im Gegensatz zu den bisherigen invasiven Tests (Fruchtwasseruntersuchungen, Chorionbiopsie) ist damit kein spezielles Risiko mehr für das Kind verbunden. Bedenkt man, dass bisher trotz der bekannten möglichen Risiken der invasiven Tests nach den vorliegenden Daten in Deutschland jährlich 30 000 – 60 000 dieser pränatalen Untersuchungen durchgeführt wurden, wird deutlich, welche Veränderungen sich durch den »Praenatest« (LifeCodexx-Bluttest) vermutlich ergeben werden. Mit der Aufnahme in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen wird er für alle Schwangeren bezahlt, bei denen »ein erhöhtes Risiko für ein Kind mit Down-Syndrom besteht, etwa weil sie älter als 35 Jahre sind, wegen eines auffälligen Ultraschallbefunds oder verdächtiger Laborwerte« (Bahnsen 2015, 33). Es ist davon auszugehen, dass ein solcher »risikoloser Test« auch die Inanspruchnahme durch Schwangere ohne ein spezielles Risiko deutlich erhöhen wird und dass die Abbruchquote vermutlich entsprechend steigen wird (Berndt 2008). Die damit verbundenen ethischen Fragen verlangen deshalb unbedingt nach Klärung und eindeutiger Positionierung in Bezug auf Lebenswert und Würde von Menschen mit dieser Behinderung.
Von 1976 bis zum Jahr 2005 stiegen – so wurde in einer Untersuchung festgestellt – die mit pränataler Diagnostik erfassten Fälle von 1796 auf 130.000 an. Das könnte eine Abnahme der Geburten von Kindern mit Down-Syndrom erwarten lassen, aber tatsächlich ist die Zahl der mit Trisomie geborenen Kinder unverändert geblieben (vgl. v.Voss u. a. 2007, 92). Nach pränataler Diagnose des Down-Syndroms und Beratung trugen nach den bisher vorliegenden Erhebungen 5,5 Prozent der Frauen die Schwangerschaft aus. In einer internationalen Studie zu mütterlichem Alter, pränataler Diagnostik und Schwangerschaftsabbrüchen in europäischen und fünf außereuropäischen Ländern wurde festgestellt, dass sich »das durchschnittliche Auftreten von DS (lebend und tot geboren plus Schwangerschaftsabbrüche) auf 10.000 Geburten … von 13,17 im Jahre 1993 bis auf 18,2 im Jahr 2004« erhöhte (Gocchi et al. 2011, 34). Außerdem endeten 1993 nach dieser Studie »fast zwei Drittel aller Down-Syndrom-Schwangerschaften mit der Geburt des Kindes, während aber 2004 … zwei Drittel dieser Schwangerschaften mit einem Abbruch endeten« (ebd.).
Eine andere Entwicklung, die Auswirkungen auf den Anteil der Menschen haben wird, die mit Down-Syndrom leben, betrifft ihre zunehmend günstigere Lebenserwartung. Durch eine verbesserte entwicklungsbegleitende Vorsorge und medizinische Betreuung und Behandlung können lebensbedrohende Krankheiten und Beeinträchtigungen erfolgreicher als früher therapiert und geheilt werden. Das betrifft besonders die typischen Atemswegserkrankungen und Herzfehler, aber auch andere bei Menschen mit Down-Syndrom häufiger auftretende Erkrankungen wie Leukämie oder Zöliakie. Daher werden sie bei besserer Lebensqualität heute zunehmend älter und erreichen durchaus ein Alter von 60 oder sogar 70 Jahren. Die älteste Frau mit Down-Syndrom, die beschrieben wurde, erreichte ohne deutliches Nachlassen ihrer geistigen Fähigkeiten (die zwar behinderungstypisch eingeschränkt waren) 84 Jahre (McGuire, Chicoine 2008, 354).
Welche demographischen Auswirkungen sich aus diesen verschiedenen Entwicklungen für die Gesamtpopulation der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit Down-Syndrom langfristig ergeben werden, ist zwar noch nicht sicher, aber verschiedene vorliegende Erhebungen machen mögliche langfristige Tendenzen sichtbar.
Als J. Langdon Down 1866 seine Erstbeschreibung derjenigen Menschen mit einer geistigen Retardierung vornahm, welche wir heute als Menschen mit Down-Syndrom bezeichnen, stellte er fest, dass ihr Anteil an dieser Gruppe mehr als 10 Prozent betrug (Down 1866, 261). Untersuchungen vom Ende der sechziger Jahre bis Ende der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts, die sich auf Kinder im Schulalter bezogen, kamen relativ übereinstimmend auf etwa den doppelten prozentualen Anteil:
1969 ermittelte Eggert im Rahmen einer Erhebung an Sonderschulen, dass 25,1 Prozent der Schüler das Down-Syndrom hatten (Eggert 1969).
1970 ging Speck von einem Anteil von etwa 20 Prozent aus (Speck 1975).
1972 stellte Dittmann als Ergebnis einer umfangreichen Erhebung an Sonderschulen für geistig Behinderte in allen (alten) Bundesländern einen durchschnittlichen Anteil von 21 Prozent fest (Dittmann 1975, 146).
1974 ermittelte Wilken an neun verschiedenen Sonderschulen in Niedersachsen einen Anteil von 21 Prozent (Wilken 1977, 54).
1989 stellte Dittmann bei einer Erhebung an Sonderschulen für geistig Behinderte in Baden-Württemberg fest, dass 20 Prozent der Kinder das Down-Syndrom aufwiesen (Dittmann 1992, 12).
2000 konnte Wilken in einer Untersuchung an Sonderschulen und Tagesbildungsstätten in Niedersachsen nur noch einen Anteil von 11,2 Prozent ermitteln (Wilken 2000 b).
2013 fanden Ratz u. a. in einer repräsentativen Gruppe von Schülern mit geistiger Behinderung in Bayern (1629 Kinder) einen Anteil von 12 %, die das Down-Syndrom hatten (Ratz 2013, 4506).
Diese Zahlen zeigen, dass sich im Vergleich zu den früheren Erhebungen der Anteil der Kinder mit Down-Syndrom am Gesamtanteil der geistig behinderten Schüler offensichtlich fast halbiert hat – selbst wenn berücksichtigt wird, dass bei den Erhebungen aus den Jahren 2000 und 2013 die integriert beschulten Kinder mit Down-Syndrom nicht erfasst wurden. Auch aktuelle Berichte aus Frühförderstellen und Schulen bestätigen diese deutliche Abnahme, selbst wenn es immer wieder einmal zu einer zeitweise regionalen Häufung von Geburten kommt, so dass nach Jahren, in denen kein Kind mit Down-Syndrom gemeldet wurde, plötzlich für mehrere Kinder Frühförderung beantragt wird.
Auffällig ist das unausgeglichene Verhältnis von Jungen und Mädchen beim Down-Syndrom. Schon in verschiedenen älteren Publikationen wurde darauf hingewiesen, dass es mehr männliche als weibliche Menschen mit Down-Syndrom gibt. Dittmann ermittelte in seiner Stichprobe 47 Prozent Mädchen und 53 Prozent Jungen (1975, 148). Bei der Untersuchung von Wilken (1974) betrug das Verhältnis 57,1 Prozent Jungen zu 42,9 Prozent Mädchen und 2000 wurde eine Relation von 54 Prozent Jungen zu 46 Prozent Mädchen festgestellt. In der Erhebung von Ratz waren von den 188 Schülern mit Down-Syndrom nur 39,8 % Mädchen, aber 60,2 % Jungen.
Innerhalb der Gruppe von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen haben etwa 10 % das Down-Syndrom – mit deutlich abnehmender Tendenz.
Der Anteil der männlichen Personen ist deutlich erhöht.
Während in der Gesamtgruppe aller Schüler mit intellektueller Beeinträchtigung die noch deutlicheren prozentualen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen durch zumeist bekannte geschlechtstypisch recht unterschiedliche genetische und schädigungsspezifische Faktoren verursacht werden, lässt sich die zufällig erfolgende chromosomale Fehlverteilung beim Down-Syndrom für diese prozentualen Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Personen nicht schlüssig erklären.