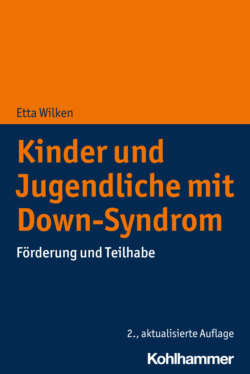Читать книгу Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom - Etta Wilken - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.3 »Normalisierungsversprechen« und Therapietourismus
ОглавлениеErfolgsberichte über sehr positive Entwicklungen von einzelnen Personen mit Down-Syndrom, ob im Fernsehen gezeigt, in Zeitungen und Zeitschriften beschrieben oder in Elterngruppen mitgeteilt, erwecken oft Hoffnungen, dass auch für das eigene Kind durch gleiche Maßnahmen ähnliche Erfolge zu erzielen seien. Selbst Hochschulreife scheint dann durchaus »machbar«.
Es ist dagegen festzustellen, dass selbst wenn eine spezielle therapeutische Maßnahme bei einem bestimmten Kind hilfreich war, ein solches Ergebnis meistens nicht undifferenziert auf andere Kinder übertragen werden kann, und eine Generalisierung von Einzelerfahrungen oft problematisch ist. Gerade die große individuelle Streubreite bei Kindern mit Down-Syndrom lässt solche Verallgemeinerungen ohne klare theoretische Begründung im jeweiligen Fall selbst bei vermeintlich sichtbarem Erfolg kaum zu. Bei den Eltern entsteht aber durch solch unmittelbares Vergleichen ihrer Kinder, z. B. in Selbsthilfegruppen, die verständliche Hoffnung, mit gleichen Therapien eine ähnlich günstige Entwicklung auch bei ihrem eigenen Kind zu erreichen. »Der Run auf die neueste Methode ist ungebrochen« (Speck 1995, 116), und eine Orientierung »in dem industriellen Dschungel wachstumssicherer Therapiebranchen« (Beck 1990, 62) ist oft ausgesprochen schwierig.
Jedes Jahr werden neue Therapien aktuell, verlieren dann aber oft schon nach kurzer Zeit oder nach mehrjährigen Erfahrungen an Bedeutung oder spielen gar keine Rolle mehr. Manchmal können sie aber nach Jahrzehnten plötzlich wieder aktuell werden. So wird in manchen Elterngruppen oder Internetforen wieder die Therapie nach Doman diskutiert – und selbst die bei diesen therapeutischen Maßnahmen besonderen Übungen von täglich vielen Stunden werden von einigen Eltern akzeptiert und eher wenig problematisiert. Auch die Frage, was eigentlich aus den Kindern geworden ist, die schon vor zwanzig Jahren mit dieser Maßnahme therapiert wurden, wird eher selten gestellt.
Die operative Verkürzung der Zunge wurde dagegen von Anfang an überwiegend kritisch gesehen, da Menschen mit Down Syndrom keine wirklich zu große Zunge haben. Eine spezielle operative Reduktion kann zwar den Mundschluss verbessern und den Speichelfluss vermindern, aber erhebliche Funktionsbeeinträchtigungen z. B. beim Ablecken der Lippen sind durchaus möglich. Die vor allem aber angestrebten positiven Auswirkungen auf das Sprechen ließen sich jedoch bei entsprechenden Kontrolluntersuchungen nicht nachweisen (Bundesvereinigung Lebenshilfe 1983).
Eine differenzierte und kritische Diskussion erfolgte auch bezüglich der operativen Beseitigung einiger syndromtypischen Merkmale durch die Plastische Chirurgie bei Menschen mit Down-Syndrom. Die damit versprochenen positiven Auswirkungen auf das Selbst- und Fremdbild bestätigten sich nicht. Weder konnte, wie behauptet, die soziale Integration verbessert noch negative Reaktionen der Umwelt vermindert werden. Auch die angenommenen positiven Auswirkungen auf die Entwicklung des betreffenden Kindes durch ein günstigeres Selbstbild ließen sich objektiv nicht nachweisen (ebd.). Diese Maßnahmen werden heute fast gar nicht mehr diskutiert oder gar durchgeführt.
Auch die oft beschriebenen besonderen Erfolge mit der Gaumenplatte nach Castillo-Morales, die zeitweise fast allen Kindern mit Down-Syndrom verordnet wurde, waren nicht sehr überzeugend. Während in den neunziger Jahren noch sehr viele Kinder eine Gaumenplatte erhielten, geht man heute davon aus, dass von den »orofazial behandlungsbedürftigen Kindern mit Trisomie 21 nur etwa 5 % zusätzlich eine Gaumenplatte« benötigen (Limbrock 2011, 16).
In den verschiedenen Elternseminaren wurden immer wieder Listen erstellt über die durchgeführten aktuellen Fördermaßnahmen und Therapien. Diese jährlichen »Hitlisten« zeigen erstaunliche Veränderungen und machen deutlich, wie schwierig es oft für die Eltern ist, sich bei der gegebenen Angebotsvielfalt zu orientieren und für das eigene Kind die richtige Entscheidung zu treffen und selbstbewusst manche Therapieangebote abzulehnen.
Der gemeinsame Erfahrungsaustausch in Selbsthilfegruppen und das fachlich begleitete Abwägen ermöglichen den Eltern jedoch, problematische Methoden zu hinterfragen und eine kritische Distanz zu »Therapietourismus« und überzogenen »Normalisierungsversprechen« zu gewinnen. Eine kritische Bewertung der theoretischen Grundlagen von Therapiekonzepten, der angewendeten Methoden und der versprochenen Ziele hilft, die tatsächliche Wirksamkeit solcher Maßnahmen nüchterner zu sehen. So können die mitgeteilten Erfahrungen mit manchen Therapien und die zwar oft behaupteten, aber selten erkennbaren Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder sowie der fehlende Langzeiteffekt die häufig überzogenen Erfolgsberichte über einzelne Kinder oder Erwachsene relativieren.