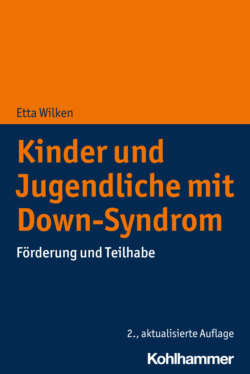Читать книгу Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom - Etta Wilken - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1 Familiäre und gesellschaftliche Aufgaben der Erziehung von Kindern
Die veränderten Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft haben dazu geführt, dass auch die familialen Lebensformen und die Lebenswirklichkeit von Familien von diesem Wandel betroffen sind. Zwar wachsen die meisten Kinder noch in traditionellen Familienstrukturen mit Mutter und Vater auf (70 %), aber es gibt zunehmend auch andere Formen des Zusammenlebens mit Kindern, wie Eineltern- (20 %), Scheidungs- und »Patchwork«-Familien (Stat. Bundesamt 2014) oder Zwei-Mütter-Väter-Familien. Hinzu kommen Familien aus anderen Kulturen und mit anderer Muttersprache sowie Eltern, die verschiedenen Ethnien angehören. Diese unterschiedlichen Bedingungen wirken sich auch auf die Vorstellungen und Aufgabenzuweisungen von Mutter und Vater in einer Familie und auf die Rolle von Kindern aus. In vielen Familien haben Kinder heute »vorwiegend eine ›psychologische Nutzenfunktion‹. Mit Kinderhaben verbindet sich zunehmend der Wunsch nach Sinn und Verankerung und gleichzeitig ein Glücksanspruch« (Beck-Gernsheim 1990, 138). Eine Folge dieses Anspruchs an das Kind ist, dass seine Erziehung und optimale Förderung als eine besondere Aufgabe angesehen wird. »Überidentifikation, Überbehütung und Übergratifikation werden zu einem zunehmenden Problem« für unsere Gesellschaft (Kraus 2013) und können zu einem überzogenen Kontrollbedürfnis führen. An diese so genannten »Helikopter-Eltern« ergeht deshalb die Aufforderung »Schluss mit Förderwahn und Verwöhnung« (ebd.). »Die Geburtenzahlen gehen zurück. Die Bedeutung des Kindes aber steigt« (Beck 1990, 55). Im Jahr 2012 wurden im Vergleich zu 1960 etwa 50 % weniger Kinder geboren und die durchschnittliche heutige Familiengröße wird mit 1,4 Kindern angegeben. In etwa 42 % Familien lebt danach nur ein Kind und in 42 % Familien leben zwei Kinder, während nur 16 % der Familien drei und mehr Kinder haben (Stat. Bundesamt 2014). Eltern richten deshalb ihre Wunschvorstellungen bezüglich Entwicklung und Leistung oftmals auf diese ein oder zwei Kinder. »Als Resultat dieser vielfältig erkennbaren Ansprüche an Kinder und Eltern verstärkt sich der kulturell vorgegebene Druck: Das Kind darf immer weniger hingenommen werden, so wie es ist, mit seinen körperlichen und geistigen Eigenheiten, vielleicht auch Mängeln« (Beck-Gernsheim 1989, 92). Daraus leitet sich für Eltern eine neue Verantwortung für eine gelingende Entwicklung und bestmögliche Förderung von Kindern ab. »Und schnell nehmen die neuen Möglichkeiten den Charakter neuer Verpflichtungen an« (ebd.). Vor allem Mütter empfinden diese gesellschaftlich vermittelten Erwartungen als neue Aufgabenzuweisung und »die wachsende Verantwortung wirkt sich nun aus als Belastung (…), je mehr das Gebot der optimalen Förderung sich ausbreitet« (Beck-Gernsheim 1990, 142). Entsprechend wurde als Ergebnis einer größeren Umfrage (BiB) festgestellt, dass Eltern heute der zunehmend »hohe Anspruch an sich selbst« zu schaffen macht. Sie »wollen unbedingt gute moderne Eltern sein. Mit ihren überzogenen Idealbildern setzen sie sich aber unnötig selbst unter Druck« und »am Ende stehe das Gefühl, nicht zu genügen« (SZ, 20.3.15).
Eltern macht der hohe Anspruch an sich selbst zu schaffen.
Wenn solche veränderten Anforderungen schon allgemein für Eltern und Kinder heute gelten, ist verständlich, welche besonderen Schwierigkeiten Eltern zu bewältigen haben, deren Kind das Down-Syndrom hat. Seine optimale Förderung mit speziellen Angeboten und Maßnahmen sowie verschiedenen Therapien von Geburt an und über die Kindergarten- und Schulzeit hinaus bedeutet für die Familie immer wieder altersspezifische Anpassungsprozesse zu leisten, um die besonderen Aufgaben zu bewältigen. »Das Zusammenleben mit einem beeinträchtigten Kind verschärft die Herausforderungen der Alltagsgestaltung und Lebensplanung … und erfordert häufig einen erhöhten Kraftaufwand der Eltern, oftmals am Rande der Belastbarkeit«, und »es besteht die Gefahr, dass sich die sozialen Kontakte im Falle einer Überlastungssituation reduzieren und sich die Familie isoliert« (Bundesministerium 2013, 67 f). Deshalb gilt es nicht nur die Förderung des Kindes in den Blick zu nehmen, sondern es sind auch die Konsequenzen für die Mutter zu sehen und die familiären Bedürfnisse anzuerkennen.
»Je mehr verschiedene Therapeuten in unser Haus gekommen sind, umso mehr Ideen haben diese Leute gehabt, was mein Mann und ich alles mit unserem Sohn machen sollten, um ihn optimal zu fördern. Würde ich all diesen Anweisungen nachkommen, würde ich mein Kind von morgens bis abends nur noch therapieren. Aber ich möchte Willis Mama sein und nicht seine Therapeutin, und diese ganzen Mutmaßungen, was für meinen Sohn angeblich gut ist, sind wiederum für mich nicht gut, denn sie lösen ein permanent schlechtes Gewissen bei mir aus, weil ich gar nicht alles tun KANN, was ich tun sollte.« (Müller 2011, 58)
Aber nicht nur die familiären Bedingungen sind zu berücksichtigen, sondern nachdrücklich zu betonen sind auch die gesellschaftlichen Verpflichtungen. So ist die Durchsetzung von sozialen Leistungsansprüchen zu gewährleisten, damit Exklusionsrisiken vermieden und Teilhabechancen für das Kind und seine Familie verbessert werden.
Mit dem Heranwachsen ihres Kindes und den individuellen Lebensbedingungen der Familie verändern sich auch die erforderlichen Verarbeitungsmöglichkeiten und Bewältigungsstrategien von Eltern, die ein Kind mit Down-Syndrom haben. Sie machen immer wieder entsprechende Anpassungsleistungen und eine Umorientierung ihrer Lebensplanung notwendig. Dabei wirkt sich in altersspezifischer Weise die veränderte Bewertung der Rolle von Kindern, der Anspruch auf optimale Förderung und die allgemeine Lebensperspektive aus. Aber die tendenziell positiveren gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber behinderten Kindern führen zu insgesamt vielfältigeren und günstigeren Bedingungen. Dazu beitragen können zudem die neuen rechtlichen Grundlagen der Inklusion in den verschiedenen Lebensbereichen über Kindergarten und Schule bis hin zur Berufstätigkeit (UN-Behindertenrechtskonvention).
»Das Leitbild der Behindertenrechtskonvention ist ›Inklusion‹. Es geht also nicht darum, dass sich der oder die Einzelne anpassen muss, um teilhaben, ›mithalten‹ zu können. Es geht darum, dass sich unsere Gesellschaft öffnet. Dass unser selbstverständliches Leitbild Vielfalt wird und die Grundhaltung, dass jede und jeder Einzelne wertvoll ist mit den jeweiligen Fähigkeiten und Voraussetzungen. Dafür müssen wir in vielen Bereichen neu denken.« (Bentele 2014, 3)
Aber auch den verschiedenen neuen familialen Lebensformen und Lebensbedingungen, der zunehmenden Berufstätigkeit von Müttern, der relativ häufigen Ein-Elternfamilie bei Kindern mit Behinderung (20 %, Bundesministerium 2013, 69) kommt eine große Bedeutung zu, weil Teilhabechancen abhängig sind sowohl von individuellen und familienbezogenen als auch von allgemeinen Umweltfaktoren. Um die Lebenswirklichkeit eines Kindes und Jugendlichen mit Down-Syndrom umfassend zu verstehen, gilt es deshalb, die »Gesamtheit der Ressourcen und Beschränkungen« einer Familie in den Blick zu nehmen. Die Unterstützungs- und Förderangebote müssen »sich auf die wirtschaftliche Lage, auf die Bildung und die soziale Einbindung beziehen« und zwar bezogen auf die ganze Familie (Bundesministerium 2013, 10), damit Förderung und Teilhabe gelingen kann. Zunehmend wichtig wird es auch, die besonderen Bedingungen eines Kindes mit Down-Syndrom zu berücksichtigen, das zweisprachig aufwächst und/oder in einer Familie lebt mit anderen kulturellen und ethnischen Vorstellungen.