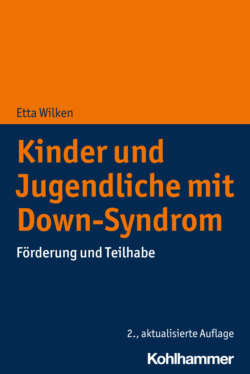Читать книгу Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom - Etta Wilken - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Teilhabe und Förderung in der Familie
ОглавлениеDie Familie bietet dem Kind den natürlichen sozialen Raum für Entwicklung und Geborgenheit und vermittelt sowohl Fähigkeiten, Interessen und Motivationen als auch soziokulturelle und ethnische Einstellungen und Werte. Die meisten Kinder wachsen trotz einer zunehmenden Vielfalt unterschiedlicher Lebensformen in Familien mit Mutter und Vater auf. Unabhängig von den individuell verschiedenen Bedingungen hat jede Familie elementare Bedeutung für die Sozialisation und Enkulturalisation des Kindes, für materielle und emotionale Sicherung seiner Bedürfnisse, für Partizipation in einem familien- und freundschaftlichen Netzwerk.
»Eingebettet in übergreifende gesellschaftliche Werteordnungen, Normen- und Regelsysteme und gesetzliche Rahmungen stellt die Familie die erste und zentrale gesellschaftliche Sozialisationsinstanz dar« (v. Kardorff, Ohlbrecht 2014, 15). Zudem bestimmt sie auch ganz wesentlich die Chancen des Einzelnen, die »vom emotionalen Klima in der Familie, dem milieuabhängig vermittelten sozialen und kulturellen Kapital, der finanziellen Ausstattung und der gesellschaftlich bestimmenden Statusposition der Eltern« abhängig sind (ebd). Auch milieutypische Einstellungen zu bestimmten Kompetenzen und Aktivitäten wie Lesen, Klavierspiel oder Fußball, eine allgemeine Anstrengungsbereitschaft und wertschätzende Interessenförderung sowie genderspezifische Verhaltensweisen und spezifische sprachliche Kommunikations- und Interaktionsstile werden familienabhängig geprägt. Förderung und professionelle Unterstützungsangebote müssen sich deshalb sowohl an der Lebenswelt des Kindes und seinen speziellen Bedürfnissen als auch an der individuellen Lebenslage der Eltern und ihren materiellen sowie sozialen Bedingungen und Ressourcen orientieren.
Für die Sozialisation des Kindes sind sowohl die individuellen Bedingungen als auch die familiären Ressourcen bedeutsam.
Es ist deshalb wichtig, sich mit den aktuellen Entwicklungen der unterschiedlichen Lebensbedingungen von Familien und den teilweise konträren Erziehungshaltungen zwischen Verwöhnung und Vernachlässigung auseinanderzusetzen und daraus Konsequenzen zu ziehen für die Förderung der Kinder in familiären, aber auch in institutionellen Bereichen. Dazu gehört zu reflektieren, wie und was Kinder in ihrem normalen Lebensalltag lernen, wie sie durch Übernahme von Pflichten in der Familie und durch Spielen allein und mit anderen wesentliche natürliche Anregungen und Impulse erfahren.
Gerade dem so genannten inzidentellen Lernen, das sich nebenbei und eher zufällig in Alltagshandlungen und familientypischer Lebensgestaltung ergibt, kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu. »Im Verlauf der ›beiläufigen‹ familialen Sozialisationsprozesse und gezielter Erziehungsbemühungen werden dem Einzelnen die für das (Über-)Leben in der jeweiligen Gesellschaft wesentliche Grundlagen vermittelt« (v. Kardorff, Ohlbrecht 2014, 15). Insofern ist es problematisch, wenn »im Bestreben ihren Kindern das Beste zu ermöglichen … die große Mehrheit der Eltern ihre Kinder vor allem von Alltagspflichten« entbindet (Konrad-Adenauer-Stiftung 2014, 4) und durch diese »Entpflichtung« das Lernen von Verantwortung und Leistungsbereitschaft ihrer Kinder gerade in verstehbaren Alltagszusammenhängen einschränkt. Auch bedeutet die Übernahme von Aufgaben und das Helfen-müssen nicht nur eine lästige Pflicht, sondern es eröffnet dem Kind in konkreten Situationen die wichtige Erfahrung von Helfen-können. Dadurch erlebt es unmittelbar die Bedeutung eigener Kompetenzen und das fördert sein Selbstbewusstsein und die Entwicklung von Selbstwertgefühlen.
Auch für das Aufwachsen von Kindern mit Behinderung ist es wichtig zu reflektieren, wie der gemeinsame Familienalltag zu gestalten ist und welche Möglichkeiten der normalen Teilhabe an Tagesabläufen und an Übernahme von Alltagpflichten und Einbindung in Routinen erfolgen kann. Damit kann ohne Therapeutisierung des Alltags natürliches inzidentellen Lernen gelingen. Gerade bei Kindern mit Down-Syndrom sind nicht nur die durch die Trisomie verursachten Schwächen zu betonen und zu behandeln, sondern auch die individuellen Stärken und famliengebundenen Möglichkeiten und Kontextfaktoren sind zu berücksichtigen. »Das durch die genetischen ›Baupläne‹ vorhandene individuelle Entwicklungspotential kann indes nur durch das Erfahren von förderlichen Umweltbedingungen (enriched environment) und in der Regel zuerst in der Eltern-Kind-Beziehung ausgeschöpft werden« (Peterander 2013, 2). Zwar sind auch die spezifischen Förderbedürfnisse des Kindes mit Down-Syndrom zu sichern, aber ohne das Kind oder das Familiensystem durch zu enge Vorgaben und rigide Förderpläne zu überlasten und die Chancen und Ressourcen des familiären Alltagslebens gering zu achten.