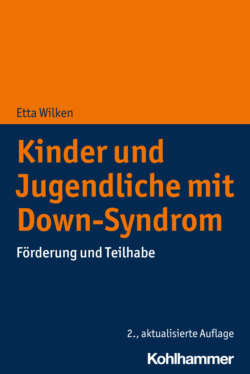Читать книгу Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom - Etta Wilken - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.5 Geschwister
ОглавлениеGeschwister zu haben ist nicht mehr selbstverständlich. Immer weniger Kinder werden in immer weniger Familien geboren! Die Zunahme von Einzelkindern (in Großstädten beträgt ihr Anteil bis zu 50 %) bewirkt, dass Eltern alle ihre Erwartungen auf dieses Kind konzentrieren und sie tendieren dadurch oft sowohl zu Überförderung als auch zu Verwöhnung und Überbehütung (Kraus 2015).
Dem Einzelkind fehlen vor allem Möglichkeiten, soziale Kontakte mit anderen nicht gleichaltrigen Kindern in der Familie einzuüben: Erfahren von Konkurrenz und Teilen, geschwisterliches Rivalisieren, das Aushandeln und Durchsetzen von Interessen, aber auch die Solidarität und die wechselseitige Unterstützung der Geschwister untereinander und gegenüber Fremden. Deshalb ist es in Zukunft stärker eine gesellschaftliche Aufgabe, entsprechende Möglichkeiten für solche Kontakte zwischen Kindern in durchaus altersheterogenen Gruppen zur Verfügung zu stellen.
Zu der »Verinselung« in der Familie mit den eingeschränkten oder nicht gegebenen Peerkontakten tritt die »Verinselung« des Kindes in der Wohnumgebung. Auch hier erscheint die Situation von Kindern in Großstädten besonders prekär, da die Familienhaushalte im Vergleich zu Single- oder Paarhaushalten dort oftmals nur noch eine kleine Minderheit sind. Die »Verinselung« und »Verhäuslichung« vor allem des städtischen Kinderalltags löst den Lernort »Straße« ab. An die Stelle von eigenständigem und selbst gewähltem Spielverhalten treten Freizeitangebote und -formen, die vorweg zu organisieren und pädagogisch arrangiert sind und vor allem in speziellen öffentlichen »Räumen«, wie Vereinen oder Clubs, in Sporthallen oder auf Spielplätzen stattfinden. Zunehmend fehlen vielen Kindern spontane Kontakte mit anderen nicht gleichaltrigen Kindern, und für sie ist deshalb ein achtsamer Umgang mit anderen und Rücksichtnahme nicht selbstverständlich und angemessenes Helfen und Helfen-können im Alltagsleben ist eine seltenere Erfahrung geworden.
Familien ohne und mit einem Kind mit Down-Syndrom unterscheiden sich hinsichtlich der Anzahl ihrer Kinder. Abweichend zu den heute sonst häufigen Einzelkindern in der Gesamtbevölkerung, wachsen Kinder mit Down-Syndrom selten ohne Geschwister auf. So ergab eine Schweizer Untersuchung zur Familiensituation von Kindern mit Down-Syndrom im Vergleich mit durchschnittlichen Familien: »Es gibt weniger Einzelkinder mit DS, etwas weniger Zweikindfamilien, dafür deutlich häufiger Familien mit drei und mehr Kindern« (Jeltsch-Schudel 1999, 57). Auch eine japanische Untersuchung kommt zu einem entsprechenden Ergebnis. Danach war das Kind mit Down-Syndrom in 40 % der Familien das erste Kind, in 48 % das zweite; 40 % der Familien hatten nach der Geburt eines Kindes mit Down-Syndrom noch weitere Kinder. Die durchschnittliche Kinderzahl betrug 2,3 (Tatsumi-Miyajima u. a. 1997). Auch in einer Reutlinger Befragung lag der Anteil der Drei-Kind-Familien bei 21 % im Gegensatz zu den durchschnittlichen 16 % in anderen deutschen Familien (Klatte-Reiber 1997, 198). Eine eigene Befragung von ca. 300 Familien, die ein Kind mit Down-Syndrom haben (Wilken 1999a), ergab, dass 18 % der Familien drei und mehr Kinder hatten. Wenn Kinder mit Down-Syndrom als erste oder zweite Kinder geboren werden, besteht bei den Eltern offenbar öfter der Wunsch nach einem dritten Kind. Auch eine weitere Erhebung bei über 700 Eltern bestätigte diese Tendenz (Wilken 2001a). Die Anzahl der Kinder in den Familien betrug 1 bis 8 Kinder. Davon hatten 42 % der Familien zwei Kinder und 23 % drei Kinder.
Abb.1: Stellung des Kindes mit Down-Syndrom in der Geschwisterreihe
Für die Familiensituation von Kindern mit Down-Syndrom ergibt sich aus den Daten der Erhebung, dass sie zwar etwas öfter in größeren Familien aufwachsen, dass es insgesamt aber nur wenige Unterschiede zu anderen durchschnittlichen Familien gibt. Sowohl die ermittelte Altersstruktur der Eltern als auch die Stellung in der Geburtenfolge der Kinder zeigt überwiegend keine speziellen Besonderheiten.
Durch die normale Einbindung der Kinder mit Down-Syndrom in ihre Geschwisterreihe – selbst wenn sie die Jüngsten sind, besteht meistens kein übergroßer Altersabstand zu den anderen Kindern – sind sie auch in die normalen Spielaktivitäten und Freundschaften ihrer Geschwister oftmals einbezogen. Sie erhalten so vielfältige Anregungen und sind auf selbstverständliche Art in die Familie und ihr soziales Umfeld eingebunden. Allerdings kann diese größere Nähe im Lebensalter der Geschwister auch zu unmittelbarem Vergleichen von Kompetenzen und stärkerer Rivalität führen.
Insgesamt bewerten Eltern in Gesprächen und Diskussionen ihre Erfahrungen mit dem gemeinsamen Aufwachsen ihrer Kinder überwiegend positiv. Auch bei einer neueren Elternbefragung »ergaben sich keine Hinweise auf bedeutsame Belastungen« für die Geschwister (Sarimski 2015, 17). Allerdings wird darauf verwiesen, »dass negative Auswirkungen auf die Geschwister nur dann auftreten, wenn die Kinder mit Behinderungen ausgeprägte Verhaltensproblem zeigen« (ebd.,7).
Als belastend wird, vor allem von den Müttern, oftmals der Anspruch an sich selbst empfunden, allen Kindern in der Familie gerecht zu werden. Auch durch das oft mühsame und fragile Zeitmanagement können Probleme entstehen. Trotzdem ist es wohl eher selten, dass man sich nicht hinreichend um die Geschwisterkinder kümmert – wie manchmal befürchtet wird –, sondern »eigentlich sehe ich immer nur Frauen, die höchstens sich selber vernachlässigen« (Müller 2015, 72).
Viele Eltern wünschen sich, dass ihr behindertes Kind die im Familienalltag gegebene selbstverständliche Teilhabe auch in anderen sozialen Bezügen außerhalb der Familie erleben kann. Sie möchten deshalb entsprechende Rahmenbedingungen und gute Unterstützung für ihr Kind im Kindergarten und in der Schule, damit es nicht nur dabei ist, sondern damit gemeinsames Spielen und Lernen sowohl von ihrem behinderten Kind als auch von den anderen Kindern als positiv erlebt wird.
Auch für ihre erwachsenen Söhne und Töchter mit Down-Syndrom wünschen Eltern sich zunehmend nicht nur spezielle behinderungsorientierte Angebote, sondern geeignete, den unterschiedlichen individuellen Fähigkeiten und Interessen entsprechende angemessene berufliche Tätigkeiten, Freizeitaktivitäten und Wohnangebote, die mehr Teilhabe ermöglichen. Dabei werden diese Ansprüche an die Gesellschaft gestellt, die sowohl die rechtlichen Voraussetzungen als auch die sozialen Bedingungen entwickeln muss (vgl. UN- Behindertenrechtskonvention 2006).
Das hat auch dazu geführt, dass der »psychologische Druck«, der für Geschwister entstehen kann, mit »dem Wunsch und der Erwartung vieler Eltern, dass das gesunde Kind nach dem Tod der Eltern für das behinderte Geschwister sorgt« (Diehl 1999, 49), im Vergleich zu früher sich erheblich verändert hat. Solche Aufgabenzuweisung der Eltern an die Geschwister im Hinblick auf zukünftige Verantwortung ist tendenziell deutlich weniger geworden – obwohl viele Geschwister selbst durchaus bereit sind, sich im Erwachsenenalter um das Geschwister zu kümmern. Selbst wenn die Erwachsenen mit Down-Syndrom in einem Wohnheim leben, sind es oft die Geschwister, die sie zu Festen abholen oder zu einem Wochenendbesuch, sie kümmern sich um besondere Wünsche, regeln aber auch viele Alltagsfragen. Für manche erwachsenen Geschwister ist ein Erfahrungsaustausch mit gleich Betroffenen hilfreich. Einige erwachsene Geschwister nehmen die behinderte Schwester oder den Bruder zu sich nach Hause und es gibt beeindruckende Beispiele fürsorglicher Pflege und Begleitung (LmDS 2015, Nr. 79, 74).