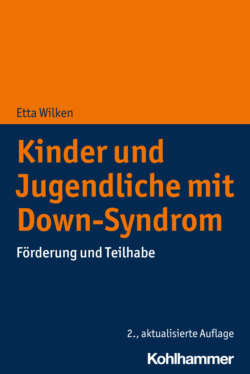Читать книгу Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom - Etta Wilken - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2 Diagnosemitteilung
ОглавлениеEs ist wichtig, bei der Diagnosemitteilung und in der weiteren Begleitung der Eltern nicht nur die besonderen Förderbedürfnisse des Kindes anzusprechen, sondern auch den Eltern selbst angemessene Hilfen zur Verarbeitung ihrer neuen Situation zu geben. »Da die Eltern Teil der sozialen Umgebung und der Gesellschaft sind, unterscheidet sich ihre Grundhaltung zu der Behinderung zunächst nicht wesentlich von den diesbezüglichen Einstellungen ihrer Beziehungspersonen« (Hinze 1993, 15). Deshalb löst die Mitteilung über die Behinderung ihres Kindes bei den Eltern oft tief greifende Krisen aus. »Dabei erleben Eltern starke Gefühle von Bedrohung, Unsicherheit und Angst. Ihr Selbstverständnis ist erschüttert, ihre Lebenseinstellung, ihre Wertorientierung sowie ihr Lebenssinn sind grundsätzlich in Frage gestellt« (ebd., 14).
Die Art und Weise, wie den Eltern die Diagnose vermittelt und dabei über das Kind gesprochen wird, welche Informationen über das Down-Syndrom gegeben werden, wie auf ihre Fragen und Sorgen eingegangen wird, erinnern die Eltern oft noch nach Jahren. Diese Erfahrungen beeinflussen die Einstellungen der Eltern erheblich und prägen nachhaltig, wie sie sich mit ihrer neuen Lebenssituation auseinandersetzen und wie es ihnen gelingt, ihren veränderten Lebensalltag und die besonderen Herausforderungen zu bewältigen. Deshalb kommt der Haltung des Arztes und seiner Fähigkeit, den Eltern die Diagnose einfühlsam zu vermitteln, eine große Bedeutung zu. Wichtig ist auch, angemessene zeitliche und räumliche Bedingungen zu finden, und auch »verbal sollte ein wertschätzender Sprachstil gewählt werden, der eine Orientierung auf Defizite vermeidet« (Seidel 2014, 88). Vor allem stigmatisierende Bezeichnungen spezifischer Merkmale des Down-Syndroms werden von Eltern als emotional belastend erlebt und als deutliche Abwertung ihres Kindes empfunden.
»Der Arzt untersuchte unseren Sohn und stellte dann lapidar fest, dass er vermute, das Kind hätte eine Trisomie, aber das könnte erst die Chromosomenanalyse klären. Aber diese Kinder seien immer so lieb und heute können manche sogar studieren, wenn man genug mit ihnen übt. Der Arzt war freundlich und bemüht, aber seine Informationen halfen uns überhaupt nicht.
Trisomie – Down-Syndrom! Wir waren fassungslos. Was bedeutete das alles für uns! Das konnte doch nicht wahr sein! Unser Sohn, auf den wir uns so gefreut hatten! Die Vorsorgeuntersuchungen waren doch unauffällig gewesen. Was hatten wir falsch gemacht?«
In den letzten Jahren erfolgte eine zunehmend bessere Information der Eltern, und es ist positiv festzustellen, dass problematische Erfahrungen erheblich abgenommen haben. Bei einer früheren Elternbefragung (Wilken 2001a) bezeichneten nur insgesamt 30,6 Prozent der befragten Eltern die erhaltene Erstinformation als gut bzw. sehr gut, während 19,6 Prozent sie als sehr schlecht erlebten. Diese Situation hat sich deutlich verbessert, aber es besteht – wie Berichte von Eltern in Elternseminaren zeigen – weiterhin die Notwendigkeit, diese für die meisten Eltern belastende Erstberatung differenzierter und angemessener zu gestalten.
Für die Befundübermittlung ist wichtig, dass sie »einfühlsam und verständnisvoll sein sollte, verbunden mit Hilfsangeboten und der Vereinbarung weiterer Gespräche. Dabei sollte dieses erste Gespräch nicht von Daten und Informationen überfrachtet sein und Gelegenheit bieten, den Emotionen freien Lauf zu lassen« (Sperling 2007, 48). Auch ist zu bedenken, welche allgemeinen Informationen in den Beratungsgesprächen über Entwicklungsbedingungen beim Down-Syndrom gegeben werden und wie über die verschiedenen Therapien bzw. Behandlungen gesprochen wird, ohne einerseits falsche Grenzen zu beschreiben oder andererseits unrealistische Erwartungen zu wecken. Auch wenn das Down-Syndrom keine Krankheit ist und nicht mit bestimmten Medikamenten geheilt werden kann, sondern eine Lebensbedingung ist, die angenommen und gemeinsam gelebt werden muss, gibt es doch Maßnahmen und Möglichkeiten, die Entwicklung positiv zu beeinflussen. Eltern müssen deshalb angemessen beraten werden, um dann für sich Möglichkeiten zu finden, sich mit ihrer besonderen Situation zu arrangieren und für das Kind, für sich und die Familie passende Lösungen zu finden.
Als hilfreich haben sich bei der notwendigen Neuorientierung die von den verschiedenen Selbsthilfegruppen entwickelten Informationsmappen, Materialien, Ratgeber und Bücher erwiesen, die mit Texten und Bildern den Eltern ein positives Bild vermitteln und Zuversicht für die gemeinsame Zukunft geben wollen. Auch der Austausch in speziellen Internetforen ermöglicht neu betroffenen Eltern, sich zu informieren und Beratung und Hinweise von anderen Eltern zu erhalten, die selbst ein Kind mit Down-Syndrom haben. Oft werden Fragen gestellt zu allgemeinen gesundheitlichen, pädagogischen oder therapeutischen sowie zu rechtlichen Problemen, aber auch bezogen auf sehr individuelle Schwierigkeiten mit dem Kind und in der Familie. Mögliche Lösungen, die andere Eltern für sich und ihr Kind gefunden haben, werden oft differenziert beschrieben und offen, aber zumeist wertschätzend diskutiert.