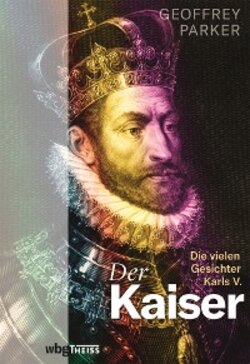Читать книгу Der Kaiser - Geoffrey Parker - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5Vom Frieden über Aufruhr zum Krieg (1519–1521) In Windeseile nach England
ОглавлениеKarls Wahl zum römisch-deutschen König sollte Verschiebungen im europäischen Gleichgewicht nach sich ziehen. Der Sieg Franz’ I. über die Eidgenossen in der Schlacht bei Marignano 1515 sowie die darauf folgende Besetzung von Mailand und Genua durch seine Truppen hatten aus dem französischen König den mächtigsten Herrscher der Christenheit gemacht – und auch den am meisten gefürchteten. Ein englischer Diplomat schrieb damals, was viele dachten: »Die große Erhöhung der Franzosen kann keinem Christenherrscher von Nutzen sein, das liegt an ihrem übermäßigen Ehrgeiz und ihrer unersättlichen Begierde.« Ein anderer behauptete, der »größte, vornehmste und beinahe einzige Grund« aller Probleme in Europa seien »der arrogante und überhebliche Stolz sowie der unersättliche Appetit der Könige von Frankreich«, die es darauf abgesehen hätten, die »Monarchen der [ganzen] Christenheit« zu werden. Für einen französischen Diplomaten hingegen stellte sich die Sache so dar, dass vielmehr Karl als »Kaiser die anderen Könige der Christenheit geringschätzen wird, weil er sich selbst für den größten [unter ihnen] hält«.1
Derartige Befürchtungen waren nicht unbegründet. Einige Wochen vor der Wahl hatte einer von Margaretes Gesandten in Deutschland vorhergesagt, dass zwar das Reich »sich für Seine Majestät als ein teuer erworbenes Gut (une chière mechandise) erweisen« werde, Karl nach seiner Krönung jedoch »der ganzen Christenheit Vorschriften machen« könne. Der Großkanzler Gattinara pflichtete bei. Sobald die Nachricht von Karls Wahlerfolg ihn erreichte, teilte er dem künftigen König und Kaiser sowie den Mitgliedern des Rates mit, »dass der Titel des ›Reichs‹ [imperium] zur Aneignung des ganzen Erdballs berechtigt«. Derlei Ansichten kamen dann – wenig überraschend – auch in der kurzen Dankesrede zum Vorschein, die Karl vor jener deutschen Delegation hielt, die ihm die Nachricht von seiner Wahl überbracht hatte: Nach einer anfänglich großen Freude habe er sich doch Sorgen gemacht, dass »die Entfernung, die Deutschland von seinen spanischen Königreichen trennt, es verhindern würde, dass er Deutschland so regelmäßig besuchen könnte, wie das Reich und die damit verbundenen Verantwortlichkeiten es womöglich erfordern«. Nachdem er »immer und immer wieder neu bedacht hatte, ob er die Wahl nun annehmen oder ablehnen solle«, habe er jedoch erkannt, dass im Fall eines türkischen Angriffs die Ressourcen »des Reiches von dem größten Wert für die Sicherheit Österreichs« sein konnten – aber auch für die Sicherheit »der Niederlande, die an das Reich grenzen, sowie als eine Basis, um sein Herzogtum Burgund zurückzugewinnen«. Das war eine klare Kampfansage an Franz I. Und zu guter Letzt: Wenn er, Karl, die Kaiserwürde ablehne, »wird der König von Frankreich sie mit Sicherheit erringen« – und daraufhin vollkommen unerträglich werden.2
Überlegungen wie diese ließen erkennen, wie sehr die politische Landschaft Europas sich verändert hatte. Noch eine Generation zuvor hatten fünf Großmächte – England, Frankreich, Spanien, Burgund und das Heilige Römische Reich – um die europäische Vormachtstellung konkurriert. Inzwischen herrschte über die drei letzteren Reiche ein und derselbe Mann. Ein englischer Diplomat legte die möglichen Konsequenzen für seinen Herrn mit vorbildlicher Klarheit dar: Heinrich und Karl – »die die Natur in Blutsverwandtschaft verbunden hat ganz wie die alte Freundschaft, die zwischen Euren beiden Häusern so lange schon bestanden hat« – könnten entweder entschiedene Verbündete werden und würden dann »unweigerlich … die ganze Christenheit in beste Ordnung und Frieden bringen, was Euch beiden zu großer Ehre gereichen würde«. Oder aber »die drei mächtigen jungen Herren« – gemeint waren Heinrich (geboren 1491), Franz (geboren 1494) und Karl (geboren 1500) – würden in Streit geraten, und dann »würde die Christenheit in Stücke gerissen und einem endlosen Krieg anheimfallen, wodurch all jenen, die es rechtzeitig hätten verhindern können, großer Schaden … und auch große Schuld zuteilwürde«.3
Eine Zeit lang blieben die »drei mächtigen jungen Herren« der Gefahren gewahr, die von »einem endlosen Krieg« ausgingen, und hielten sich an die Friedensabkommen, die sie bereits geschlossen hatten. Als Karl im September 1518 vom Tod der Tochter Franz’ I. erfuhr, die seine Verlobte war, sandte er seinem »guten Vater« unverzüglich ein Kondolenzschreiben und versprach, stattdessen ihre Schwester zu heiraten, wie im Vertrag von Noyon vereinbart (siehe Kap. 3). Im Folgemonat überzeugte Heinrichs Lordkanzler, der Kardinal Thomas Wolsey, die Vertreter Franz’ I., Karls und etlicher anderer europäischer Herrscher, ihre Signaturen unter den Vertrag von London zu setzen, der den Unterzeichneten nicht nur verbot, einander anzugreifen, sondern sie im Umkehrfall sogar dazu verpflichtete, einen vertragsbrüchigen Partner mit vereinten militärischen Kräften in die Schranken zu weisen. Dennoch lag der alte Argwohn nie allzu fern. Als Franz ein persönliches Treffen mit Karl vereinbaren wollte, um einige offene Punkte zu klären, sprach sich Chièvres dagegen aus und erinnerte daran, »wie man einst mit dem Herzog Johann von Burgund umgesprungen war« (ein Paradebeispiel für ein funktionierendes institutionelles Gedächtnis, denn Chièvres spielte auf den Mord an Herzog Johann Ohnefurcht von Burgund an während einer Unterredung mit dem französischen Dauphin ein Jahrhundert zuvor).4 Stattdessen brachen Chièvres selbst, Gattinara und andere führende Minister Karls nach Montpellier auf, um dort die Streitpunkte mit einer französischen Delegation zu erörtern, die von Artus Gouffier de Boisy angeführt wurde, dem Großmeister von Frankreich sowie Mentor und wichtigstem Ratgeber Franz’ I. Da Gouffier auch an der Spitze jener französischen Delegation gestanden hatte, mit der man zum Vertrag von Noyon gelangt war, bestand auch diesmal einige Hoffnung auf einen guten Ausgang der Verhandlungen; sein plötzlicher Tod am 13. Mai 1519 brachte die Gespräche jedoch abrupt zum Erliegen.
Im Rückblick erkannte der scharfsichtige französische Diplomat Guillaume du Bellay in dem Scheitern der Verhandlungen von Montpellier einen fatalen Wendepunkt: »Der Tod [Gouffiers] verursachte große Kriege, wie noch zu zeigen sein wird, denn wenn [er und Chièvres] ihre Verhandlungen abgeschlossen hätten, wäre die Christenheit vorerst bestimmt im Frieden verblieben. Jene, die hernach die Regierungsgeschäfte führten, sorgten sich nicht so sehr um den Frieden der Christenheit, wie Chièvres und der Großmeister es getan hatten.« Mindestens einer von Franz’ Feldherren war ganz derselben Meinung. Da Chièvres und der Großmeister »sämtliche Angelegenheiten ihrer Herren in Händen hielten«, schrieb der Seigneur de Florange, »starben nach seinem [d. h. Gouffiers] Tod wohl an die zweihunderttausend Männer, die, da bin ich mir sicher, weitergelebt hätten, wenn auch er gelebt hätte«.5
Noch eine Weile verfolgte Karl seine Politik der Beschwichtigung Franz gegenüber weiter – im Juni 1519 zahlte er eine Rate des jährlichen Tributs, der nach dem Vertrag von Noyon wegen der französischen Ansprüche auf Neapel fällig wurde; auch wechselten Franz und er eigenhändige Briefe, in denen sie einander Frieden zusicherten, unabhängig davon, wem von ihnen beiden die Kaiserkrone letztlich zufallen sollte. Aber Karls Wahl verringerte sein Bedürfnis, die Franzosen zu besänftigen, in demselben Maße, wie die Notwendigkeit wuchs, nun die Reichsstände zu besänftigen.6 Die Kurfürsten, denen Karls voreilige Titulatur als »König von Spanien« gewiss noch im Gedächtnis war, legten fest, dass er den Titel »Römischer König« (rex Romanorum) auf keinen Fall vor seiner Krönung nutzen durfte und dass diese Krönung erst stattfinden sollte, nachdem er geschworen hatte, sich an die Wahlkapitulation zu halten, die unmittelbar nach der Wahl in seinem Namen von den kaiserlichen Bevollmächtigten in Frankfurt gebilligt worden war.
Erkannte Karl die volle Bedeutung dieser Wahlkapitulation? Als er seine spanischen Untertanen davon in Kenntnis setzte, dass die kurfürstlichen Gesandten in Barcelona eingetroffen waren, »um unsere Abreise zu erbitten und uns zu begleiten, bis wir in Deutschland sind«, sprach er auch davon, dass ihm »das Wahldekret zu unseren Gunsten« vorgelegt worden sei »zusammen mit den im Gegenzug erforderten Zugeständnissen«. Inhaltliche Einzelheiten dazu nannte er freilich nicht, vielleicht weil sie in einem äußerst gespreizten Deutsch formuliert waren, einer Sprache, die – wie es damals hieß – »er noch nicht sehr gut spricht«.7 Viele der betreffenden Klauseln waren reine Routine: Karl sollte die Rechte und Privilegien der deutschen Fürsten, Prälaten und Reichsstädte achten, Gerechtigkeit walten lassen, keinen der Reichsstände gegen sich aufbringen etc. Einige andere hingegen waren wohl den Befürchtungen geschuldet, die sich an die Wahl eines ausländischen Herrschers zum römisch-deutschen König knüpften: Karl sollte in der Reichsverwaltung nur Deutsche beschäftigen und offizielle Dokumente stets in deutscher oder lateinischer Sprache vorlegen; er durfte den Reichstag nicht außerhalb der Reichsgrenzen zusammentreten lassen und bei seiner Ankunft im Reich keine fremden Truppen mit sich bringen. Bei einigen Klauseln schien der Ärger bereits vorprogrammiert: Karl musste schwören, das Reich nicht in ein Bündnis oder einen Konflikt hineinzuziehen, ohne dass die Kurfürsten dem zugestimmt hatten, und niemals sollte ein deutscher Herrscher oder Untertan vor eine auswärtige Gerichtsbarkeit geladen werden. Außerdem verpflichtete Karl sich, seinen gewöhnlichen Aufenthalt in deutschen Landen zu nehmen; für Zeiten seiner Abwesenheit sollte ein Regentschaftsrat geschaffen werden, dem ausschließlich Deutsche angehören sollten (darunter einige Kurfürsten und andere Fürsten); und er musste schwören, all das rückgängig zu machen, was die Päpste entgegen dem Herkommen der deutschen Kirche eingeführt hatten.8
Die Forderung, er solle unverzüglich zu seiner Krönung nach Deutschland reisen, stellte Karl vor ein Dilemma: Er hatte bereits versprochen, von Katalonien nach Valencia zu ziehen, wo er die Cortes des Königreichs empfangen und deren Huldigung (nebst weiteren Steuerzusagen) entgegennehmen wollte. Chièvres sprach sich dafür aus, dass Karl dieses Versprechen halten und anschließend von Spanien nach Italien segeln sollte, von wo aus er nach Aachen weiterreisen konnte, um sich dort krönen zu lassen – selbst wenn er dafür Franz um die Erlaubnis zum Durchzug durch dessen neu erworbene Territorien Genua und Mailand ersuchen musste. Gattinara jedoch lehnte diesen Reiseplan ab, hauptsächlich wegen einer erst kürzlich erfolgten Annäherung zwischen Frankreich und England. Im Oktober 1518 war es zwischen Franz und Heinrich VIII. zu drei Vereinbarungen gekommen: Franz’ Sohn und Erbe sollte die Prinzessin Mary Tudor heiraten, sobald er vierzehn Jahre alt war; Heinrich sollte unverzüglich Tournai an Frankreich zurückgeben; und die beiden Monarchen wollten bei einem persönlichen Treffen alle noch offenen Problempunkte klären. Unter Karls Ministern sorgte das zunächst keineswegs für Beunruhigung: Auch wenn Tournai schon bald wieder in französischen Besitz überging, waren die beiden verlobten Königskinder doch noch lange nicht volljährig, und auch konkrete Pläne für das vereinbarte Treffen zwischen Franz und Heinrich gab es vorderhand keine. Zu Beginn des Jahres 1520 jedoch änderte sich dieser letzte Punkt, als Franz dem englischen Lordkanzler Wolsey vorschlug, die beiden Königsfamilien sollten bereits im Mai zu einem spektakulären Turnier bei Calais zusammenkommen.9
Gattinara drängte nun Karl, er solle schleunigst durch Aragón und Kastilien bis zu dem galicischen Hafen La Coruña zurückreisen, wo eine Flotte auf ihn wartete. Mit dieser solle er dann »den englischen König abfangen, bevor dieser mit dem französischen König zusammenträfe … um so, wenn möglich, deren Treffen zu verhindern«. Anschließend sollte Karl durch die Niederlande zu seiner Krönung nach Aachen reisen. Zu Gattinaras Plan gehörte es eigentlich auch, dass Karl wie vorgesehen die kastilischen Cortes um die Bewilligung neuer Steuern bitten sollte, um für die erwähnte Flotte zu bezahlen – angesichts der in dem Königreich bestehenden Spannungen eine hochriskante Vorgehensweise –, doch am 22. Januar 1520 gab Karl bekannt, dass er nicht nach Valencia, sondern stattdessen gleich nach Galicien reisen wolle, von dort dann in die Niederlande und weiter nach Deutschland. Schon am nächsten Tag verließ er Barcelona.10
Pedro Mártir de Anglería, der seinen Herrn in Valladolid erwartete, warnte Gattinara (mit dem er von Landsmann zu Landsmann ein offenes Wort pflegte):
»Es heißt, auf den Ratschlag des Geißbocks [d. h. Chièvres’] und der Spanier, die um den König sind, wird Seine Majestät Kastilien um zwei Dinge bitten: Erstens sollen die Cortes in Santiago de Compostela zusammentreten, und alle Städte mit Stimmrecht in den Cortes sollen Bevollmächtigte schicken, denen man aufgetragen hat, jegliche Anweisung des Königs zu befolgen. Man munkelt, dass unter diesen Bedingungen die Freiheit zerstört werde und man derartige Gesetze für gewöhnlich nur Sklaven zumute, wie sie auf dem Markt gekauft und verkauft werden. Ich sehe viele, die geneigt sind, sich dem zu verweigern. Die zweite Bitte ist die Forderung nach einer neuen Steuer, welche die Spanier servicio nennen, und das, obwohl die vorherige noch nicht einmal eingetrieben ist. Ich stelle fest, dass diese beiden Forderungen nicht gerade wohlwollend aufgenommen wurden.«
Als Karl am 4. März 1520 nach kurzem Aufenthalt Valladolid verlassen wollte, läuteten die Sturmglocken und Menschenmassen strömten zu dem Stadttor, durch das der König vermutlich ziehen würde, um ihm ihre Missbilligung zu bekunden. Zwar gelangte Karl rechtzeitig aus der Stadt, aber die zornigen Bürger »begannen sogleich, gegen all jene zu wüten, die für die Steuern gestimmt hatten«, als die Cortes zuletzt zusammengetreten waren.11
Karl ignorierte diese gefährlichen Entwicklungen und verbrachte auf seinem Weg nach Santiago stattdessen vier Tage in Tordesillas bei seiner Mutter und seiner Schwester Catalina. In Santiago zog er sich dann (wie üblich) »während der ganzen Karwoche zum Gebet in ein örtliches Kloster zurück«. Am 31. März eröffnete er die Sitzung der Cortes mit der Forderung nach einem weiteren stattlichen servicio zur Finanzierung seiner Reise nach Deutschland.12 Gattinara zufolge waren Karls Ratgeber in dieser Sache uneins: »Chièvres wollte von ihnen einen neuen servicio fordern. Mercurino war dagegen. Er wies darauf hin, dass der vor zwei Jahren beschlossene servicio noch immer nicht eingetrieben war, weshalb es nicht sinnvoll erscheine, einen neuen zu fordern. Er prophezeite, dass man andernfalls einen Volksaufstand heraufbeschwören werde.« Adrian von Utrecht teilte die Befürchtungen des Großkanzlers und rief Karl später in Erinnerung, dass er eine ähnliche Warnung schon früher ausgesprochen hatte: »Als wir in Santiago waren, sagte ich Eurer Hoheit, dass Ihr die Zuneigung all dieser Untertanen verloren hättet, aber Ihr glaubtet mir nicht.«13 Stattdessen hielt Pedro Ruiz de la Mota, einst ein Felipista, der sein Exil an Karls Hof verbracht hatte, »auf königlichen Befehl« eine wortgewaltige Ansprache an die Cortes, in der er verkündete:
»Die Glorie Spaniens, die lange Jahre geschlummert hat, ist nun wieder erwacht. Von jenen, die Spaniens Ruhm besungen haben, wissen wir, dass andere Völker Tribut nach Rom geschickt haben – Spanien aber schickte Kaiser [Trajan, Hadrian, Theodosius]. Und nun ist das Reich nach Spanien gekommen auf der Suche nach einem Kaiser, und unser König von Spanien ist durch Gottes Gnade zum König der Römer und zum Kaiser der ganzen Welt erwählt worden.«
Der Bischof erinnerte die Delegierten daran, dass »es nicht weniger ehrenvoll ist, das Gewonnene zu bewahren, als es überhaupt erst zu gewinnen – und genau so ist es nicht weniger ehrlos, einem Triumph nicht weiter nachzugehen, als gleich geschlagen zu werden«. Er versicherte der Versammlung in Karls Namen, dass »er mit Gottes Hilfe binnen – allerhöchstens – drei Jahren nach seiner Abreise zurückkehren wird«. Ferner versprach er, dass in Zukunft »kein Amt in diesen Königreichen an jemanden vergeben werden soll, der nicht von hier stammt«. »Sogleich nach der besagten Rede«, fährt der offizielle Sitzungsbericht fort, »gab Seine Majestät höchstselbst den in den Cortes versammelten Prokuratoren« eine feierliche Bestätigung der soeben von Mota gegebenen Versprechen.14
Die Rede erfuhr schon bald in gedruckter Form eine weitere Verbreitung. Gattinara überwachte ihre Metamorphose in einen lateinischen Traktat mit dem Titel »Die unmittelbar vor seiner Abreise gehaltene Ansprache Karls, des Königs der Römer, vor den spanischen Cortes«, in dem Karl prahlte:
»Wer glaubt, die Herrschaft über die ganze Welt falle irgendeinem durch Truppen oder Reichtümer zu oder durch widerrechtliches Drängen oder List, der irrt. Die Herrschaft kommt von Gott allein. Ich habe eine derartige Verantwortung nicht selbst angestrebt, denn ich wäre in der Tat schon mit meinem spanischen Reich (Hispano imperio) zufrieden gewesen, mit den Balearen und Sardinien, mit dem sizilischen Königreich, mit großen Teilen von Italien, Deutschland und Frankreich sowie mit noch einer anderen, sozusagen goldträchtigen Welt [pene alio aurifero orbe, d. i. Amerika].«
Jedoch, fuhr Karl fort, habe ihn eine »schicksalhafte Notwendigkeit« dazu gezwungen, die Kaiserwürde auf sich zu nehmen:
»[Diese] Entscheidung muss auch aus der gebührenden Ehrfurcht vor der Religion heraus getroffen werden, deren Feind [d. h. die Türken] sich so sehr ausgebreitet hat, dass weder der Frieden der Christenheit noch die Würde Spaniens noch schließlich das Wohlergehen meiner Königreiche einer solchen Bedrohung gewachsen wäre. All diese werden kaum fortbestehen können, wenn ich nicht Spanien mit Deutschland verbinde und dem König von Spanien den Titel des Kaisers hinzufüge.«
Und um das alles zu erreichen, brauchte er nur bescheidene 500 000 Dukaten.15
Als Redebeitrag war das schön und gut, doch schien es, wie Juan Manuel Carretero Zamora bemerkt hat, allzu vielen im Publikum, als sei »die neue Krone, die auf das Haupt Kastiliens hinabgestiegen war, in Wahrheit eine Dornenkrone«. Anders als die Ständeversammlungen in den Niederlanden, in Deutschland oder selbst in Aragón besaßen die Cortes von Kastilien – dem reichsten unter Karls Besitztümern – »so gut wie keine ›verfassungsmäßigen‹ Verteidigungsmittel (ob institutionell, demokratisch oder fiskalisch) gegen einen jungen König, der in seinem neu gewonnenen Königreich nur die Gans erblickte, die goldene Eier legt«. Die Delegationen gleich mehrerer Städte verweigerten die Kooperation. Toledo hatte erst gar keine Prokuratoren entsandt; stattdessen brachten zwei angesehene Bürger der Stadt »eine Petition vor des Inhalts, dass die Gesetze des Königreiches nicht auf derart himmelschreiende Weise gebrochen werden sollten« – jedoch hörte Karl ihnen (wie Mártir berichtet) nur »auf eine äußerst unfreundliche Weise zu«.16 Weil er unbedingt noch Heinrich sehen wollte, bevor er sich mit Franz traf, befahl er den verärgerten Prokuratoren, ihm von Santiago nach La Coruña zu folgen, wo seine Flotte vor Anker lag. Auch verkündete er, er habe Adrian von Utrecht für die Zeit seiner eigenen Abwesenheit zum »Administrator und Gouverneur« von Kastilien, der Kanarischen Inseln und der spanischen Besitzungen in Amerika ernannt. Diese Entscheidung beruhe auf »unserem eigenen Antrieb, vernünftiger Erwägung und unserer absoluten königlichen Gewalt, die wir auszuüben wünschen und ausüben als ein König und Herr, der keine andere weltliche Macht über sich weiß«. Zweifellos hielt er diese Begründung für umso angebrachter, als die Ernennung Adrians einen Verstoß gegen jenen feierlichen Eid bedeutete, den Karl erst kurz zuvor den Cortes geleistet hatte: dass nämlich »kein Amt in diesen Königreichen an jemanden vergeben werden soll, der nicht von hier stammt«.17 Umgehend meldete sich eine Gruppe kastilischer Adliger zu Wort, die den König aufgebracht »daran erinnerten, dass ein minderjähriger König (pupilo) nach den Gesetzen Kastiliens nur einem Spanier die Regierungsgeschäfte anvertrauen dürfe, nicht jedoch einem Fremden«, woraufhin Karl zurückschnappte, dass »er ja kein Minderjähriger mehr sei und dies nun einmal so tun wolle« (die erste belegte Wortmeldung Karls in eigener Sache).18 Und obwohl eine Mischung aus Bestechungsgeldern und anderen Zugeständnissen die in La Coruña festsitzenden Prokuratoren schließlich dazu bewegen sollte, dem neuen servicio zuzustimmen, lehnten es manche Städte weiter ab, die Zahlungen zu leisten – mit der Begründung, es sei »nicht recht, dass Seine kaiserliche Majestät die Einkünfte dieses Königreiches in seinen anderen Herrschaftsgebieten ausgibt«. Auch beklagten sie sich darüber, dass Karl seine Wahl im Reich angenommen hatte, »ohne den Rat oder die Zustimmung dieser Königreiche einzuholen«.19 Im April und Mai 1520 nötigten Unruhen in mehreren kastilischen Städten Vertreter der Krone zur Flucht; das entstehende Machtvakuum füllten Kommunalregierungen (von deren spanischem Namen sich die Bezeichnung »Comuneros-Aufstand« herleitet). Karl indessen kümmerte sich – obwohl er noch sechs Wochen in Galicien auf einen günstigen Wind zur Abreise wartete, fast so lange wie drei Jahre zuvor in Zeeland – kaum um diese Entwicklungen. Stattdessen konzentrierten seine Minister und er sich ganz auf ihre Angelegenheiten in den Herrschaftsgebieten im Norden.
Am 20. Mai schließlich konnte Karls Flotte in See stechen und legte nach einer Reise von nur sieben Tagen im englischen Dover an, wo Lordkanzler Wolsey den jungen König an Land begrüßte und ihn nach dem Abendessen auf Dover Castle zu dem Schlafgemach geleitete, das man schon für ihn vorbereitet hatte. Als Heinrich die Nachricht von Karls Eintreffen hörte, sprang er kurz entschlossen auf sein Pferd, ritt zur Burg und drang »in die Kammer ein, in der Seine kaiserliche Majestät schon schlief, und dort umarmten sie sich und tauschten noch andere Zeichen ihrer gegenseitigen Zuneigung«. Am nächsten Morgen lernte Karl seine Tante Katharina von Aragón kennen und auch Heinrichs Schwester Mary, die vormalige »Prinzessin von Kastilien«. Man speiste, trank und tanzte, wobei die Festivitäten immer wieder von ernsthaften politischen Gesprächen unterbrochen wurden, die das Fundament für ein engeres Bündnis zwischen den beiden Herrschern legen sollten. Nach drei Tagen ging Karl wieder an Bord seines Flaggschiffs und segelte in Richtung Niederlande davon.20
Heinrich hingegen setzte über den Ärmelkanal nach Calais, um dort auf dem Camp du Drap d’Or (»Feld des goldenen Tuches«) mit Franz I. zusammenzutreffen: ein legendäres, aufwendiges Ereignis, das beinahe drei Wochen andauerte und zahlreiche Turniere und Bankette einschloss. Ein wirklicher Erfolg war jenes Treffen allerdings nicht – teils wohl, weil Franz den höchst selbstbewussten Heinrich bei einem spontanen Ringkampf beschämte, indem er ihn kurzerhand zu Boden warf; teils auch, weil Chièvres und Wolsey bereits geheime Absprachen über eine erneute Zusammenkunft ihrer beiden Herren getroffen hatten. Diese setzten unmittelbar im Anschluss an das große englisch-französische Spektakel ihre eigene politische »Unterredung« (das von einem venezianischen Diplomaten gebrauchte Wort: abochamento) fort. Am 14. Juli 1520 unternahmen Heinrich und Karl also einen gemeinsamen Ausritt in der Nähe von Calais und »unterhielten sich lange Zeit zu zweit, wobei der König von England beinahe in das Ohr des Kaisers hineinsprach«. Dann »umarmten sie einander überaus herzlich, wobei sie ihre Hüte in Händen hielten«, und nahmen Abschied.21
Die beiden Monarchen hatten allen Grund, geheimniskrämerisch und herzlich zugleich zu sein: Immerhin hatten sie gerade vereinbart, einen ständigen Botschafter an den Hof des jeweils anderen zu entsenden. Ferner wollten sie binnen zwei Jahren ein weiteres Treffen zur Abstimmung ihrer jeweiligen Außenpolitik abhalten und bis dahin kein weiteres Bündnis mit Frankreich eingehen. Vor allem aber wollten sie »einander beistehen, sollte eines ihrer Reiche von einem äußeren Feind angegriffen werden«. Heinrich war damit zu einem Hauptakteur auf dem internationalen Parkett herangewachsen, und Karl hatte einen entscheidenden Vorteil gegenüber seinem ärgsten Rivalen im nördlichen Europa erlangt.22