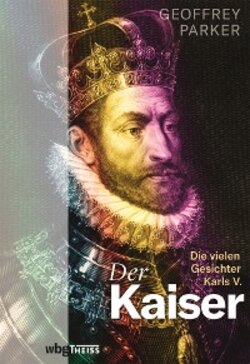Читать книгу Der Kaiser - Geoffrey Parker - Страница 43
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7Ein ungenutzter Sieg (1525–1528) Wehe den Besiegten!
Оглавление»Gegen Mittag« des 10. März 1525 kam »ein Bote aus Italien, der durch Frankreich gereist war«, atemlos im Alcázar von Madrid an, wo Karl sich gerade aufhielt, »krank und missvergnügt, von seinen Pflichten schwer bedrückt«. Der Bote
»wurde vor Seine Majestät gebracht, die sich gerade mit zweien oder dreien ihrer Ratgeber über die Lage in Italien unterhielt. Da sagte der Bote dem Kaiser: ›Sire, vor Pavia ist es zur Schlacht gekommen. Der König von Frankreich ist als Gefangener in Eurer Majestät Gewalt und sein gesamtes Heer wurde vernichtend geschlagen.‹ Kaum hatte [Karl] diese wenigen Worte gehört, da stand er wie versteinert und wiederholte: ›Der König von Frankreich ist mein Gefangener und wir haben die Schlacht gewonnen?‹ Dann zog er sich, ohne auch nur ein weiteres Wort zu sagen oder mehr erfahren zu wollen, allein in ein anderes Gemach zurück und fiel vor einem Bild der heiligen Jungfrau auf die Knie, das er am Kopfende seines Bettes aufbewahrte.«
Karl »verbrachte eine gute halbe Stunde derart zurückgezogen, lobte und pries Gott«, bevor er wieder zurückkam, um von dem Boten einen Brief entgegenzunehmen, den ihm Charles de Lannoy, der siegreiche Anführer der kaiserlichen Truppen, geschrieben hatte.1 Lannoy hatte Karl und vor ihm bereits Maximilian lange und treu gedient; deshalb konnte er es sich erlauben, in seinem Brief auch eine ernste Mahnung auszusprechen: »Sire, Ihr werdet Euch bestimmt noch an das erinnern, was Monsieur de Beersel [der Obersthofmeister aus Karls Kindertagen] zu sagen pflegte: dass nämlich Gott jedem Menschen einmal im Leben eine gute Ernte beschert (en leur vie ung bon aoust) und dass man, fährt man diese Ernte nicht rechtzeitig ein, Gefahr läuft, nie wieder solche Frucht zu sehen. Ich schreibe Euch dies nicht«, fuhr Lannoy fort, »weil ich glaube, dass Euer Majestät die Gelegenheit verstreichen ließe«, sondern vielmehr »weil Ihr, ganz egal, wie Ihr Euch entscheidet, nun rasch handeln müsst«.2
Die Nachricht von dem Sieg verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und die auswärtigen Botschafter strömten in das Schloss, wo der Kaiser sie huldvoll empfing, einen nach dem anderen, so lange, bis schließlich die Nacht hereinbrach. (Eine Ausnahme stellte der venezianische Botschafter Contarini dar: Da die Republik Venedig mittlerweile mit Frankreich verbündet war, bestrafte Karl den Botschafter für diesen Treuebruch, indem er ihn nicht seine Hand küssen ließ.) Die Anwesenden nahmen mit Bewunderung zur Kenntnis, dass »man an Seiner Majestät keinerlei Veränderung feststellen konnte, weder in seiner Miene noch in seinen Gesten, die allesamt ganz gewöhnlich blieben, obwohl dies doch ein so außergewöhnlicher Anlass zur Freude war«. Karl verbot denn auch »jegliche öffentlichen Jubelfeiern, nur eine Prozession ließ er zu, um Gott Lob und Dank zu sagen und für die Toten zu beten, da der Sieg ja gegen andere Christen errungen worden war«; und am Tag darauf »begab er sich, nachdem er die Beichte abgelegt und die heilige Kommunion empfangen hatte, in die Kirche Unserer Lieben Frau von Atocha, wo er verkündete, dass dieser Sieg von Gott gekommen sei, nicht von ihm selbst, damit jedermann noch geneigter wäre, dafür Dank zu sagen.« Gegenüber dem englischen Gesandten Richard Sampson äußerte der Kaiser, dass
»er die Gnade, die Gott erwiesen hatte, für umso größer erachte, als sie nicht durch irgendein Verdienst seiner selbst erworben, sondern unmittelbar der göttlichen Güte entsprungen sei. Er schätze sie aus drei Gründen so hoch: erstens, weil ihm dadurch gewiss geworden sei, dass die Gnade Gottes auf ihm ruhe; zweitens, weil ihm nun die Möglichkeit gegeben sei, endlich sein beständiges Verlangen nach einer Befriedung der ganzen Christenheit unter Beweis zu stellen; und drittens, weil er nun seinen Feinden Gnade erweisen und jenen eine zweite Chance gewähren könne, die ihm Schaden zugefügt hatten, und weil er seine Freunde und Getreuen belohnen könne, die ihm gut gedient hatten.«
Sampson leitete diese Äußerung von Mäßigung und Bescheidenheit in einem langen Brief an Kardinal Wolsey weiter – zweifellos, um in Erfahrung zu bringen, ob sein Herr und Meister bei seiner kürzlich getroffenen Entscheidung bleiben wollte, sich vom Kaiser abzuwenden und stattdessen ein Bündnis mit Frankreich zu schließen. Hoffnungsfroh fügte er die Worte Karls hinzu, dass
»dieser Sieg eher seinen Freunden zum Vorteil gereichen solle als ihm selbst … Und mit demütigen Worten dankte er Gott und sagte, er bete täglich darum, dass Gott ihm die nötige Gnade gewähren möge, um gut zu regieren und seinen bestehenden Besitz wohl zu verwalten. Und was seine Feinde betreffe, so sollten diese deutlich sehen, dass … ihm daran gelegen sei, sich derart maßvoll zu betragen, dass auch nicht die geringste Absicht zur Grausamkeit, nicht das leiseste Sinnen auf Rache bei ihm gefunden werden könne.«3
Diese Demut war reine Maskerade. Niemals vergaß oder vergab Karl eine erlittene Schmach, wie Jean Glapion ja schon festgestellt hatte; und was das »Sinnen auf Rache« betraf, so hatte der Kaiser bereits detaillierte Pläne geschmiedet. Bereits nach den ersten militärischen Erfolgen des Jahres 1521 hatte Karl seine Diplomaten angewiesen, gleich zu Beginn von Gesprächen mit der französischen Seite »die Einzelheiten unserer Ansprüche aufzuführen, die sich aus allen alten Streitigkeiten im Reich ergeben, und dazu auch jene, die Kastilien, Aragón, Navarra, Sizilien und Burgund betreffen« – mit anderen Worten wollte der Kaiser also sämtliche Territorien wieder unter seine Herrschaft bringen, über die einst seine Vorfahren geherrscht hatten.4 Diese Ziele hatten sich nicht geändert. Im Februar 1525, als Karl gerade erfahren hatte, dass der Papst und die Venezianer sich mit dem französischen König gegen ihn verbündet hatten, beschied er einigen Höflingen:
»Ich rechne mit Hiobsbotschaften aus Mailand und Neapel, aber es schert mich nicht im Geringsten. Ich werde nach Italien ziehen, und dort werde ich bessere Gelegenheit haben, mein Eigen zu verteidigen und an denen Rache zu nehmen, die sich mir in den Weg gestellt haben – vor allem an diesem Schuft (villaco), dem Papst. Wer weiß, vielleicht wird sich eines Tages herausstellen, dass Martin Luther doch das Richtige getan hat.«
»Das waren bemerkenswerte Worte«, hielt ein Botschafter fest, »denn sie kamen aus dem Mund des Kaisers, dessen Rede üblicherweise sehr zurückhaltend ist«.5 Eine ähnlich unbeherrschte Bemerkung machte Karl gegenüber seinem eigenen Botschafter beim Heiligen Stuhl, dem Herzog von Sessa. Diesem erklärte er, dass trotz der Entscheidung der Venezianer und des Papstes, sich mit Frankreich zu verbünden,
»wir die nötige Unterstützung für unsere Truppen weder jetzt vernachlässigen noch je vernachlässigen werden, und mit Gottes Hilfe werden wir, um dieses Vorhaben endlich zu einem guten Ende zu bringen, die Mittel und Ressourcen aller unserer Königreiche und Territorien darauf verwenden, ja wir werden sogar die Sicherheit unserer eigenen Person nicht schonen, wenn es nötig ist, sodass die Franzosen zwar versuchen werden, uns mit ihren üblichen Listen in die Irre zu führen; unsere Freunde und Verbündeten jedoch werden feststellen, dass unsere Stärke keineswegs geschmälert sein wird. Nein, im Gegenteil: Wir werden ein harter Gegner sein, ganz wie zuvor.«
Dann versicherte er noch einmal – zweifellos, um den Papst ein wenig einzuschüchtern –, dass »angesichts der Manier, in der Seine Heiligkeit uns behandelt, nun nicht der Zeitpunkt ist, sich mit der Lutherfrage auseinanderzusetzen«.6
Die Siegesnachricht aus Pavia stärkte Karls Selbstbewusstsein in hohem Maße. In den ersten Briefen, die er unmittelbar darauf an seine führenden Minister richtete, um ihnen die frohe Kunde mitzuteilen, führte er den Sieg noch ganz auf das Walten der göttlichen Vorsehung zurück – aber bald bemerkte er, dass dieser Sieg ja zugleich an seinem eigenen Geburtstag errungen worden war, als ob auch dies ein Werk der Vorsehung gewesen wäre. In einer offiziellen Darstellung der Geschehnisse, die Gattinaras Sekretär Alfonso de Valdés verfasste und die auf Anweisung von Karls Kronrat gedruckt wurde, heißt es, der Ausgang der Schlacht bei Pavia – geschlagen zu einem Zeitpunkt, als »all die Freunde und Verbündeten, auf die [Karl] sich immer verlassen hatte, untätig blieben, ja einige sich sogar gegen ihn stellten« – zeige ganz deutlich, dass Gott »ihm den Sieg verliehen hat, wie er es mit Gideon in seinem Kampf gegen die Midianiter tat«. Insbesondere, schrieb Valdés voller Begeisterung, »hat Gott dem Kaiser diesen Sieg auf wundersame Weise gewährt, nicht nur, damit dieser die Christenheit verteidigen und sich der Türkenmacht entgegenstellen könne«, sondern auch,
»damit er nach dem Ende dieser Bürgerkriege (und so sollten wir sie nennen, da sie ja unter Christen wüten) … die Türken und Muselmanen in ihren eigenen Ländern aufsuche und – indem er unseren heiligen katholischen Glauben verherrlicht, wie es schon seine Vorfahren taten – das Reich von Konstantinopel und die Heilige Stadt Jerusalem zurückerobere, die unserer Sünden wegen besetzt sind, auf dass (wie viele schon geweissagt haben) unter diesem allerchristlichsten Herrscher jedermann unseren heiligen katholischen Glauben annehme und die Worte unseres Erlösers erfüllt werden mögen: ›Nur eine Herde und einen Hirten soll es geben!‹ [vgl. Joh 10,16]«7
Um die »Bürgerkriege« zu beenden und damit den Auftakt zu jenen anderen hochgesteckten Zielen zu geben, sahen Karls Minister zwei Optionen: Entweder konnte der Kaiser in Absprache mit Heinrich VIII. die Eroberung und Aufteilung Frankreichs in Angriff nehmen, so wie sie es in ihrem »Großen Vorhaben« anvisiert hatten, oder er konnte Franz im Alleingang dazu zwingen, seine Freiheit mit erheblichen territorialen Zugeständnissen zu erkaufen. Der Herzog von Bourbon favorisierte die erste Option und versprach Heinrich, dass er ihm »die Krone von Frankreich auf das Haupt setzen werde, und zwar schon bald; und dass inzwischen schon mit 100 000 Kronen mehr zu deren Erlangung getan werden könne, als zuvor mit 500 000 Kronen möglich gewesen wäre, weil eben der König [Franz] und die meisten seiner adligen Gefolgsleute und Heerführer entweder gefangen oder gefallen waren«.8 Andere sprachen sich für die zweite Option aus. Als er von dem überraschenden Sieg bei Pavia erfahren hatte, mahnte Karls Botschafter in Rom seinen Herrn (ganz ähnlich, wie es auch Lannoy getan hatte): »Ihr habt nun keine Zeit zu verlieren: Ordnet alles Nötige an«, um den Franzosen größere Zugeständnisse abzuzwingen. Ferdinand pflichtete bei: Sein Bruder solle »sein Glück nun nutzen und sicherstellen, dass weder der jetzige König von Frankreich noch seine Nachfolger jemals die Stärke haben werden, Euch oder Euren Nachfolgern gefährlich zu werden«. Insbesondere solle Karl »das Schicksal des Hannibal vermeiden, das jener erlitt, nachdem er die Römer bei Cannae vernichtend geschlagen hatte«, – und die beste Art, dies zu tun, fuhr Ferdinand fort, war es, dem König von Frankreich »einige Federn aus seinen Schwingen zu rupfen, sodass er nicht mehr fliegen kann, wie sehr er sich auch anstrengt, und dann können der Kaiser und seine Nachfolger sicher sein, sich eines ewigen Friedens zu erfreuen«.9
Gattinara stimmte zu und berief sich dabei auf denselben antiken Präzedenzfall, wie Ferdinand es getan hatte: »Man wird von Euch sagen, was man über Hannibal gesagt hat: Ihr wisst Schlachten zu gewinnen, aber Ihr wisst Eure Siege nicht auszunutzen.«10 Deshalb unterbreitete der Kanzler Karl und seinem Rat zwanzig konkrete Vorschläge dazu, wie man dem gallischen Hahn »einige Federn aus seinen Schwingen rupfen« konnte. Zunächst sei es absolut notwendig, Franz weiterhin gefangen zu halten, »bis wir einen dauerhaften Frieden vereinbart und vollzogen haben mit dem Rat und der Zustimmung aller Stände, Gerichtshöfe und sonstigen Autoritäten Frankreichs«. Mit Franz selbst sollte Karl gar nicht verhandeln, sondern mit dessen Mutter, der Regentin Luise von Savoyen, weil »es viel besser, ehrenhafter und auch sicherer ist, mit freien Menschen zu verhandeln als mit Gefangenen«. Diese müsse im Namen ihres Sohnes unverzüglich alle Ansprüche auf das Artois, Burgund, Flandern, das Herzogtum Mailand und das Königreich Neapel aufgeben und Karl alles zurückgeben, »was dem verstorbenen Herzog Karl [dem Kühnen] durch die Verträge von Arras, Conflans und Péronne zuteilgeworden«, jedoch später von Frankreich annektiert worden war (die besagten Verträge waren 1435, 1465 und 1468 geschlossen worden). Sie dürfe zudem den Herzog von Geldern sowie Robert de La Marck und alle anderen, die Karl angegriffen hatten, nicht weiter zu schützen versuchen und müsse »Monsieur de Bourbon wieder in sein Recht setzen und begnadigen und ihm die Provence geben, da sie ein Reichslehen ist«. Auch die Unterstützer des Herzogs, die ins Exil gegangen waren, sollten rehabilitiert werden. Weiter schlug Gattinara noch vor, der Papst solle »dazu gebracht werden, ein allgemeines Konzil einzuberufen«, um die Kirche zu reformieren. Außerdem hätten er und alle anderen, die sich jüngst gegen Karl gewandt hatten (insbesondere die Republik Venedig) einen Beitrag zum Unterhalt von Karls Italienarmee zu leisten.11
Der Kaiser erteilte diesen umfangreichen Forderungen seinen Segen, und Ende März machten seine Boten sich auf den Weg, um sie Luise von Savoyen zu überbringen. »Ihr müsst uns unverzüglich von ihrer Reaktion auf all diese Punkte in Kenntnis setzen«, beharrte er, »damit wir bald wissen, ob es Frieden geben wird oder ob wir einen anderen Weg einschlagen müssen, um unser rechtmäßiges Eigen zurückzugewinnen«. In einem Brief an Lannoy legte der Kaiser dar, was genau er sich unter diesem »anderen Weg« vorstellte. Zunächst versicherte er dem Vizekönig, dass »wir nicht die Absicht haben, unsere Truppen an irgendeinem der Kriegsschauplätze nach Hause zu schicken, damit wir, sollten wir durch Milde (doulceur) keinen Frieden erlangen können, umso bereiter sein werden, ihn mit Gewalt anzustreben und auch zu gewinnen«. Falls die Franzosen seine Bedingungen ablehnten »oder versuchen sollten, unsere Zeit zu verschwenden mit Verzögerungen und schönen Worten«, dann werde er selbst ein Heer in das Languedoc führen, während Lannoy und der Herzog von Bourbon entweder in die Dauphiné oder die Provence einfallen sollten. In Avignon würden sie ihre Kräfte dann vereinen. Zwar meinte Karl, im Moment sei »noch nicht die Zeit, mit Härte vorzugehen, um den Papst und die Venezianer nicht zu verprellen und mit ihnen fast den ganzen Rest Italiens«, jedoch hätten die Herrscher Italiens »ihre Feindseligkeit uns gegenüber deutlich erkennen lassen«, weshalb sie natürlich Strafe verdienten. Der Vizekönig müsse daher so handeln, »wie es Euch am besten erscheint, entweder indem Ihr Milde walten lasst oder indem Ihr Euch verstellt und abwartet, bis eine Lösung sich deutlicher abzeichnet«.12 Darüber hinaus sah der Kaiser »nichts Weiteres, das unternommen werden könnte – abgesehen von einem Angriff auf die Heiden, der mir schon lange vorschwebt und ganz besonders jetzt«, und so bat er Lannoy inständig: »Helft mir, diese Dinge zufriedenstellend zu regeln, damit ich Gott einen Dienst erweisen kann, solange ich noch jung bin.«13