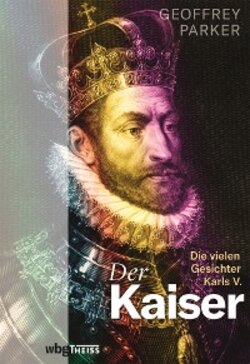Читать книгу Der Kaiser - Geoffrey Parker - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Reformation als Ritterturnier
ОглавлениеAleandro gab sich alle Mühe, diese Harmonie zu stören. In seinem Bestreben, Luthers sofortige Verurteilung herbeizuführen, legte der Legat dem Kaiser einen Entwurf für ein Edikt vor, durch das die Reichsacht über Luther verhängt werden sollte. Karl tat vorerst jedoch nichts dergleichen, sondern lud »de[n] ersamen unsern lieben andechtigen doctor Martin Luther, Augustiner Orden« nach Worms, wo dieser binnen drei Wochen zu erscheinen hatte. Auch ließ der Kaiser den versprochenen Geleitbrief ausstellen, und so dauerte es nicht mehr lange, bis am 17. April »um die Zeit der Vesper, also gegen vier Uhr nachmittags«, Luther vor Karl und dem versammelten Reichstag auftrat. Noch mehr als ein Jahrzehnt danach konnte sich ein Augenzeuge bestens an das Gefühl allgemeiner Aufregung erinnern, das damals geherrscht hatte: »Als Luther höchstpersönlich kam, strömte alle Welt herbei, um ihn zu sehen.«58 Der Reichstag selbst hatte über hundert Teilnehmer, dazu kamen zahlreiche weitere auswärtige und deutsche Würdenträger, Angehörige des kaiserlichen Hofes (darunter auch der künftige Großinquisitor Fernando de Valdés) und Zuschauer aus dem Volk – alles in allem ergab sich so ein Publikum von etwa tausend Personen. Karl saß auf einem Podest in dem großen Saal Luther gegenüber, der »den Habit eines Augustinermönches mitsamt dem dazugehörigen Ledergürtel« trug; mindestens einem Augenzeugen erschien Luther »sehr hochgewachsen, größer als die meisten Leute«. Man hätte im Saal eine Stecknadel fallen hören können, als Johannes Eck, der als »Sprecher des Kaisers und des Reichstages« auftrat, sich von seinem Platz erhob, um eine Liste angeblich von Luther verfasster Schriften mitsamt kurzen Inhaltsangaben zu verlesen. Von einem Zwischenruf des frechen »Bruder Martin« – »Ihr habt ja gar nicht alle meine Bücher erwähnt!« – ließ Eck sich nicht beirren, sondern stellte dem Mönch stattdessen zwei Fragen, die Aleandro formuliert hatte und die Luther bereits vorab mitgeteilt worden waren: Hatte Luther all die Schriften verfasst, deren Titel und Inhalt gerade verlesen worden waren? Und wenn ja, »wollt Ihr [diesen Inhalt] noch einmal überdenken oder Euch von Euren Schriften – als von etwas Widersinnigem und Ketzerischem – distanzieren?« Nachdem er »seine Treue dem Kaiser gegenüber beschworen« hatte, antwortete Luther zunächst in lateinischer Sprache und dann noch einmal auf Deutsch, »wobei sein Gesicht und seine Gesten Anspannung und Unbehagen erkennen ließen: Was den ersten Punkt betreffe, [antwortete er,] dass diese Bücher die seinen seien; was aber den zweiten Punkt betreffe, so erbat er sich Bedenkzeit bis zum folgenden Tag.« Damit hatte Karl wohl nicht gerechnet, und so »zog er sich mit seinem Geheimen Rat an einen anderen Ort zurück«, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Nach ihrer Rückkehr wandte sich Eck erneut an Luther:
»Die Frage, die man ihm gestellt habe, betreffe bedeutende Dinge, die er selbst getan habe und von denen er doch wissen müsse, und deshalb solle er jetzt sofort antworten und nicht noch weiteren Aufschub verlangen; dennoch habe Seine Majestät mit der ihr eigenen Milde beschlossen, ihm eine Bedenkzeit bis zur selben Stunde am folgenden Tag zu gewähren. Und damit war die Zeremonie für jenen Tag beendet und der Kaiser zog sich zum Abendmahl in das Obergeschoss zurück.«59
Indem er auf die Forderung nach einem Aufschub einging, hatte Karl einen entscheidenden Fehler begangen: Luther hatte ja die ihm gestellten – und noch dazu recht simplen – Fragen tatsächlich schon vorher gekannt; es bestand also überhaupt kein Grund, ihm zur Vorbereitung seiner Antworten noch weitere Bedenkzeit einzuräumen.
Denn nun wurde das Szenario, vor dem sich Aleandro wohl schon gefürchtet hatte, Wirklichkeit. Am 18. April nach einer Nacht der Besinnung, in der Luther augenscheinlich seine »Anspannung« und sein »Unbehagen« überwunden hatte, trat er zur selben Uhrzeit erneut vor den Reichstag, nur um festzustellen, dass »der Kaiser und die Fürsten sich in einem anderen Raum im Obergeschoss aufhielten« (wo sie zweifellos darüber Rat hielten, was nun als Nächstes geschehen sollte). Daher »wartete der selbige Martin eine und eine halbe Stunde vor seiner Befragung«, umgeben (und womöglich auch beflügelt) von »der riesigen Menschenmenge, die mit ihm gekommen war«.60 Schließlich kam, begleitet von seinen Ratgebern, Karl »in den großen Saal herab« und nahm auf seinem erhöht auf einem Podest platzierten Sessel Platz. »Es waren so viele Menschen zugegen, dass außer dem Kaiser fast niemand Platz zum Sitzen hatte«; und wie am Tag zuvor herrschte absolute Stille, als Johannes Eck aufstand, um seine Fragen an Luther zu wiederholen. Diesmal bejahte Luther nicht nur, dass er die vor den Augen des Publikums ausgelegten Bücher verfasst hatte (»und noch einige andere, die fehlen«), sondern fing an zu erklären, dass sich diese Werke in drei klar unterschiedene Kategorien gruppieren ließen. Die Schriften der ersten Gruppe, sagte er, »sind gegen unseren Heiligsten Vater Leo X. geschrieben, weil [ich] sehen konnte, dass unsere ganze deutsche Nation in Rom nur gequält und unterdrückt wird« – aber hier schritt Karl zum ersten Mal ein und »sagte [Luther], er solle zu dieser Sache schweigen und zu den anderen [Schriften] übergehen«. Also wandte Luther sich der zweiten Kategorie zu, den »Büchern, die er (wie er sagte) aus Verärgerung über seine Kritiker geschrieben hatte«, während »die dritte Kategorie von Büchern von den Evangelien handelte«. Luther erklärte, »er wolle nicht ein einziges Wort zurücknehmen, das er geschrieben hatte … es sei denn, man bewiese ihm in einer öffentlichen Disputation unter Berufung allein auf das Alte und das Neue Testament, dass er geirrt habe«; und er schloss, »indem er den Kaiser bat und dazu anhielt, dass er nicht versuchen solle, die Verbreitung seiner Lehren aufzuhalten, weil dies nicht nur der hochberühmten deutschen Nation erheblichen Schaden antun mochte, sondern auch seinen anderen Königreichen und Herrschaftsgebieten«.61
Da Karl hierzu nichts sagte, erinnerte Eck Luther daran, »dass es sich bei allem, was er – wie er ja selbst zugegeben hatte – in seinen Schriften behauptete … um Irrlehren handle, die schon verschiedentlich und seit Langem von Konzilien als solche verdammt worden seien«, und dass »es aus diesem Grund unnütz war, etwas zu diskutieren, das bereits diskutiert, für verwerflich befunden und von der Kirche offiziell verurteilt worden war, was in heiligen Dekreten und trefflichen Beschlüssen zu diesen Fragen festgehalten wurde«. Deshalb müssten, gab Eck nicht ohne eine gewisse Selbstgefälligkeit zu bedenken, selbst wenn Luther die Wahrheit sprach, »wir glauben, dass unsere Vorgänger aus den vergangenen tausend Jahren allesamt Ketzer gewesen und nicht erlöst worden wären; und es wäre leichtsinnig und ein großer Fehler, zu glauben, ein einziger Mann, noch dazu ein so wenig maßgeblicher, wolle so viele gute Christen [nachträglich] verdammen«.
Als Karl wiederum schwieg, ergriff Luther die Gelegenheit, seine kühnste und berühmteste Erklärung abzugeben:
»Überzeugt mich mit den Zeugnissen der Heiligen Schrift oder mit öffentlichen, klaren und hellen Gründen, also mit den Bibelworten und Argumenten, die von mir beigebracht worden sind. Denn die Autorität von Papst und Konzilien allein überzeugt mich nicht, da sie offenkundig oft geirrt und gegen Schrift und Vernunft gestanden haben. Nur wenn mein Gewissen in Gottes Wort gefangen ist, will ich widerrufen. Denn es ist nicht geraten, etwas gegen das Gewissen zu tun. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen.«
Da erhob sich Eck abermals und »begann schon, dem zu widersprechen«, als Karl ihn unterbrach. Obwohl er nicht gut genug Deutsch konnte, um den Wortwechsel zwischen Luther und Eck zu verstehen, und obwohl ihm lateinische Texte noch immer ins Französische übersetzt werden mussten, »damit ich sie besser verstehen kann«, scheint der Kaiser doch die Bedeutsamkeit von Luthers herausfordernder Rede begriffen zu haben, denn er »stand auf und sagte ›Das genügt: Ich wünsche nichts weiter von einem zu hören, der die Autorität der Konzilien geleugnet hat!‹« Und nach diesen Worten »begab er sich nach oben in seine Gemächer, und die Kurfürsten und Fürsten begaben sich in ihre Quartiere«.62
Jetzt brach in dem großen Saal ein wahres Chaos los. »Die spanischen Stallmeister, die an den Türen auf ihre Herren warteten, riefen: ›Verbrennt ihn! Auf den Scheiterhaufen mit ihm!‹« Aber gegen Luthers deutsche Anhänger konnten sie nichts ausrichten. Diese nahmen ihren Helden zunächst schützend in die Mitte und trugen ihn dann auf ihren Schultern aus dem Saal, als hätte er gerade ein Turnier gewonnen – ein Gedanke, der anscheinend auch dem Mann der Stunde kam, denn der verließ den Schauplatz seines Triumphes, »indem er die Arme hoch erhob und mit seinen Händen und Fingern das Zeichen gab, das die deutschen Ritter zum Zeichen ihres Sieges machen, wenn sie gerade einen Tjost für sich entschieden haben« (eine Geste, der Kaiser Maximilian womöglich einen gewissen, widerwilligen Respekt gezollt hätte).63 Der triumphale Sieger verkannte seine heikle Lage jedoch nicht. Rasch reiste er aus Worms ab, bevor sein freies Geleit verfiel, und schrieb zwei Tage darauf Karl einen Brief, in dem er erklärte, er sei ja grundsätzlich bereit gewesen, zu widerrufen und sogar seine eigenen Bücher zu verbrennen – wenn man ihm denn nur überzeugend dargelegt hätte, worin er geirrt habe. Dieses Schreiben erreichte jedoch niemals seinen Adressaten, denn keiner wagte, es dem Kaiser auszuhändigen.64