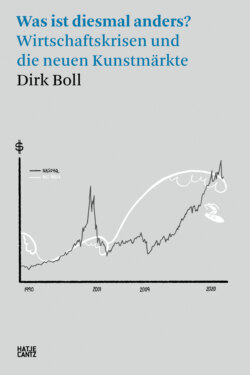Читать книгу Was ist diesmal anders? - Группа авторов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2: Die digitale Industriekrise: Das Platzen der Internetblase und die Marktabschwächung 2000/2001
Оглавление»Schau mal Dave, da drüben ist die Gagosian Gallery«
In den 1990er-Jahren sah man erste Versuche, Kunst im Internet kommerziell zu vermitteln. Diese Phase der Digitalisierung hatte stärkere Folgen auf der Nachfrageseite, denn die um die Jahrtausendwende entstehenden neuen Vermögen ermöglichen Kunstkonsum. Das Platzen der Internetblase bringt Anleger um ihre Investments, und 9/11 beendet die Wachstumsphase der Kunstmärkte.
In den späten 1990er-Jahren sprach man zum ersten Mal von den Kunstmärkten, wenn man die kommerzielle Kunstwelt meinte – ein Zeichen, dass diese Ökonomie so gewachsen war, dass man sie auch merkantil ernst nehmen konnte. Durch einen langsamen Anstieg über den Zeitraum von zehn Jahren wurden am Ende der Dekade wieder in nahezu allen Sparten die Preisregionen des vorhergehenden Booms erreicht. Als Folge des gesamtgesellschaftlich gestiegenen Interesses an zeitgenössischer Kunst übernahm diese rasch die Rolle der »Marktlokomotive«. Inzwischen waren viele lebende Künstler derart etabliert, dass sich ein Privatkäufer auch ohne die Beratung eines Galeristen sicher fühlte. Vor allem aber hatte um die Jahrtausendwende die Sekundärvermarktung das Primärangebot eingeholt. Zeitweise kamen derart viele Werke direkt aus dem Atelier auf die Auktionsbühne, dass diese zu einem Barometer für emerging art wurde: Die Zahl von Werken auf Auktionen, die jünger als drei Jahre waren, sollte sich in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts mehr als verdoppeln. Das beförderte Investment und Spekulation; der traditionelle Abstand zwischen Primär- und Sekundärmarkt war auf wenige Jahre zusammengeschmolzen. Die Auktionsäuser waren von einem Vermittler zum Interpreten geworden, deren Auswahl von auf Auktionen präsentierten Œuvres die Marktrezeption und damit die Märkte beeinflussen in der Lage ist.25
Als Reaktion auf die Grenzverschiebung zwischen Primär- und Sekundärmarkt begann sich die Schere der Galerienwelt zu öffnen. In dieser Phase spalteten sich die vier Mega-Galerien Gagosian, Hauser & Wirth, David Zwirner und Pace vom Rest der Galeristenzunft ab, nachdem sich ein signifikanter Graben im Umsatz dieser Gruppe (und Marian Goodman als Nummer Fünf) aufgetan hatte. Seither stehen zahllosen Kleinstunternehmen internationale Ketten nach dem Vorbild der Gagosian Gallery gegenüber, die auf allen Kontinenten Sammler mit Ausstellungen erreichen möchte. Dieses Netzwerk hat große Anziehungskraft vor allem bei den Produzenten der begehrten Güter: Zeitweise waren mehr als 50% aller lebenden Künstler, deren Werke auf Auktionen gehandelt wurden, bei Gagosian unter Vertrag. Aber wie schon 1989, so zeigte auch rund eine Dekade später eine große Immobilienentscheidung von Larry Gagosian, dass die Marktteilnehmer nicht auf das kommende Geschehen vorbereitet waren. Hatte er mit seiner letzten New Yorker Expansion 1990 die Verlagerung der Galerienszene von SoHo nach Chelsea eingeleitet, so zeigte seine neue Galerie die quantitative Entwicklungsrichtung an: Mit knapp 2.000 m2 bildeten diese Räume mit Abstand die größte kommerzielle Ausstellungsfläche in Chelsea – vor der sich mancher Kunstschaffender geradezu fürchtete.26
Wirtschaftskapitäne der Kunstwelt: Francois Pinault
Francois Pinault war vielleicht der erste Unternehmer, der Öffentlichkeitswirkung und Flair eines Kunstmarktunternehmens für die Wahrnehmung und Kommunikation seiner Unternehmensgruppe ebenso wie seiner privaten Sammeltätigkeit erkannte. Sein 1963 gegründetes Holzhandelsunternehmen war die Keimzelle eines der größten Luxusgüterkonzerne der Welt. Über viele Jahre erweiterte die Dachgesellschaft Pinault-Printemps-Redoute (PPR, seit 2013 Kering) ihr Portfolio auf dem Markt der Luxusanbieter und -hersteller. Im 21. Jahrhundert gehören dazu unter anderem der Pariser Modehersteller Yves Saint Laurent, der US-amerikanische Kofferproduzent Samsonite, das Weingut Château Latour, das Florentiner Modelabel Gucci oder die Uhrenmanufaktur Girard Perregaux.27
Pinault hatte als Erster erkannt, dass sich Luxusfirmen aus verschieden Bereichen häufig um identische Kunden bemühen – wer das Geld und den Geschmack hat, sich bei Yves Saint Laurent einzukleiden, kauft mit hoher Wahrscheinlichkeit auch teure Uhren oder eben Kunst. Dies führte 1998 zu seiner Akquisition von Christie’s, seit 1996 das größte auf dem Kunstmarkt tätige Unternehmen. Tradition, Image und Potential der Marke sowie umfangreicher Immobilienbesitz in St. James’s und in South Kensington, teuren und gefragten Londoner Lagen, machten die Firma zu einer kostspieligen Anschaffung: Pinault zahlte dafür insgesamt 721 Millionen Pfund. Er verwandelte die Firma wieder in ein Privatunternehmen.28
Hinter diesem Investment stehe ein »obsessive collector«, so die Londoner Kunstberaterin Wendy Goldsmith – der Wert seiner Sammlung wird in Medienberichten auf über eine Milliarde Dollar beziffert. War für Alfred Taubman noch der Kauf des Unternehmens Sotheby’s Mittel zu gesellschaftlicher Anerkennung, so geht Pinault den umgekehrten Schritt und teilt seinen Kunstbesitz mit der Öffentlichkeit: 2000 gründete er die Fondation Pinault, welche seine Privatsammlung in drei eigenen Museen in Paris und Venedig zeigt.29
Das Jahrzehnt endete mit zwei Paukenschlägen: 1999 kündigte Sotheby’s einen überraschendenden Einstieg ins Internetgeschäft an, und Christopher Davidge, damaliger CEO von Christie’s, erstattete Selbstanzeige. Er gab an, mit Sotheby’s, dem wichtigsten Wettbewerber seines Unternehmens, die Preise für Dienstleistungen abgesprochen zu haben. Für die Firmen hatte das folgende Gerichtsverfahren weitreichende Folgen: Beide Unternehmen wurden zu Schadenersatzzahlungen verurteilt, die beteiligten CEOs und Chairmen traten von ihren Ämtern zurück. Die Delikatesse der Affäre hatte zudem ein extensives Presseecho zur Folge; unter dem Motto »Steigt der Preis, sinkt die Moral« wurde amerikanisches Wirtschaftsstrafrecht sogar für europäische Boulevardzeitungen als Thema attraktiv.30
Geheime Absprachen
Wer als Monopolist einen Markt beherrscht, ist in der Lage, dem Nachfrager auf diesem Markt die Geschäftsbedingungen zu diktieren. Gibt es nicht einen Monopolisten, sondern zwei Unternehmen, die konkurrieren, aber zusammengenommen den Markt dominieren, handelt es sich um ein Duopol, das nach Erkennen der Entscheidungsdependenz durch Abstimmung der Aktionen und Preise zum Monopol werden kann.31
Geheime Abstimmungen der Aktionen und Preise sind nach US-Recht als Einschränkung des freien Wettbewerbs untersagt; der »Shermans Antitrust Act« von 1890 kleidet das Verbot in sehr allgemeine Formulierungen. Durch den hohen Wert, der die Wettbewerbsfreiheit in der amerikanischen Verfassung genießt, ist diese offene Art der Formulierung Basis für zahlreiche Einzelvorschriften, durch die das Delikt der Monopolbildung mit hohen Strafen für die beteiligten Unternehmen wie auch die ausführenden Mitarbeiter bedroht wird.32
In seiner Selbstanzeige erklärte Christopher Davidge, seit den frühen 1990er-Jahren die Kommissionen seines Unternehmens mit dem Wettbewerber abgesprochen zu haben. In Anbetracht des gemeinsamen Marktanteiles der Häuser war dieses Eingeständnis von kartellrechtlicher Relevanz. Die extreme Rivalität der beiden Firmen – »the culture is to hate your rival« – war nur noch eine äußerliche. Durch die Selbstanzeige und die Zusicherung, bei der Aufklärung des Vorgangs der Staatsanwaltschaft behilflich zu sein, konnte Christie’s allerdings für seine Mitarbeiter eine Strafverschonung erwirken – das amerikanische Rechtssystem belohnt diejenige Partei, die das Kartell bricht und zur Anzeige bringt.33
Wie die Untersuchungen ergaben, hatten Davidge und die Sotheby’s CEO Diana D. »Dede« Brooks seit 1992 die Höhe der Verkäuferkommission, ab 1995 auch die des Käuferaufgelds miteinander abgestimmt. Brooks und Alfred Taubman, Mehrheitsaktionär und Chairman von Sotheby’s, wurden persönlich angeklagt; erstere versuchte im Laufe des Verfahrens vergeblich, sich als Werkzeug Taubmans darzustellen. Aber auch Taubmans Version, Brooks habe ohne sein Einverständnis, ja ohne sein Wissen gehandelt, wurde vom Gericht nicht angenommen. Das Gericht verurteilte Taubman zu einer Gefängnisstrafe, Brooks zu Hausarrest und die beiden Unternehmen zu millionenschweren Schadenersatzzahlungen. Begünstigte waren alle Kunden, die in diesen Jahren bei einem der Unternehmen etwas ge- oder verkauft hatten.