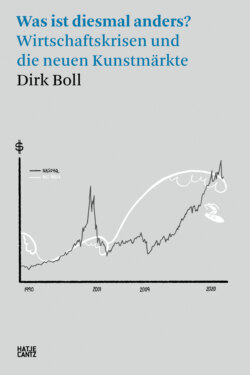Читать книгу Was ist diesmal anders? - Группа авторов - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2.2 Eine Jahrhundertauktion in Paris
ОглавлениеNachlässe sind wahre Wasserstandsmelder der Kunstmärkte. In allen Staaten, deren Bewohner Erbschaftsteuer entrichten müssen, treibt diese Nachlassgegenstände geradezu auf den Markt – vor allem in den USA, wo die Erbschaftssteuer neun Monate nach dem Erbfall entrichtet werden muss. Die Versteigerung von Kunstgegenständen bietet den Erben eine vergleichsweise einfache Möglichkeit, für die notwendigen Barmittel zu sorgen; zudem kann ein Verkauf auch Nachlassprobleme wie Überschuldung lösen oder bei der Realteilung helfen. Diese Verkäufe werden nicht von Krise oder Boom ausgelöst, sondern von Kunstmarktunabhängigen Anlässen, und berühren regelmäßig eine große Bandbreite von Werten. Nachlassauktionen sind daher sehr viel aussagekräftiger als gezielte Einzelverkäufe.
Eine zeitliche Nähe zum Tod der Nachlassenden kann ferner den Aspekt der Provenienz verstärken. Für Memorabilien, die an die Verstorbenen erinnern, empfiehlt sich der Verkauf an Abnehmer, die die Verstorbenen gekannt haben und verehren; schon eine Generation später kann der zusätzliche Wert eines berühmten Vorbesitzes reduziert sein. Die Beispiele sind zahlreich, von großen Sammlerdynastien wie europäischen Königshäusern oder den Zweigen der Familie Rothschild über Unternehmerpersönlichkeiten bis hin zu Film- oder Popstars. In aller Regel lassen sich zwei Kategorien identifizieren: Entweder waren die Verstorbenen für ihre Sammlungen berühmt und diese entsprechend von hoher künstlerischer Qualität, oder der Memorabiliengedanke überwog und hat Objekte verkäuflich gemacht, die aus anderem Vorbesitz nie ihren Weg auf die Kunstmärkte gefunden hätten.
Die Versteigerung des Nachlasses des französischen Modeschöpfers Yves Saint Laurent (»YSL«) war eine bemerkenswerte Ausnahme dieser Regel, denn hier kam beides zusammen: Einerseits zeigte das Leben und das Werk Saint Laurents alle Anzeichen großer Starqualität, andererseits waren die Sammlungsobjekte von hoher, teilweise höchster Qualität. YSL war schon zu Lebzeiten durch seine Arbeit, aber auch durch deren Darstellung in Literatur, Film – sogar in Fernsehfilmen – zu einer Ikone der Kreativität und des guten Geschmacks stilisiert worden. Der Schweizer AKRIS-Chefdesigner Albert Kriemler erinnerte sich: »Yves Saint Laurent prägte die Mode in dieser Zeit wie niemand anderes.«89
Als sensibler, kulturaffiner Mensch hatte YSL bereits in jungen Jahren begonnen, Kunst zu sammeln. Er war der Prototyp des Trendsetters: Er sammelte, was ihn ansprach, und liess sich von seinen Kunstwerken inspirieren. Als die Sammlung nach seinem Tod in Paris versteigert wurde, offenbarte sich die Unabhängigkeit seines exquisiten Geschmacks einem breiten Publikum. Er kaufte immer gegen die Mode – die er nur auf dem Laufsteg beeinflusste, nicht auf den Kunstmärkten: Die Sammlung des scheuen, zurückgezogen lebenden Modeschöpfers war nur wenigen Eingeweihten bekannt.
Wohlbekannt hingegen waren die Kreationen, zu denen die Werke seiner Kunstsammlung YSL inspiriert hatten. »Viele Bilder in dieser Sammlung hat Yves Saint Laurent (…) als lesbare Inspiration in seine Kollektionen übernommen,« stellte Albert Kriemler fest, am sichtbarsten vielleicht in der berühmten Mondrian-Kollektion von 1965.90
Es war Pierre Bergé, Lebenspartner und Mitsammler sowie letztlich Erbe von Yves Saint Laurent, der auf dem Höhepunkt der Krise darauf bestand, die Auktion der gemeinsamen Sammlung im Frühjahr 2009 in Paris durchführen zu lassen. Er hatte dafür Christie’s ausgewählt, wo man sich gegen eine »zu frühe« Terminierung der Auktionsserie ausgesprochen hatte, erinnert sich sein Kurator Alain Tarica. Eigentlich hätte auch New York der richtige Marktplatz für eine solche Sammlungsauktion sein können, nicht das kommerziell weniger bedeutende Paris, wo Bergé die Medienaufmerksamkeit auch für sein eigenes Auktionsunternehmen Piere Bergé & Associes nutzen wollte. Der Kunde setzte sich durch, nicht zuletzt auch, um die Auktion und deren Vorbesichtigung im Grand Palais zu einer nationalen Gedenkfeier für den großen Couturier werden zu lassen. Stundenlang standen Interessenten Schlange, um das nachgebaute Apartment zu sehen, das maßstabsgerecht vergrößert worden war, um den Durchfluss von Besuchern zu erhöhen: Am Ende sollte die Vorbesichtigung 30.000 Besucher zählen.91
Marktplatz Paris
Nicht nur die Geburtsstätte der Moderne, sondern auch ihrer kommerziellen Vermittlung: In der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Paris für Jahrzehnte das Zentrum des internationalen Kunstmarktes. Die Einführung des Folgerechts 1920, die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg, vor allem aber die Einschränkungen des altertümlichen französischen Auktionsrechts haben diese Vormachtstellung beendet.92
Die Vorschriften zum Abhalten von Auktionen entstammten einem Edikt Heinrichs II. von 1552. Versteigern durften nur die Inhaber einer staatlichen Lizenz, die sogenannten Commissaires-Priseurs. Diese Lizenzen wurden nur an natürliche Personen vergeben, und zwar nur an Franzosen. Als Auktionsplätze waren ausschließlich die Räumlichkeiten des Hôtel Drouot zulässig, der Zentrale des Verbandes der Commissaires-Priseurs. Aus diesen Gründen waren internationale Auktionshäuser in Frankreich nur durch Repräsentanzen vertreten, welche die akquirierte Ware ins Ausland versandten. Es war offensichtlich, dass die französischen Versteigerungsregelungen gegen europäisches Recht verstießen; vor allem die im Vertrag von Rom geregelte Dienstleistungsfreiheit war behindert. Nach einem langjährigen Harmonisierungsprozess trat im Jahr 2001 ein neues Auktionsgesetz in Kraft. Seither werden Versteigerungen nicht mehr von den staatlich vereidigten Urkundsbeamten, sondern von Handelsgesellschaften durchgeführt.93
Die Marktöffnung wurde speziell von den internationalen Häusern mit Spannung erwartet. Die einheimischen Commisaires-Priseurs hatten ihre Unternehmen in Handelsgesellschaften umgewandelt, und konnten sich entgegen früherer Befürchtungen sehr gut gegen die neue, internationale Konkurrenz behaupten – hier halfen vor allem auch die mitunter seit Generationen geknüpften Kontakte. Nicht zuletzt spielt der Nationalstolz der Klientel eine Rolle – viele Franzosen scheuten sich davor, bei ausländischen Unternehmen Kunst einzuliefern. Von letzteren wurde Christie’s immerhin noch als das am ehesten französische angesehen, gehört es doch seit 1997 zum Luxusimperium François Pinaults.
Der Yves Saint Laurent Nachlass half, dieses Ansehen dank der »Jahrhundertauktion« zu unterfüttern. 2009 entfielen von einem globalen Auktionsmarkt von 12,9 Milliarden Euro lediglich 2,47 Milliarden Euro (=19%) auf Frankreich, wovon die Yves Saint Laurent Auktion fast ein Fünftel repräsentiert.94
Der Yves Saint Laurent Nachlass spiegelte die große Bandbreite des Interesses wider, mit der der Modeschöpfer gesammelt hatte. Angeboten wurden Meisterwerke der Malereigeschichte, von Goya zu Picasso, von Burne-Jones zu Cézanne. Hinzu kamen Skulpturen von Brancusi oder Minne, mittelalterliche Silber- und Goldschmiedearbeiten, Lack- und Ebenistenarbeiten des Art Deco, und zahlreiche Werke des Designerpaars Claude und François-Xavier Lalanne, sowie die beiden inspirierenden Mondrian-Gemälde. Insgesamt wurden 377 Lose ausgewählt, um im Februar 2009 versteigert zu werden. Pierre Bergé hatte lediglich eine afrikanische Senufo-Skulptur, die erste gemeinsame Erwerbung des Paares, sowie das Warhol-Portrait von Yves Saint Laurent zurückbehalten.95
Die Versteigerung im größten Auktionsaal der Welt wurde ein rauschender Erfolg, die Sammlung von Yves Saint Laurent und Pierre Bergé war, mit einem Gesamtumsatz in Höhe von 374 Millionen Euro, die teuerste, die je verkauft worden war.96
Brunnenfiguren alspolitische Instrumente
Die YSL-Auktion war noch aus einem weiteren Grund für die Kunstmärkte von Bedeutung. In der Sammlung befanden sich zwei Brunnenköpfe in Form eines Hasen- bzw. eines Rattenkopfes. Diese stammten aus dem Garten von Yuan Ming Yuan, dem Sommerpalast der Qing-Dynastie vor den Toren Pekings, und waren ursprünglich Teil einer Wasseruhr: Von dem jesuitischen Missionar und Hofkünstler Guiseppe Castiglione für Kaiser Qianlong entworfen, repräsentierten zwölf Brunnenköpfe in Tierform die chinesischen Sternzeichen und zeigten durch Wasserspiele die Zeit an. 1860 waren die Palastanlagen im zweiten Opiumkrieg von den anglo-französischen Alliierten geplündert und zerstört, Tausende von Kunstwerken geraubt und nach Europa verbracht worden. In den 1980er-Jahren wurde das Gelände von der chinesischen Staatsregierung zur Stätte des kulturellen Erbes erklärt; in der Folge die Zerstörung des Palastes immer stärker als »nationale Schande« gewertet. Seit den 1990er-Jahren werden regelmäßig einzelne Objekte dieser Provenienz, wenn sie auf westlichen Kunstmärkten erscheinen, von Individuen erworben und dem chinesischen Staat zum Geschenk angeboten. Hierzu gehören auch diejenigen Brunnenfiguren, die 1989 bei Sotheby’s in London angeboten wurden und sich heute im Poly Art Museum bzw. im Capital Museum in Beijing befinden (Ochse und Tiger bzw. Pferd); der Affenkopf, 2000 von Christie’s in Hongkong versteigert und ebenfalls ins Poly Art Museum verbracht wurde; sowie der Kopf des Schweins, der bereits 1987 vom Poly Art Museum privat angekauft worden war. Die beiden Tierköpfe aus der Yves Saint Laurent Sammlung waren Nummer sechs und sieben, die in der Öffentlichkeit auftauchten; die übrigen fünf sind bislang verschollen und nur durch historische Kopien überliefert. Der chinesische Künstler Ai Weiwei hatte 2010 schließlich Nachschöpfungen der Brunnenköpfe zu seiner Bronzeskulptur »Circle of Animals/Zodiac Heads« verarbeitet.97
Auf die Bekanntgabe der Versteigerung der Brunnenköpfe aus dem YSL-Nachlass folgte ein öffentlicher Aufschrei in China; die State Administration of Cultural Heritage (SACH) verurteilte die Auktion medienwirksam und warnte Christie’s in einem offenen Brief, eine Durchführung der Versteigerung werde ernstzunehmende Konsequenzen für die Geschäftsinteressen von Christie’s in China haben. Unmittelbar vor der Auktion verklagte die Association for the Protection of Chinese Art in Europe (APACE) Christie’s in Paris auf Absage der Auktion der Brunnenköpfe und deren Herausgabe; diese Klage wurde vom Gericht zwei Tage vor der Auktion abgewiesen. Pierre Bergé und Christie’s entscheiden sich für eine Versteigerung der Tierköpfe, da die Eigentumsfrage zweifelsfrei war und diverse andere Brunnenköpfe in der Vergangenheit öffentlich auktioniert worden waren.98
Die beiden Brunnenköpfe wurden in der Abendauktion des YSL Nachlasses am 25. Februar 2009 mit einer Schätzung von 16 bis 20 Millionen Euro angeboten. Nach einem Bieterwettkampf wurden beide Köpfe für insgesamt 31 Millionen Euro Cai Mingchao zugeschlagen, der als Berater des chinesischen National Treasures Fund agierte. Cai war Eigentümer eines chinesischen Auktionshauses und bereits als Käufer hochpreisiger chinesischer Kunstwerke in Hongkong aufgetreten; er wurde als vertrauenswürdig eingestuft. Auktionshaus wie Einlieferer gingen offenbar davon aus, dass staatliche chinesische Stellen sich für einen Ankauf entschlossen hatten.99
Unmittelbar nach der Auktion erklärte der siegreiche Bieter, dass seine Teilnahme an der Auktion nur den Zweck gehabt habe, die Weltöffentlichkeit auf den Verkauf der Tierskulpturen aufmerksam zu machen, und dass er aus moralischen und patriotischen Gründen den Kaufpreis nicht bezahlen werde. Als Reaktion darauf ließ Pierre Bergé vermelden, er würde die beiden Skulpturen mit Vergnügen zurücknehmen, oder sie China schenken, falls die dortige Regierung Tibet in die Selbstverwaltung entlassen würde. Zwei Tage später erließ die chinesische Regierung strengere Importregeln gegen das Auktionshaus. Christie’s versteigerte seit den 1980er-Jahren in Hongkong, musste jedoch in Mainland China in einer Verbindung mit einem lokalen Partner arbeiten, dem chinesischen Auktionshaus Forever – im Grunde eine Brand Franchise Situation, ähnlich wie in vielen anderen Industrien. Wie konkurrierende Auktionshäuser auch, tourte Christie’s regelmäßig Objekte aus Londoner oder New Yorker Versteigerungen nach Mainland China, um sie dort potentiellen Bietern im Original präsentieren zu können. Diese temporären Importe würden nun sehr viel genauer überprüft, kündigte die chinesische State Administration of Cultural Heritage an.100
Die Auflösung ließ vier Jahre auf sich warten. Im April 2013 erklärte Francois-Henri Pinault, CEO der Kering Gruppe, der Eigentümerin von Christie’s, er habe die Brunnenköpfe für eine unpublizierte Summe von Pierre Bergé erworben. Gemeinsam mit dem französischen Staatspräsidenten Francois Hollande bot Pinault die Skulpturen dem chinesischen Staat zum Geschenk an. In einer weithin publizierten Zeremonie im Nationalmuseum am Tiananmen-Platz wurden sie am 28. Juni 2013 feierlich übergeben.101
So sehr dieser Akt der Repatriierung der Figuren begrüßt wurde, blieben doch die kommerziellen Verbindungen unübersehbar. In einem öffentlichen Statement erklärte Kering, dass man rund 10% des globalen Geschäfts in oder mit China machen würde, mithin einem der wichtigsten Absatzmärkte überhaupt für die Marken der Gruppe. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die chinesische Staatsregierung Christie’s eine alleinige Handelslizenz verliehen hatte. Damit konnte das Haus ohne regionale Partnerschaft eine eigenständige 100% Tochter in Mainland China gründen, die seit 2013 die Auktionen in Shanghai durchführt: Die erste und bislang einzige Lizenz für ein ausländisches Kunstmarktunternehmen auf dem chinesischen Festland.102
Der Erfolg dieser Auktion stand in frappierendem Gegensatz zu den Entwicklungen der Finanzmärkte. Nach dem Einbruch 2008 hatte es insgesamt fünf Erholungsphasen gegeben, in denen die DAX-Werte wieder stiegen – teilweise substanziell: Die stärkste Bärenmarktrallye zeigte einen Zuwachs von 40%. Beinahe gleichzeitig mit dem Auftrieb im Pariser Grand Palais sahen die Märkte ihr endgültiges Tief. Im Jahr der Krise hatte die globale Wirtschaftsleistung um rund 6% nachgegeben.103
Zur YSL-Auktion waren die wichtigsten Sammlerinnen und Sammler auf die Kunstmärkte zurückgekehrt und zahlten Rekordpreise für Werke höchster Qualität. Auffällig war zudem die hohe Beteiligung von Kunsthändlern, die durch ihre Anwesenheit im Auktionssaal öffentlich war. Trotz der Wirtschaftskrise wurden Werke dieser Sammlung vielfach überboten, einige vervielfachten ihre Vorabschätzungen. Dies hat eine gewisse Tradition, denn zahlreiche Rekorde waren in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gebrochen worden – die Kunstmärkte werden jedoch maßgeblich von der Qualität des Angebots bestimmt, und hier war die YSL-Sammlung ein Meilenstein der Marktgeschichte. Das allgemein hohe Preisniveau erneuerte das Vertrauen der Öffentlichkeit in den dauerhaften Wert von Kunst der höchsten Qualität, und auch in die Zuverlässigkeit der Distributionssysteme und Akteure.104