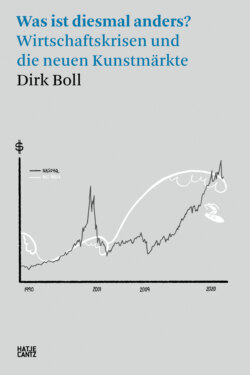Читать книгу Was ist diesmal anders? - Группа авторов - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3 Mühevoller Neubeginn
ОглавлениеDie Folgen des Platzens der Internetblase erreichten die Kunstmärkte mit Verspätung; niedrige Zinsen machten Kunstwerke zu attraktiven Alternativanlangen und für Christie’s war 2000 sogar das umsatzstärkste Jahr der Unternehmensgeschichte. Aber es war die Ruhe vor dem Sturm. Die beiden großen Häuser waren inmitten des Prozesses um ihre illegalen Absprachen, der die Unternehmen jeweils 256 Millionen Dollar an Schadensersatzzahlungen allein in den USA kosten sollte, vor allem aber das Vertrauen der Kunden in die Integrität der Unternehmen in hohem Maße beeinträchtigte: Zahlreiche Privatklagen von empörten Kunden folgten dem kartellrechtlichen Verfahren.53 Durch den zuweilen langen Vorlauf von Auktionseinlieferungen schlugen sich diese Umstände mehrheitlich erst in 2001 im Geschäftsvolumen der beiden Unternehmen nieder; vor allem der Anteil an großen Sammlungen und wichtigen Einzellosen war signifikant dezimiert.54
Der Kunsthandel des Sekundärmarktes konnte zeitweilig von einer Stimmung gegen die Auktionshäuser profitierten.55 Der Skandal um die beiden Großunternehmen hatte für diese einen nivellierenden Effekt. War es vorher so, dass mal der eine, mal der andere einen Fehler gemacht hatte, und die Nachfragenden aus den verschiedensten Gründen einen Anbieter bevorzugten, so waren nun beide Häuser gleich belastet, durch genau die gleichen illegalen Handlungen. Dies bedeutete einen Neustart und war ein wichtiger Grund, dass traditionelle, zuweilen Generationen überspannende Loyalitäten von einem Wettbewerbsgedanken abgelöst wurden. An der Marktspitze wurde es deutlich kompetitiver, mit entsprechendem Druck auf die Margen der Anbieter. Alle Marktteilnehmer mussten mit der Situation umgehen, dass ab 9/11 die Umsätze vor allem im obersten Wertsegment wegbrachen.
In der Folge kam es zur Neuaufstellung auf allen Ebenen. Die wirtschaftliche Konzentration führte zu Zusammenschlüssen von kleineren Auktionshäusern zu gemeinsamen Plattformen wie den International Auctioneers (IA).56 Vor allem aber wurden größere Unternehmen restrukturiert, um das Geschäft in krisenresistenteren Bereiche zu auszubauen. Dies war insbesondere der sogenannte Mittelmarkt, auf dem Ware zwischen 10.000 Dollar bis 100.000 Dollar umgesetzt wird. Dieser Markt wurde von zahllosen Firmen bedient, welche sich vor allem in wirtschaftlich bedeutenden europäischen Zentren befinden, deren Kundenzugang aber selten über die Region oder Nation hinausreichte. Mit Internetbasierten Aggregatorenplattformen wie Invaluable hatten diese Firmen erstmals die Gelegenheit, ein breiteres Publikum zu erreichen und von der Digitalisierung der Kommunikation zu profitieren.
In London waren es allen voran Christie’s mit seiner Filiale in South Kensington, Bonhams und Phillips, die in den Wertbereichen des Mittelmarktes solide Kommissionen erwirtschafteten. Mit einem Befreiungsschlag plante Sotheby’s, der Enge des Hauptquartiers in Mayfair zu entfliehen und ein neues Mittelmarktzentrum unter einheitlichem Dach zu etablieren. Zunächst wurden Pläne zur Errichtung eines neuen Sotheby’s-Auktionshauses nahe des Großflughafens Heathrow verkündet, in dem man frei von Platzmangel Ware aller Art günstiger absetzen können würde als in der Innenstadt. Daraus wurde später ein neu zu bauendes, modernes Auktionszentrum in der Londoner City, welches die Auktionen der oberen Kategorien wie auch die des Mittelmarktes aufnehmen sollte. Keiner dieser Pläne wurde realisiert, stattdessen eröffnete man im Sommer 2001 eine Junior-Filiale auf dem Messegelände Olympia im Londoner Westen, Heimat der traditionsreichen Antiques & Fine Arts Fair.57
Vergleichbare Überlegungen tätigte man bei Christie’s. Unter Kostensenkungsdruck wurde zunächst in der Sommerpause 2001 der New Yorker Mittelmarkt-Ableger Christie’s East nach Manhattan verlegt und mit der Hauptniederlassung im Rockefeller Center vereinigt. Eine solche Fusion der Standorte wurde auch für London diskutiert. Im Gebäudekomplex an der King Street verfügte das Unternehmen allerdings nicht über ausreichende Platzreserven. Es wurde daher die Aufgabe der traditionellen Standorte in der King Street und in South Kensington sowie eine Zusammenlegung der beiden Sparten an einem neuen, dritten Ort ins Auge gefasst. Die Wahl fiel auf ein spätklassizistisches Stadtpalais direkt an der Themse und somit nur unweit vom bisherigen Hauptsitz entfernt, das Somerset House. Das Gebäude hatte sich in den vorhergehenden Jahren bereits zu einem Kunstzentrum gewandelt und bietet auch der berühmten Courtauld-Sammlung und dem dazugehörigen kunstwissenschaftlichen Institut Raum. Außerdem wurden im Somerset House die Gilbert Collection und Sammlungsbestände des Heritage Museums gezeigt. Aber auch hier dürfte die von den Schadensersatzzahlungen des Kartellprozesses betroffene finanzielle Basis des Unternehmens zur stillschweigenden Aufgabe der ambitionierten Pläne geführt haben.58
Einen gänzlich entgegengesetzten Weg wählten Phillips und Bonhams, beide an sich klassische Anbieter des Mittelmarktes. Bonhams, gegründet 1793 und seither in Familienbesitz, musste erkennen, dass ein unabhängiges Überleben in Krisenzeiten schwieriger sicherzustellen sei und suchte nach einem Partner. Diverse Londoner Kunsthändler und sogar der Komponist Sir Andrew Lloyd-Webber wurden als künftige Eigentümer genannt. Der Fusionspartner war dann allerdings Robert Brooks, der aus einem Handel für Sammlerfahrzeuge seit 1989 eines der führenden Auktionshäuser im Automobilbereich entwickelt hatte. Durch den Zusammenschluss entstand 2000 das nunmehr viertgrößte Auktionshaus Bonhams & Brooks. Dieser Zustand währte nicht lange: Im Juli 2001 verständigten sich Phillips und Bonhams & Brooks über einen Zusammenschluss. Die neue Firma Bonhams bestand zu 50,1% aus Bonhams & Brooks, zu 49,9% aus den kleineren Abteilungen von Phillips, welche zu diesem Zeitpunkt LVMH gehörten. Die neuentstandene Firma Bonhams nahm ihren Sitz in den ehemaligen Bond-Street-Räumlichkeiten von Phillips, welches sich 2001 komplett aus London zurückzog. Im Folgejahr übernahm Bonhams zur Arrondierung seiner Marktposition mit Butterfields in San Francisco und Los Angeles eines der renommiertesten US-amerikanischen Versteigerungsunternehmen.59
Das neue Phillips, das angetreten war, von New York aus die Marktspitze zu erobern und auf Augenhöhe mit den beiden Multis zu agieren, tat sich schwerer als gedacht. Die alte Konkurrenz war weniger geschwächt als erwartet; mit strikten Verhaltens- und Verfahrensvorschriften, rigoroser Management-Kontrolle und neuen, unbelasteten CEO’s an der Spitze war der Skandal rasch vergessen. Vor allem waren Expansion und Garantievergabe teuer, vielleicht zu teuer für diese einkommensschwache Marktphase. Der Höhepunkt war erreicht, als Phillips im November 2001 in New York die Sammlungen Hoener und Smooke versteigerte und mit über 100 Millionen Dollar einen Umsatz auf dem Niveau der Konkurrenten erreichte. Dies wurde allerdings wohl über Verluste durch überbewertete Hausgarantien bezahlt; der kommerzielle Tiefpunkt war die Impressionisten- und Moderne-Auktion ein Jahr später, in welcher lediglich 16% der angebotenen Lose verkauft werden konnten.60 Nach 18 Monaten seiner unternehmerischen Tätigkeit wurde Bernard Arnault vorgerechnet, dass er mehr Geld an garantierten Einlieferungen verloren wie ursprünglich für das gesamte Unternehmen bezahlt hatte.61
Dies leitete das Ende von Arnaults Kunstmarktaktivitäten ein. Vor dem Hintergrund fallender Börsenkurse der LVMH-Gruppe und aufgrund der aufgelaufenen Verluste von Phillips stimmte Arnault unter dem Druck von Management und Anlegervertretern 2002 zu, dass LVMH die Beteiligungen an Phillips wieder reduzierte – der Aktienkurs von LVMH war von einem Allzeithoch von 183,70 Euro im Juli 1988 auf 48,88 Euro im Dezember 2001 gefallen. Der Hauptanteil des Unternehmens Phillips wurde von Simon de Pury und Daniella Luxemburg übernommen, nur 27,5% der Anteile verblieben bei LVMH. Der Rückzug auf diese Sperrminorität sollte anderen Investoren den Zugang zum Unternehmen eröffnen. Lediglich die Beteiligung an Bonhams wurde von LVMH behalten, ebenso verblieben die Verluste, welche Phillips in der Zeit des Engagements von Arnault eingefahren hatte und die in den Medien auf 150 bis 180 Millionen Dollar geschätzt wurden, bei LVMH.62
De Pury und Luxembourg hatten die Vorstellung, sich mit dem nun schuldenfreien Unternehmen dank flacher Strukturen und geringer Kosten an der Marktspitze halten zu können. Die veränderte finanzielle Situation sowie die generelle Ungewissheit führten jedoch zu einem spürbaren Rückgang an Einlieferungen, sodass Phillips im Frühjahr 2002 seine New Yorker Auktionen absagen musste. Auch Phillips musste erkennen, dass eine Konzentration auf diesen Bereich eine größere Abhängigkeit von Marktschwankungen mit sich bringt. Man versuchte, diese Lücke durch eine Sommerauktion in London zu schließen – da sich das Unternehmen jedoch nach der Fusion der kleineren Abteilungen mit Bonhams aus London zurückgezogen hatte, verfügte man weder über Räumlichkeiten noch eine gültige Auktionslizenz. Gewohnt innovativ machten die Betreiber des Unternehmens hieraus einen Vorteil, und Simon de Pury auktionierte im eleganten Ballsaal des Londoner Luxushotels Claridge’s.63
Für den Standort London hatten diese Entwicklungen weitreichende Folgen. Bis anhin hatte das auch räumlich dichte Netzwerk von Auktionshäusern und Galerien im Viertel St. James’s nicht nur das Flair dieses Kunstmarktes ausgemacht, sondern allen Mitgliedern dieser Szene geholfen – Konkurrenz belebt eben das Geschäft. In der Krise 2001 waren jedoch immer weniger Händler bereit und in der Lage, die durch die massive Ansiedlung internationaler Modeunternehmen dramatisch gestiegenen Mieten dieses Viertels zu zahlen. Der Kunsthandel stellte sich dem eingetrübten ökonomischen Ausblick und der nach dem 11. September 2001 gesunkenen Reiselust der Sammlerschaft auf vielerlei Art und Weise. Für die Europäer war ein probates Mittel die Ausweitung des Netzwerks in Richtung USA. Eine Reihe Londoner Händler eröffnete in den folgenden 12 bis 18 Monaten Niederlassungen in New York, etwa Frost & Reed, Nicolas Hall, Carlton Hobbs, Tony Ingrao, Richard Knight, Mellett oder The Silver Fund. Andere stärkten ihre Londoner Präsenz, vor allem im Altmeisterbereich. So übernahm der Münchner Händler Konrad Bernheimer, obgleich seit 1985 selbst in London engagiert, 2001 die alteingesessene Londoner Kunsthandlung Colnaghi. In Zusammenarbeit mit dem Kunsthändler Jean-Luc Baroni hatte Colnaghi seit 1985 als Handelsarm der (kunstsammelnden) Dr. August Oetker KG gedient. Bernheimer erkannte die Gelegenheit, neben dem traditionsreichen Markennamen auch Kundenkartei, Lager und Londoner Räumlichkeiten zu übernehmen. Er hoffte wohl auch auf einen verbesserten Zugang zum US-amerikanischen Markt, auf dem ihm vor allem der dort sehr traditionsreiche Name Colnaghi (und die für amerikanische Kunden zuständigen Mitarbeiter) hilfreich sein sollten. Im Zuge dieser Übernahme verband sich das Unternehmen mit der ebenfalls in München ansässigen Altmeisterzeichnungshändlerin Karin Bellinger und erweiterte sein Londoner Angebot.64
Zudem gab es in diesen Krisenzeiten nachhaltige Maßnahmen, die Zusammenarbeit zwischen Kunsthandel und -auktionshäusern zu verbessern, um den gemeinsamen Kunden einen Mehrwert zu bieten. Auf der Handelsseite waren dies Ausstellungen, mit denen die großen Auktionen eingerahmt wurden und die zuweilen sogar das Fehlen einer Messe zum Thema ausgleichen können, wie im Bereich der Altmeisterzeichnungen: Die großen Messen fanden in New York oder Paris statt (»Works on Paper« bzw. »Salon du Dessin«). Zum Ausgleich wurde parallel zu den Zeichnungsauktionen der großen Auktionshäuser in London 2001 eine Gemeinschaftsausstellung von 18 Händlern in den jeweiligen Verkaufsräumen etabliert, welche durch einen Gemeinschaftskatalog Dauer erhielt (»Master Drawings London«).65
Zuletzt entwickelten Handel und Auktionshäuser zahlreiche gemeinsame Projekte zur Schaffung eines neuen oder Stärkung eines bestehenden Marktsegments wie Themenverkäufe und -ausstellungen, die von beiden Parteien gemeinsam organisiert und durchgeführt werden. Bestes Beispiel hierfür war die »Asia Week«, in welcher der New Yorker Handel, die dortigen Museen und die Auktionen der großen Häuser durchgängig seit 1996 asiatische Kunst in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stellen. Der große Erfolg zog seit 1999 eine entsprechende Veranstaltung in London nach sich, 2001 folgte Paris mit dem »Salon Internationale d’Art Asiatique«.66