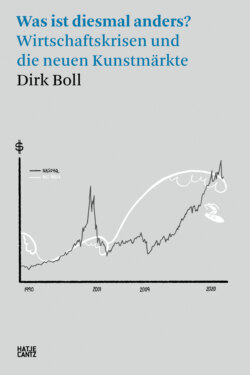Читать книгу Was ist diesmal anders? - Группа авторов - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.1 Immer höher und weiter
ОглавлениеIn diese Konzeption von Kunstsammeln und -konsum passende Werke wurden im anglo-amerikanischen Kulturkreis als »Trophy-Pictures« bezeichnet: Messen und Auktionen, wurden von sogenannten Meisterwerken dominiert. Für deren Preise gab es kaum Grenzen, Schätzungen wie historische Rekorde wurden regelmäßig übertroffen. Aktiv wurde eine globale Käuferschicht, die für die Verknüpfung von Bildender Kunst mit Mode, industriell gefertigten Luxusgütern und prominenter Provenienz besonders empfänglich war und in Zeiten niedriger Zinsen Kunst als Anlagealternative erkannte.68
So erhielt Kunst einen Platz im Leben von immer mehr Menschen und verband sich mit Lifestyle. Kunst wurde in Boulevardzeitungen behandelt und Künstler erhielten den Status von Popstars.69
Mit der Popularisierung der Kunstmärkte ging ihre Ausrichtung auf Expansion einher, in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts ist das Umsatzvolumen der globalen Kunstmärkte stärker gewachsen als im gesamten 20. Jahrhundert. 2003 war das erste Jahr, in dem die Auktionswelt mit Kunst der Nachkriegszeit mehr Umsatz erwirtschaftete als mit Werken des Impressionismus und der Klassischen Moderne. Der Handel dieser zwischen 1945 und 2000 geschaffenen Werke war der Wachstumsmotor der Märkte. Das Sammelgebiet wurde nach wie vor als »zeitgenössische Kunst« bezeichnet; 2006 und 2007, den letzten beiden Jahren vor der Krise, war ihr Wert um über 300% gestiegen.70
Der Wiederaufstieg von Märkten ist in aller Regel das Echo des Kapitals der Krisengewinner, und so zeigte der Boom vor der Krise 2009 Spieler, die von der vorhergehenden Krise 2001 profitiert hatten: Die Hedgefondsmanager. So wie die Technologieunternehmer die Märkte der späten 1990er-Jahre und der Jahrtausendwende dominiert hatten, wurden Hedgefond-Millionäre zur vermutlich einflussreichsten Berufsgruppe unter den Kunstkäufern des neuen Jahrtausends. Damit kamen die Kunstmärkte in größere Nähe zu den Finanzmärkten: Über alte Abhängigkeiten hinaus waren die wichtigsten Käufer stärker vom Geldfluss abhängig als ihre Vorgänger. Kunstmarkt und Privatwirtschaft zeigten sich seit der Finanzkrise enger denn je verflochten: Selbst, wenn man (noch) nicht mit geliehenem Geld Kunst kaufte, so waren doch die meisten anderen Geschäfte kreditfinanziert und entsprechend anfällig für allfällige Entwicklungen der Finanzwelt.71
Kunsthändler Brett Gorvy, in den Krisenjahren 2008 und 2009 Leiter der Zeitgenossen-Abteilung bei Christie’s, erinnert sich an einen »particularly frothy market«. Als Höhepunkt des Booms wird eine Sotheby’s-Auktion gesehen, die mitten in der globalen Finanzkrise im September 2008 ausschließlich Werke von Damien Hirst vermittelte, welche er eigens für diesen Anlass geschaffen und unter Umgehung des Primärmarktes direkt eingeliefert hatte. Entsprechend war mit dem Eintreffen der Krise die Sorge ausgeprägt, dass die als »Fabrikkunst« gebrandmarkte Produktion von hochgradig arbeitsteiligen Großateliers die Zukunft der »röhrenden Hirsche« habe, deren Nachfrage jedweden künstlerischen Wert ausklammert und nur noch nach rein dekorativen Aspekten funktioniert.72
Es war das Jahrzehnt der Superlative: Im Jahr 2004 überschritt das erste Bild im öffentlichen Verkauf die 100-Millionen-Dollar Grenze (Picassos Garçon a la Pipe), der erste Auktionsumsatz mit Werken zeitgenössischer Kunst übertraf diese Schwelle; beide Veranstaltungen wurden von Tobias Meyer »gehämmert« – auch das Konzept des Starauktionators repräsentiert diese Periode.73
Kunstschaffende und Kunsthändler kuratierten öffentliche Auktionen: Die Grenzen zwischen den Distributionsformen verschwammen (oder wurden bewusst überschritten); und wer nicht an den Boom glauben mochte, wurde von den Versteigerungsunternehmen durch eine Mindestpreisgarantie zum Verkauf überzeugt. Die grösste Expansion dieser Jahre fand im Stammgebiet des Kunsthandels statt. Mit Privatverkäufen nutzten die Auktionshäuser ihr Wissen um Vorlieben und Sammlungslücken, um die Konsumlust auch außerhalb der Auktion bedienen zu können.
In den Jahren vor der Krise erwirtschafteten Christie’s, Sotheby’s und Phillips über ein Viertel ihrer Einkünfte durch Privatverkäufe.74
Garantieversprechen
Zu den direkten Instrumenten der Beschaffung gehört die Garantie: Bei besonders wichtigen Stücken garantieren die Auktionshäuser den Verkäufern einen Mindesterlös. Hier liegt ein Vorteil der finanzstärkeren Multis gegenüber kleineren Mitbewerbern. Gehörte die Garantie in Europa lange zu den Geheimnissen des Geschäfts, so verpflichtet das US-amerikanische Auktionsrecht jeden Versteigerer, alle Lose im Katalog zu markieren, an denen das Versteigerungsunternehmen ein finanzielles Interesse hat, also entweder selbst Eigentümer ist oder aber einen Mindestpreis garantiert hat.75 Diese Praxis hat sich, als Reaktion auf die steigende Publizität von und öffentliche Diskussion um Garantien ab Herbst 2001 bei allen Auktionen weltweit durchgesetzt.76
Für ein Auktionshaus ist die Risikoübernahme durch ein Garantieversprechen ein bedeutendes Akquiseinstrument, vor allem an der Marktspitze. Allerdings realisiert sich das Risiko beim Unternehmen, falls sich das garantierte Werk nicht oder unter dem Garantiebetrag verkauft: Erleidet das Auktionshaus bei einem Verkauf unterhalb der Garantiesumme »nur« einen finanziellen Verlust, wird ein unverkauftes Werk Eigentum des Auktionshauses und damit ein teurer Lagerposten, welcher sich für viele Jahre als unverkäuflich erweisen kann.77
In den Jahren seit der Jahrtausendwende hatte sich die Einordnung dieser Praxis geändert. Bei dem in den 1990er-Jahren den Kunstmarkt dominierenden Sammlerinnen und Sammlern Europas und Nordamerikas war eine ablehnende Haltung spürbar, man goutierte den eigenen finanziellen Einsatz des Versteigerers und den damit einhergehenden Verlust an Neutralität wie auch an Singularität des Auktionsgeschehens nicht.78 Die Idealvorstellung des Käufers von einem Auktionator war und ist die eines neutralen Vermittlers. Weiß man aber im Vorfeld, dass das Auktionshaus einen Mindestbetrag garantiert hat, wird diese Autorität des neutralen Vermittlers verwässert: Das Auktionshaus hat bis zum Erreichen der Garantiesumme quasi die Position des Eigentümers und außerdem die Informationen des Vermittlers über die schriftliche Gebotssituation. Dies ist insofern brisant, als der Bieter nicht mehr davon ausgehen kann, gegen eine zwar geheime, allerdings vom Auktionshaus und dem Eigentümer vor der Auktion vereinbarte Reserve zu bieten.
Denn eine Reserve im eigentlichen Sinne gibt es nicht mehr; das Auktionshaus kann zu jedem beliebigen Preis verkaufen, da es durch den Garantievertrag verpflichtet ist, einen Fehlbetrag zur Garantiesumme als Verlust hinzunehmen oder aber das Stück in der erfolglosen Auktion selbst zum Preis der Garantiesumme zu erwerben. Dies hat zwei Folgen: Der Bieter weiß nicht mehr, ob er noch gegen den Eigentümer (wie in einer ungarantierten Versteigerung bis zum Erreichen der Reserve) oder gegen das Auktionshaus selbst bietet. Zudem spiegelt der Zuschlagpreis nicht mehr unbedingt eine tatsächliche Marktsituation wider, sondern vielleicht nur das finanzielle Engagement des Versteigerers.
Diese Haltung der Marktteilnehmer gegenüber dem garantierten Angebot war im frühen 21. Jahrhundert stark vom Auftreten der Sammlerschaft aus den aufstrebenden Regionen beeinflusst worden. Diese sahen eine Garantie als positives Signal an, dass sich entweder das Auktionshaus oder zunehmend auch eine außenstehende dritte Partei im Vorfeld zum Kauf des Werkes verpflichtet hatten. Dies gab vor allem Marktnovizen das notwendige Vertrauen, auf hochpreisige Objekte zu bieten, und das Ansteigen der Zahl garantierter Lose in Abendauktionen reflektierte auch den wachsenden Einfluss dieser neuen Sammlerkreise auf das Marktgeschehen der höchsten Wertebene. Neben der Absicherung des Verkaufs birgt die Garantie einen weiteren Vorteil für die Verkäuferseite: Die Öffentlichkeit der Auktion sichert den Fall ab, dass die Nachfrage größer und damit der Preis höher als erwartet ausfallen – das Kernrisiko jeder privaten Transaktion.79
Für das System Auktion bleiben zwei grundlegende Probleme: In schwierigen Zeiten sind die Eigentümer von exzeptionellen Objekten weniger bereit diese dem Risiko einer Auktion auszusetzen und lassen sich oft nur durch hoch dotierte Garantien überzeugen – was wiederum dazu führt, dass aufgrund der hohen Preiserwartung für das Objekt und der tendenziell ablehnenden Haltung der Käufer gegenüber Garantien es das Werk selbst dann schwieriger hat, sich auf dem Markt zu behaupten. Wenn aber das Auktionshaus (oder ein außenstehender Dritter) das Risiko des Nichtverkaufs übernommen hat, entsteht eine verfälschte Ansicht von Nachfrage und Wertniveau der garantierten Werke.80
Es kommt eine Krise der Glaubwürdigkeit hinzu: Schätzungen, auf deren Basis dann Garantien gegeben wurden und werden, reflektieren nicht mehr den Preis, den ein vergleichbares Stück erreicht hat oder den das Expertenteam des Auktionshauses für wahrscheinlich hält, sondern vor allem die Wunschvorstellung des Eigentümers. In der Folge erhält die Einlieferung dasjenige Auktionshaus, das die Garantie zahlt, weil es diesen Preis für gerade noch im Bereich des Möglichen hält. Dies erschwerte nicht nur die Akquise ganz generell. Die Einstellung der Garantien in den Krisen 2001 und 2009 zeigte zudem, dass dieses System nicht wirtschaftlich arbeiten kann – eine Erkenntnis, die das Vertrauen den Auktionshäusern gegenüber untergräbt.81