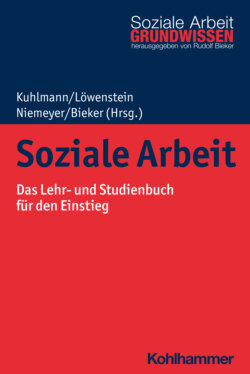Читать книгу Soziale Arbeit - Группа авторов - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sozialisation
ОглавлениеSozialisation bezeichnet im engeren Sinne den Prozess, in dem das Individuum im Laufe seines Lebens mehr und mehr lernt, sich in sozialen Situationen angemessen zu verhalten, also bestimmten Verhaltenserwartungen zu entsprechen (z. B. als Schüler*in, Konsument*in, Arbeitnehmer*in, Gast). Es lernt Werte, Normen und die in (s)einer Gesellschaft dominanten Einstellungen, Regeln und Sichtweisen kennen. Erfolgreiche Sozialisation führt einerseits zu einer Übernahme gesellschaftlicher Erwartungen und Denkweisen (Aneignung), andererseits befähigt sie das Individuum, sich in einem bestimmten Rahmen, z. B. ohne andere Menschen zu schädigen, von gesellschaftlichen Normalitätsstandards zu distanzieren (Grendel 2019).
Überwiegend stehen in der Sozialen Arbeit aber nicht öffentliche Sozialisationsangebote im Vordergrund, sondern Zustände, die eindeutig als Problem und damit negativ codiert sind.
Was im Einzelnen als öffentlich relevantes Soziales Problem gilt, unterliegt gesellschaftlich und historisch veränderlichen Definitionen. So war Pflegebedürftigkeit bis in die 1990er Jahre kein Soziales Problem, sondern eine private Angelegenheit. Gewalt gegen Frauen gelangte erst durch die Frauenbewegung auf die staatliche Agenda der Bearbeitungsbedürftigkeit. Die Schwere eines Problems bzw. die Belastungen, die von ihm ausgehen, sind kein Gradmesser für seine staatliche Relevanz (Gesetzgebung, öffentliche Verwaltung), wie Graßhoff (2015, S. 89) am Beispiel von geflüchteten Menschen zeigt. Moralische Veränderungen in der Gesellschaft können auch zur Rücknahme von Problemzuschreibungen führen (z. B. in Bezug auf gleichgeschlechtliche Beziehungen).
Die Anerkennung eines Sachverhalts als gesellschaftlich relevantes soziales Problem führt nicht automatisch oder exklusiv zu einer Aktivierung sozialpolitischer Handlungsformen, etwa Sozialer Arbeit. Grundsätzlich kommen auch repressive Reaktionen durch Polizei, Justiz und Ordnungsbehörden in Betracht (im Falle von geflüchteten Menschen z. B. Kasernierung, Abschiebung). Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat diese divergenten Reaktionen einmal als »linke« und »rechte Hand« des Staates bezeichnet (Kuhlmann, Mogge-Grotjahn & Balz 2018, S. 68).
Geht man von dem »Handbuch soziale Probleme« (Albrecht & Groenemeyer 2012) aus, lassen sich gegenwärtig – ungeachtet aller grundlagentheoretischen Differenzen über ihre Identifizierbarkeit – u. a. die folgenden Probleme als »Soziale Probleme« bestimmen: