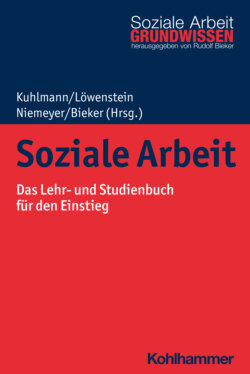Читать книгу Soziale Arbeit - Группа авторов - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ökonomisierung
ОглавлениеZunehmend wird heute im Leistungsprozess die Frage gestellt, ob sich im Hinblick auf die zu erwartenden Effekte ein weiterer Mitteleinsatz ›lohnt‹, ob das erzielte Ergebnis nicht bereits ausreicht oder das vereinbarte Ziel nicht mit geringerem Mitteleinsatz verfolgt werden kann. Derartige Erörterungen setzen Sozialarbeiter*innen immer häufiger einem von ökonomischen Motiven getriebenen Rechtfertigungsdruck aus.
Die Abhängigkeit Sozialer Arbeit von staatlichen Maßgaben betrifft auch die Zielsetzungen, unter denen die Problembearbeitung erfolgt. Münchmeier (2013) zeigt dies am (Negativ-)Beispiel des SGB II, das die Arbeitsmarktpolitik ab 2005 neu ausgerichtet hat. Unter der Devise »Fördern und Fordern« haben sich Münchmeier zufolge
»neue Zielstellungen, Aufgaben und Funktionen für die Soziale Arbeit ergeben. Sie hat ihre Interventionen und Leistungen ebenfalls am Ziel der Erhaltung oder Wiederherstellung von Beschäftigungsfähigkeit (employability) auszurichten (…). Ist diese Hilfe (zur Wiedereingliederung in die Arbeitswelt, R. B.) nicht erfolgversprechend, soll sie nicht angeboten, sondern Arbeitsgelegenheiten nachgewiesen werden. (…). Soziale Arbeit wird nunmehr für die Zwecke einer auf arbeitsmarktliche Vermittlungsfähigkeit ausgerichteten Verhaltenskontrolle in den Dienst genommen. Eigenverantwortlichkeit, persönliche und örtliche Flexibilitätsbereitschaft, aktive Selbsthilfeanstrengungen sind die neuen Sozialisations- und Erziehungsziele und – das ist das Wesentliche – sie können mit repressiven Mitteln (bis hin zur Kürzung des Transfereinkommens) erzwungen werden« (Münchmeier 2013, S. 49).
Das Zitat zeigt: Soziale Arbeit wird über sozialstaatliche Handlungsprogramme in politische Zielsetzungen eingebunden, die potenziell in Widerspruch zu ihrem Selbstverständnis treten können (vgl. auch Bitzan & Bolay 2017, S. 24f.). Ob es ein einheitliches Selbstverständnis gibt, ist allerdings fraglich. Berührt werden aber professionsethische Fragen ( Kap. 1.5.1).
Sofern Sozialleistungen (z. B. Hilfen für wohnungslose Menschen) durch privat-gemeinnützige oder privat-gewerbliche Träger als »Leistungserbringer« ausgeführt werden, führen sie diese Aufgabe nicht nur unter Beachtung gesetzlicher Zielvorgaben durch, sondern auch auf der Grundlage umfangreicher vertraglicher Regulierungen, die ab Mitte der 1990er Jahre sukzessive durch das Leistungsrecht vorgeschrieben wurden.
Die Einbindung Sozialer Arbeit in den Sozialstaat kommt auch darin zum Ausdruck, dass Soziale Arbeit nicht nur dem Bedarf der*des Einzelnen an Beratung und Unterstützung gegenüber verpflichtet ist, sondern im Interesse der Allgemeinheit auch Kontrollfunktionen gegenüber Individuen und Gruppen ausübt ( Kap. 1.4.2).