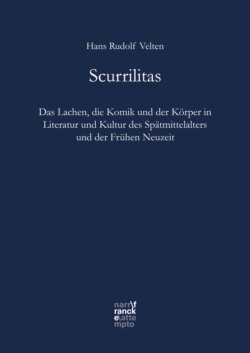Читать книгу Scurrilitas - Hans Rudolf Velten - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung Das Hinken des Hephaistos
ОглавлениеAm Ende des ersten Gesanges der Ilias, an prominenter Stelle, erschallt das „unauslöschliche Gelächter“ (asbestos gelos) der Götter auf dem Olymp. Diese hatten sich – zum ersten Mal im homerischen Epos – versammelt, um das gemeinsame Mahl einzunehmen. Doch gibt es einen Anlass zum Streit: alle warten auf Zeus, der sich wegen eines Stelldicheins mit Thetis verspätet und von der eifersüchtigen Hera deswegen bei seiner Ankunft zur Rede gestellt wird. Zeus erwidert, sie müsse nicht alles wissen. Als sie widerspricht – es geht in Wirklichkeit um das Schicksal der Griechen und Troer – gemahnt er sie mit offener Drohung zum Schweigen. Alle sind betroffen; man hat noch nichts gegessen und muss diese peinliche Situation über sich ergehen lassen. In diesem Moment erhebt sich Hephaistos, Gott der Schmiedekunst und Sohn der Hera, und hält eine kleine Rede, halb zur Mutter, halb zu den Anwesenden gewandt, über die Unberechenbarkeit des Zeus, die er am eigenen Leib hatte spüren müssen. Er mahnt Hera zur Nachsicht, mit dem Hinweis auf die geringe Bedeutung der Menschendinge, und beschwört die Eintracht im Olymp: „Nichts ja geneußt man mehr von der Freude des Mahls, denn es wird je länger je ärger.“ Daraufhin beginnt er, der ganzen Götterversammlung reihum Nektar auszuschenken, was diese mit dem bekannten homerischen Lachen quittiert:
Jener schenkte nunmehr auch der übrigen Götterversammlung
Rechts herum, dem Kruge den süßen Nektar entschöpfend
Doch unermessliches Lachen erscholl den seligen Göttern
Als sie sahn, wie Hephästos in emsiger Eil‘ umherging.1
Worüber lachen die Götter hier? Ist es die Erleichterung über den beendeten Zank und den Beginn des Mahls, ein – mit Bachtin gesprochen – festliches Lachen, das Hierarchien löst? Ist es der Kontrast zwischen dem jetzigen, friedensstiftenden, und dem vergangenen Handeln des Schmiedes, als er sich auf die Seite seiner Mutter geschlagen hatte und dafür – was allen bekannt ist – von Zeus fürchterlich bestraft wurde, gewissermaßen eine Handlungs-Inkongruenz, die seine Angst vor dem Göttervater offen legt? Oder ist das Lachen hier ambivalentes Zeichen für das weitere Schicksal der Akteure auf Erden?
Sicherlich sind solche Vermutungen nicht falsch. Doch bei näherer Betrachtung des Verses wird deutlich, dass zunächst etwas anderes im Vordergrund steht, nämlich die Wahrnehmung einer körperlichen Szene: die Götter sahen, wie Hephaistos in emsiger Eil umherging. Sie lachen somit über den motorischen Vorgang des eilfertigen Ausschenkens durch den Schmied, der für diese Aufgabe denkbar schlecht gerüstet ist: er hinkt nämlich. Und wie der Hinkende rechts herum geht und dabei Nektar schöpft, zu schnell für seine körperliche Behinderung, löst sich die gereizte Spannung auf dem Olymp schlagartig auf und schlägt in asbestos gelos um, ein unvorhersehbares Lachen aller, das zum Mahl überleitet und Gemeinschaft unter den Göttern stiftet: „Also den ganzen Tag bis spät zur sinkenden Sonne, schmausten sie, und nicht mangelt ihr Herz des gemeinsamen Mahles …“. Auch Musik hören die Götter und den Gesang der Musen, und als es Nacht wird, legt sich Zeus sogar zu seiner Gattin schlafen. Das von Hephaistos ausgelöste Lachen hat obsiegt, es hat Wirklichkeit verändert.
Das Verlachen des Hinkenden zieht die gesamte negative Energie der vorherigen Szene auf sich und lässt sie sich entladen. Doch die sozialen Bedingungen des gemeinschaftlichen Auslachens stehen bei dieser Szene nicht im Vordergrund: Hephaistos ist fest in die Gemeinschaft der Götter integriert. Die Frage lautet deshalb: wie ist das Lachen über seinen Körper zu verstehen? Wird der Schmied im Moment unvorsichtiger Bewegung Opfer von Schadenfreude, einer Schadenfreude, welcher der deformierte und defizitäre Körper als ein performativer Effekt sich wiederholender Normzuschreibungen zugrunde liegt (wie Judith Butler sagen würde),2 oder hat Hephaistos die körperliche Materialisierung des Hinkens mit seinem Auftritt erst in Szene gesetzt? Ist er unfreiwilliger Sündenbock oder listiger Spaßmacher?
Die Frage umfasst das weite Spannungsfeld von körperlicher Komik und kann wegen der unklaren Vorgeschichte der Figur des Gottes nicht vollständig beantwortet werden. In jedem Fall knüpft das Gelächter an die soziale Praxis im Altertum an, behinderte und körperlich entstellte Personen als Zielscheibe der Verspottung zu gebrauchen und dies mit der Hinführung zu einem sozialen Nutzen zu rechtfertigen.3 Es wären somit die anwesenden Götter, die bei ihrer Wahrnehmung des hinkenden Schmiedes das Ritual des Verlachens als Ausweg aus der Situation gewählt hätten. Vieles spricht aber dafür, dass es sich hier um ein kunstfertiges Verfahren handelt, die Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper zu lenken, eine Fähigkeit zur Herstellung einer lächerlichen Szene mit theatralen Mitteln, die dem strategischen Ziel dient, die peinliche Situation zu entschärfen und Frieden herzustellen. Das bringt Hephaistos in die Rolle des Possenreißers, desjenigen, der absichtlich mit seinen körperlichen Mängeln ‚auftritt‘ und somit Gelächter hervorrufen kann – was den kalkulierten Nutzen der Schadenfreude nicht ausschließt. Hephaistos wird schließlich als der hinkende Künstler bezeichnet, der mit erfindungsreichem Verstande auch die Paläste der Götter gebaut hat.
Der Körper als „Lachanlass“ – Helmuth Plessner hat diesen salienten Begriff geprägt4 – schließt jedoch die Anlagerung von kognitiven und sozialen Widersprüchen nicht aus: Körper und Lachen, Konflikt und Macht, Vergangenheit und Zukunft sind in dieser Passage aufs engste miteinander verbunden. Hephaistos trägt die Wirkung der Gewalt des Zeus als bleibenden körperlichen Makel, ist somit Sinnbild für die strafende Macht des Göttervaters, welcher die anderen noch nicht ausgeliefert waren, aber die Angst davor gleichwohl kennen. Er verhindert die Eskalation der Situation – bei der seine Mutter sicherlich die Leidtragende gewesen wäre – indem er die eigene Erniedrigung in mahnender, doch spielerischer Distanzierung vorführt, und zeigt somit die Labilität der Machtverhältnisse auf dem Olymp und in der Menschenwelt auf. Und weiter noch: der Hinkende erscheint hier als Sinnbild für den Dichter, welcher die Gesellschaft der Hörer zum Lachen bringen kann, indem er seine leiblichen Schwächen als Anlass zu ritueller Freude aufführt.