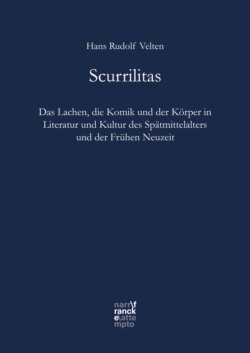Читать книгу Scurrilitas - Hans Rudolf Velten - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Komik und Sprache
ОглавлениеVon allen Formen der Komik ist die Sprachkomik – vielleicht weil sie dem Witz besonders nahesteht – am eingehendsten untersucht worden. Disziplinen wie die Humorlinguistik oder die interaktionale Linguistik widmen sich in hohem Maße der syntaktischen Pointenstruktur und dem sprachlichen Humor. Auch die literaturwissenschaftlichen Untersuchungen zu Komik und Humor bei einzelnen Autoren oder in den Gattungen konzentrieren sich vorwiegend auf die sprachliche Komik.27 Es sind mannigfaltige Kategorien des Komischen in der Sprache aufgestellt worden: semantische und syntagmatische Interferenzen, Phraseologien, Wortspiele, Wörtlich-Nehmen, Ironie, dialektale und soziolektale Komik, Wiederholungen, Automatismen, Klischees und viele andere mehr.
Dabei ist das Körperliche an der Sprache geflissentlich übersehen worden. Ähnlich der Komik des Körpers, der Gebärden und der Gestik im Allgemeinen, haben die Zusammenhänge von Sprache und Körper im Komischen bislang nur wenig Interesse seitens der Forschung gefunden.28 Dies liegt vermutlich daran, dass man Körper- und Sprachkomik bisher aus heuristischen Gründen strikt getrennt hat und ihre Verquickung wenig beachtete. Die Trennung macht nur dann Sinn, wenn aus thematischen Gründen eines der beiden Systeme im Vordergrund steht (wie bei dieser Arbeit), doch ist bei der Wahrnehmung des komischen Vorgangs der Körper häufig nicht von der Sprache zu trennen: Komische Sprache kann nicht nur durch Sprachartistik, Klangphantasie und semantische Inkongruenz Lachen auslösen, sie löst dadurch Lachen aus, indem sie körperlich hervorgebracht wird. Der komische Effekt der klassischen Redekomik in der Komödie resultiert nicht selten aus dem körperlichen Substrat einer sprachlichen Semantik, die den menschlichen Leib, seine Triebe und Begierden, Bedürfnisse und Schamzonen betrifft.
Mehr noch als die Körpersemantik sind es allerdings in der sprachlichen Kommunikation enthaltene materiale, phonetische und phatische Effekte, die direkt vom Körper herkommen und die Verankerung der Sprache im Körper, jenseits von aller Semantik, deutlich machen. So weist etwa das Stottern, ein klassischer Topos der Situationskomik, auf die Produktion und Materialität der Sprache hin, auf ihre Artikulation als einen leiblichen Vorgang. Stottern ist ein physischer Mangel, der im Kommunikationsprozess der Sprache, wo es auf die Übertragung von Semantik ankommt, die Aufmerksamkeit weg von der Nachricht und hin zum Körper lenkt. Der Körper bricht in die Sprache ein; nicht Syntax und Semantik stehen mehr im Vordergrund, sondern der Akt des Sprechens selbst. Das Stottern wird somit zum Störfaktor der Nachrichtenübermittlung, ebenso wie andere Ausdrucksweisen und -gebärden des Sprechens, wie eine außergewöhnliche Stimme oder Stimmlage, das Schreien, Stöhnen, Schluchzen, Lachen und Weinen dieser Stimme. Sie alle verweisen uns auf den Körper, und was diese Stimme äußert wird daher weniger Gewicht haben, als die Art, wie sie es äußert, da die Aufmerksamkeit auf die Stimme selbst gerichtet ist.
Das Stottern oder eine komische Stimme sind somit Körperphänomene der Sprache. Man kann sie auch als performative Phänomene bezeichnen. Dazu gehören auch Ausrufe, Interjektionen, unartikuliertes Sprechen wie Stammeln oder Nuscheln sowie alles, was Bergson mit „Rhythmus der Rede“ bezeichnet: das abgehackte oder mit Pausen versehene statt flüssige Sprechen, die aus der Reihe fallende Prosodie, die unübliche Betonung. Diese Körperlichkeit der Sprache wird umso gravierender, wenn es sich um zeremonielle oder rituelle Sprechakte handelt, die dadurch beeinträchtigt werden oder sogar scheitern können. Wichtig für den Umgang mit diesen phatischen und phonetischen Dimensionen der Sprache ist ihre Flüchtigkeit und Spurenlosigkeit. Selbst wenn sie in Texten teils markiert werden (etwa Ausrufe oder stockendes Sprechen), sind sie in der Regel dort nicht mehr aufzufinden, sondern Teil der Aufführung oder des Ereignisses. Dass es sie gibt, und dass sie auf das körperliche Substrat der Sprache verweisen, muss jedenfalls auch bei der Analyse komischer Vorgänge in Texten immer einkalkuliert werden.
Die Beziehung zwischen Sprache und Körperlichkeit ist auch phänomenologisch untersucht worden, und zwar im Kapitel über Sprache als leibliche Gebärde in Maurice Merleau-Pontys Phänomenologie der Wahrnehmung; hier stellt sie sich jedoch als wesentlich elementarer dar. Für Merleau-Ponty ist das Wort eine körperliche Erscheinung. Voraussetzung dafür ist, dass das Sprechen eine Möglichkeit unter anderen ist, den Leib zu modifizieren. Es ist die Verlängerung des Armes, der Gestik, eine Erweiterung der Leibessynthese. Die Sprache ruht auf der unmittelbaren Leiblichkeit und ist ihre Entfaltung, nicht ihre Depravation: „In Wahrheit ist das Wort Geste, und es trägt seinen Sinn in sich wie die Geste den ihren.“29 Im Wort wie in der Geste ist der Sinn „inkarniert“. Somit ist auch Kommunikation für Merleau-Ponty keine Übertragung, also En- und Decodierung von Informationen, sondern die Übernahme der in der Gebärde realisierten Intention des Gegenübers, der Nachvollzug. Merleau-Ponty erläutert das am Beispiel der Drohgebärde:
Um etwa eine zornige oder drohende Gebärde zu verstehen, muss ich mir nicht erst die Gefühle in die Erinnerung rufen, die ich selbst einmal hatte, als ich dieselben Gebärden machte. (...) Fremdpsychisches wird nicht durch Analogieschlüsse verstanden, sondern unmittelbar, und das heißt, von Körper zu Körper, durch Übernahme der Intention des anderen. Dann ist es, als wohnten seine Intentionen meinem Leibe inne und die meinigen seinem Leibe.30
Da die Sprache ähnlich wie die Gebärde den Körper und seine Grenzen überschreitet, kann sie auch unmittelbar körperlich wirken. Es gibt zahlreiche Beispiele von Auseinandersetzungen, wo sich verbale und körperliche Ebene miteinander verbinden, wo Sprache nicht nur Handlung ist, sondern auch körperliche Wirkung zeitigt. So ist beispielsweise der körperliche Effekt von hasserfülltem Sprechen („hate speech“) gut belegt; hier ist es vor allem die Intensität von Lautstärke und Sprechgebärde, die körperlich wirkt und die nicht selten körperliche Reaktionen hervorruft (körperliche Gewalt auf Grund von sprachlicher Gewalt).31 Austin hat solche Wirkungen von Sprache als „perlokutive Sprechakte“ bezeichnet, doch wurden sie immer nur in Bezug auf ihre Semantik interpretiert, weniger auf ihre performativen, körperlichen Effekte. In der Leiblichkeit der Rede und der Leiblichkeit ihrer Wirkungen treffen sich die Theorien Austins und Merleau-Pontys. Nicht zuletzt deshalb rekurriert Butler in hohem Maß auf phänomenologische Ansätze. Gemeinsam ist diesen Perspektiven, dass sie in der Analyse von Kommunikation weit über den Austausch von Zeichen bzw. die Übermittlung von Nachrichten hinausgehen, dass der direkte Bezug von Handlung und Effekt wichtiger ist als die Suche nach einer vermittelnden Instanz wie dem Denken oder dem Verstand. „Durch meinen Leib verstehe ich den anderen“, sagt Merleau-Ponty, und fügt hinzu: „Man sah nicht, dass letzten Endes der Leib selbst das Denken, die Intention werden muß, die er uns je bedeutet, soll er sie ausdrücken können. Er ist es, der zeigt, er ist es, der spricht.“ 32
Zurück zur Komik: Wenn das gewalttätige Wort nur dann wirkt, wenn es „verkörpert“ wird, muss dies auch für das komische Wort gelten. Plessner hat dies bei der Untersuchung des Witzes als Ausdrucksform der Sprache bereits angedeutet: „Im Flusse der Rede tritt unversehens ihre gewissermaßen körperliche Außenseite hervor. Man zerkaut die Worte, spielt mit ihnen wie mit Fremdkörpern: das Phänomen des komischen Wettstreites ist da.“33 Selbst der Witz, der in hohem Maß auf seinen semantischen Begleittext rekurrieren muss, besitzt demnach eine körperliche Grundlage: Es ist das Spiel mit den Wortkörpern der Sprache, die semantisch nicht fassbare Mehrsinnigkeit, die Verballhornung von Worten, der Nonsense und künstliche Wortbildungen. Die Körper der Worte werden deformiert, umgestellt, wirken somit grotesk und fremd, ergeben neue und Mehrfachbedeutungen. Semantische Aspekte sind somit selbst bei Witzen nicht so dominant, wie man landläufig annimmt. Komische Wirkung hingegen, so Plessner, braucht keine Erläuterung: Sie spricht durch sich selbst, sie gibt nichts zu verstehen.
Methodisch ergibt sich daraus eine stärkere Beachtung des Körpersubstrats bei der Sprachkomik; es geht darum, die Austauschprozesse, die das Komische als Semantisches mit dem Komischen als Performativem unterhält, näher zu analysieren oder, da diese Trennung eine künstliche ist, wie semantische und performative Elemente das Komische bestimmen.34