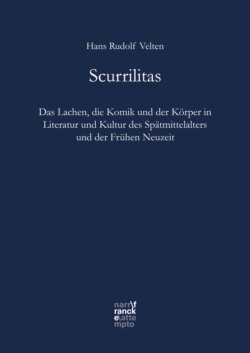Читать книгу Scurrilitas - Hans Rudolf Velten - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3. Körper – Leib – Verkörperung: methodische Zugänge zum Körper
ОглавлениеBisher habe ich einfach von ‚dem Körper‘ gesprochen, ohne näher zu bestimmen, was ich darunter verstehe. Während der Arbeit an dieser Studie ist immer deutlicher geworden, dass der menschliche Körper als Lachanlass eine theoretisch-methodologische Diskussion der Begrifflichkeit und der damit zusammenhängenden Vorannahmen erfordert, damit die Begriffe als Instrumentarien der Untersuchung fundiert und arbeitstauglich sind. Ohne Umschweife weiterhin von ‚dem Körper‘ zu sprechen, wäre weder systematisch noch historisch angemessen. Gerade bei einem sogenannten ‚Modebegriff‘ scheint dies mehr als notwendig zu sein: zu groß sind noch die Vorurteile gegenüber seiner Untersuchung, auch auf Seiten von Philologen, Sprachwissenschaftlern und Historikern. Der menschliche Körper, um es gleich ohne Umschweife zu sagen, ist nicht nur ein seriöses Untersuchungsfeld auch für historisch arbeitende Disziplinen, sondern er steht geradezu im Zentrum kulturwissenschaftlicher Analysen.1
Um die Vielfalt der disziplinären Zugänge zum Körper einzuschränken, bedarf es mehrerer methodologischer und begrifflicher Entscheidungen. Vor allem müssen die sozialen und kulturellen Bedingungen für körperliche Aufführungen in der Vormoderne diskutiert werden, denn Körperkonzepte sind diskursive, imaginäre Konstruktionen, die historischer Veränderung unterliegen: Der Körper hat eine Geschichte.2 Daher ist auch die aus einem logozentrischen Wissenschaftsverständnis heraus geäußerte Polemik, die die ‚Wiederentdeckung‘ des Körpers immer noch hervorruft, einigermaßen fehl am Platz, denn sie verkennt seine fundamentale Bedeutung in den jeweiligen Disziplinen, deren Erkenntnis einer jahrhundertelangen Verdrängung und Vernachlässigung in den Wissenschaften ein Ende gesetzt hat.3 Dabei wird der Körper ganz unterschiedlich in Fachperspektiven eingebunden: als Kommunikationsmedium und Träger von Zeichensystemen, als rituelles Medium symbolischer Bedeutungen, als soziales Medium in den verschiedensten Handlungsvollzügen, als diskursive oder repräsentative Größe wie als leibliches Phänomen.
In den Kulturwissenschaften4 hat sich im Anschluss an Foucault ein Körperbegriff herausgebildet, der nicht ‚den Körper‘ an sich, sondern seine diskursiven Praktiken und Inszenierungen in den Mittelpunkt des Interesses stellt. Für Forschungsfelder wie Geschlechterdifferenz, den historischen Wandel von Subjekt- und Identitätsvorstellungen, die Emotionengeschichte, wie überhaupt für die an anthropologischen Theorien orientierte Erforschung von Religion, Politik, Literatur und Kunst im Mittelalter und früher Neuzeit ist die kulturelle Konstruktion des Körpers in schriftlichen Texten bedeutsam geworden. Körper erscheinen hier als Produkte und Effekte diskursiver Praktiken und semantischer Prozesse: Die Aufmerksamkeit liegt dabei nicht auf der Frage, wie der Körper in der Vergangenheit tatsächlich beschaffen war – sie wird als methodisch nicht lösbar bewertet –, sondern wie Menschen in verschiedenen historischen Perioden und verschiedenen Gesellschaften sich sprachlich über ihn verständigten. Der Körper wird somit über diskursive Körperbilder wahrgenommen, die an phantasmatischen Idealisierungen ausgerichtet sind und über normative kulturelle Praktiken produziert werden.5 Darin spielen die Erfahrung und das Wissen vom Körper (Körpergedächtnis) nicht nur zur Decodierung der Bilder von ihm, sondern auch als psychisches Reservoir für die Geschichte der Wahrnehmung eine wichtige Rolle.6
Demnach gibt es auch nicht ‚den Körper‘ im Mittelalter, sondern an bestimmte Textgattungen und historische Praktiken gebundene Körperdiskurse.7 Diese Diskurse „inszenieren“ ihren Gegenstand auf verschiedene Weise:8 etwa als leidenden und gemarterten Körper des Heiligen, als Medium der Gotteserfahrung, als höfisch schönen Leib der Dame und des Helden oder auch als sterbenden Körper. Das gilt besonders für historische Analysen, wo nicht nur nach den Funktionsweisen des Körpereinsatzes in menschlichen Interaktionen, sondern gerade nach dem Symbolgehalt ihrer Kommunikation gefragt wird.9 In dieser Perspektive werden kulturelle Praktiken, Situationen der Aufführung von Körperlichkeit (Rituale, höfisches Zeremonialhandeln, Herrschaftsgesten, Spiele) gesehen: Auch hier steht der Körper nicht einfach für sich, sondern seine Präsenz ist sichtbares und erfahrbares Zeichen innerhalb der symbolischen Repräsentationen der jeweiligen sozialen Situation, des jeweiligen kulturellen Zusammenhangs.
Die Textwissenschaften unterscheiden sich hier von anthropologischen und theaterwissenschaftlichen Zugängen zum Körper, die empirisch beobachtbare Interaktionen untersuchen. Während der Text alleine aus sprachlichen Zeichen (‚Textwelt‘) besteht, die im Akt des Hörens oder Lesens durch die Rezipienten verarbeitet werden, kommen bei face-to-face-Interaktionen bzw. (theatralen) Aufführungen zur auditiven auch die visuelle, teils sogar olfaktorische und taktile Wahrnehmungsqualität des menschlichen Körpers hinzu. Darüber hinaus bestehen größere Unterschiede in der Situationalität von Textrezeption und Aufführungsrezeption, wie etwa die Anwesenheit und die Teilhabe anderer Körper und habitualisierte Praktiken gemeinsamen Vollzugs. In der Aufführung sind es nicht allein Zeichen, die wahrgenommen werden, sondern auch die Präsenz und Energetik des Körpers, seine Unverfügbarkeit, durch die er sich einer klaren semiotischen Bestimmung entzieht. Dies veranlasste die jüngere theatergeschichtliche Forschung bei ihren Aufführungsanalysen nicht allein von Semiotik, sondern auch von der Performativität des Körpers zu sprechen.10 Die theaterwissenschaftliche Position Fischer-Lichtes stützt sich dabei auch auf Arbeiten der kritischen Kulturanthropologie, die schon seit längerem Zweifel an der Textmetapher hegten, die durch Clifford Geertz („Kultur als Text“) in die Anthropologie eingeführt worden war. Wenn Geertz die Lesbarkeit des Körpers unterstreicht, rückt dadurch seine Performativität – das in der Aufführung Erfahrene, nicht in Bedeutungen Aufgehende – in den Hintergrund.
Seit den 1990er Jahren ist in der Anthropologie eine Gegenbewegung zum Geertzschen Modell, aber auch zur klassischen Ethnographie entstanden, die sich auf phänomenologische Ansätze beruft. Während im semiotischen Körperverständnis der Körper als Objekt oder Medium von Symbolbildungsprozessen, als Oberfläche für und Produkt von kulturellen Einschreibungen verstanden wird, forderte der US-amerikanische Anthropologe Thomas Csordas einen Zugang zum Körper, der ihm das Recht auf Handlungsfähigkeit und leibliches „In-der-Welt-Sein“ nicht abspricht. 11 Er kann damit als Agens, wenn nicht sogar als Akteur berücksichtigt werden, als „Agent produktiver Körper-Inszenierungen.“12 Csordas kritisiert in erster Linie den repräsentationalen Charakter des wissenschaftlichen Körperbegriffs, der den empirischen und phänomenalen Körper perspektivisch ausblende.13 Repräsentation sei als nominaler Terminus immer die Repräsentation von etwas (anderem), während das In-der-Welt-Sein einen Zustand beschreibe, der auf Existenz und gelebte Erfahrung zurückgeht. Für alle Repräsentationen, die von diesem Körper bestehen, schlägt Csordas dagegen den Begriff der Verkörperung (embodiment) vor, der den menschlichen Körper als kulturellen Körper bezeichnet. Verkörperung meint ein methodologisches Feld, „(which is) defined by perceptual experience and mode of presence and engagement in the world.“ Komplementär zum Text stehe dem Körper eine vergleichbare paradigmatische Position in der Kulturtheorie zu, die ihn aus der Unterordnung vom Paradigma des Textes lösen kann.14
Damit ist im Begriff des embodiment ein performatives Verständnis von Kultur angelegt, wie es beginnend mit Butlers Performative Acts and Gender Constitution (1988) in den 1990er Jahren in verschiedenen Disziplinen entwickelt wurde. Gegenüber der semiotischen Behandlung des Körpers beachtet eine performative das Wechselverhältnis zwischen Einschreibung und Konstruktion und beschreibt Identität als eine durch wiederholte körperliche Handlungen und Zeichen performativ hergestellte Konstruktion.15 Bestimmte Körperhaltungen und Körperbewegungen sind nicht Ausdruck von vorgängigen Gefühlen und Vorstellungen, sondern sie erzeugen diese und bringen ihre Bedeutung allererst hervor. Somit ist der performative Körper weder der biologische, noch der existenzielle Körper, aber auch nicht der diskursive, sondern einer, der in der Aufführung erscheint und das Imaginäre des diskursiven Körpers in sich trägt.16 Jede Aufführung des Körpers hat demzufolge mit dessen spezifischer performativen Leiblichkeit, mit seiner Präsenz und Lebendigkeit zu rechnen; der performative Körper ist derjenige, der dem zeichenhaften, diskursiven widersteht: „Die Eigendynamik körperlicher Prozesse in der kulturellen Praxis zu betonen bedeutet, sie tatsächlich als Gewicht zu verstehen, das die Einschreibung, Disziplinierung und Fragmentierung des Körpers durch die Macht der Diskurse erschwert.“17
Ein auf soziale Interaktion und theatrale Aufführungen gründendes performatives Körperverständnis ist jedoch für die auf Textüberlieferung und -analyse basierende (ältere) Literatur- und Geschichtswissenschaft allem Augenschein nach von geringem Nutzen. Es ist kaum zweifelhaft, dass literarische und Gebrauchstexte keine phänomenalen, sondern diskursiv geschaffene Zeichen-Körper zum Gegenstand haben, da die Textwelt zunächst allein aus sprachlichen Zeichen besteht. Daher muss jede Rede über Präsenz oder embodiment in Texten von der sprachlichen Zeichenstruktur ausgehen.18 Wie kann man in Texten (genauer: in Texten der Vergangenheit) die Präsenz oder das „In-der-Welt-Sein“ des Körpers nachvollziehen oder gar belegen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Literaturwissenschaft seit mindestens drei Jahrzehnten, seit Hans Ulrich Gumbrecht den Körper in vormodernen Texten als „vehicle for the condition of meaning“ gekennzeichnet hat.19 Sie ist seither in vielfacher Weise innerhalb der Debatte um die Alterität vormoderner Literatur diskutiert und auf unterschiedliche Gegenstände und Gattungen angewandt worden: auf die geistliche Literatur mit dem zentralen Stichwort der „Realpräsenz“ des Christuskörpers, auf die Liedlyrik (Kopräsenz von Körpern in der Aufführungssituation), auf die doppelte Bezugnahme von Körper und Schrift in rituellen und zeremoniellen Akten allgemein und insbesondere prominent auf das Thema der Emotionalität.20 Dabei geht es allerdings in erster Linie um Bedingungen und Funktionen einer vormodernen Zeichenpraxis, ihre spezifischen Möglichkeiten der (auch auratischen) Re-Präsentation durch Schrift, und weniger um die Rezeption und Wahrnehmung von Texten beim Hören und Lesen. Die Prozesse der neuronalen Verarbeitung von Bildern und Tönen sind freilich auch keine Aufgabe der Mediävistik, dennoch sind sie für die hier ausgelegte Fragestellung besonders bedeutsam. Denn „Präsenz des Körpers“ verstehe ich bezogen auf körperliche Lachanlässe auf zwei verschiedene Weisen: (1) Auf eine physische Kopräsenz von Darstellern und Zuschauern von Lachvorgängen in solchen Aufführungen, die gemeinsam vollzogen werden, und (2) auf die Vorstellung dieser Kopräsenz bei der Rezeption von in Schriftsprache gefassten Repräsentationen solcher Lachvorgänge in literarischen Aufführungs- oder Lektüresituationen. Im Prozess der Rezeption von Zeichen und ihrer Verarbeitung im Gehirn scheint nämlich nicht nur der Informationsgehalt dieser Zeichen eine Rolle zu spielen, sondern auch die in den Zeichen verkörperten Imaginationen. Das Konzept der Bilderzeugung durch Vorstellungskraft ist bereits in der Antike bekannt, etwa im Rahmen der ars memorativa, wenn die wahrgenommenen Bilder sich mit gespeicherten zu inneren Bildern (imagines) verbinden.21 Wenn nun die Zeichenstruktur von Texten nicht allein die Bedeutung von Zeichen, sondern auch die repräsentierten Körper, ihre Bewegungen in Form von anschaulichen Bildern und Handlungen „verlebendigt“, dann sind sie auch in der Lage, beim Hörer/Leser Emotionen zu evozieren, Sympathien zu steuern, Gelächter auszulösen.
Eine solche Qualität von Texten nenne ich „Performativität“. Ich beziehe mich dabei auf eine Definition, die ich vor einigen Jahren als Ergebnis aus der Methodendiskussion in Theaterwissenschaft und Philosophie speziell in Bezug auf literarische Texte (des Mittelalters) formuliert habe. Performativität von Texten heißt: (1) dass sie Effekte von Präsenz zeitigen und vollziehen,22 (2) dass sie affektive und soziale Wirkungen auslösen und (3) dass sich an ihnen eine je besondere Medialität zeigt, die zwischen Schrift und der Vokalität und Körperlichkeit der Aufführung oszilliert.23 Texte sind demnach dann performativ, wenn sie „Teil einer somatisch-sinnlichen Praxis“ sind,24 wenn ihre sprachlichen Repräsentationen auf die emotionale Teilhabe am Gehörten und die Imagination seiner Geschehensstruktur (Performanz) abzielen, wobei auch das Gegenwärtigwerden von Atmosphären und Stimmungen einzuschließen ist. Sprachliche Zeichen gehen im Kommunikationsprozess nicht in Informationen und Bedeutungen auf, sondern können über die Imagination der Rezipienten bestimmte Wirkungen – etwa Lachen – in ihnen auslösen.25 Dies wird seit einiger Zeit auch von Seiten der emotionspsychologisch arbeitenden Literaturwissenschaft bezüglich der Stimulierung von Emotionen durch Texte bestätigt. So hat etwa Katja Mellmann in ihrer Studie zur Auslösung emotionaler Programme durch literarische Texte im Akt der Rezeption zeigen können, dass fiktionalen Handlungen eine Attrappenwirkung zugeschrieben werden kann, dergestalt, dass durch textuelle Stimuli und „lektürebegleitende (...) Imaginationsbildung“ Emotionsprogramme beim Leser ausgelöst werden können.26