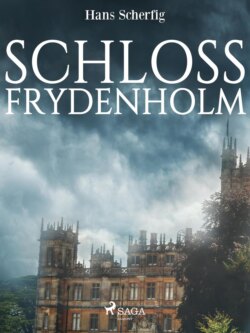Читать книгу Schloss Frydenholm - Hans Scherfig - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10
ОглавлениеSelbst auf Frydenholm waren die Wasserleitungen eingefroren. Man versuchte, sie mit Lötlampen aufzutauen, um Wasser für die Badezimmer zu bekommen. Das Thermometer zeigte dreißig Grad unter Null. Seit Menschengedenken habe es nichts Ähnliches gegeben, schrieb die Kreiszeitung. Es war wie im Schwedenkrieg, als Karl Gustav über das Eis kam und die Dänen überraschte.
Alle, die keine Wasserleitung hatten, konnten sich glücklich schätzen. Sie hatten keine Sorgen mit Badezimmern und eingefrorener Maschinerie. Aber die alte Emma mußte das Beil zu Hilfe nehmen, wenn sie ihren Latrineneimer leeren wollte. Sie schlug hart und verbissen zu, so daß ihr Splitter gefrorener Fäkalien um die Ohren flogen. Dieser ekelhafte Winter!
In den Knechtskammern konnte man das gefrorene Arbeitszeug in eine Ecke stellen, und dort stand es auch am nächsten Morgen noch steif und aufrecht. Man legte seine dicken Fausthandschuhe um das Glas Wasser, das man sich abends warm aus der Küche holte, und trotzdem war es am Morgen bis auf den Grund gefroren. Die Kartoffeln erfroren in den Kellern und schmeckten seltsam süßlich. Das Eingemachte gefror, der Himbeersaft und das Tomatenpüree schoben die Korken aus den Flaschen und wuchsen heraus, so daß es aussah wie rotes Eis am Stiel. Auch der Torf war gefroren, er mußte am Kachelofen aufgetaut werden und verwandelte sich in schwarzen Schlamm. Ein Teil davon waren wohl auch nur viereckige Erdbrocken, die man wie Torf nach Gewicht verkauft hatte. Braunglänzender Schmierruß floß wie Glasur im Schornstein herab.
Jetzt konnte man am Brennmaterial verdienen. In den Frydenholmer Wäldern wurde Holz geschlagen, und der Graf ließ seinen Oberförster wissen, daß die Leute kein Reisig in seinen Wäldern sammeln dürften. Auf Antrag konnte man Reisighaufen kaufen. Die Kinder und Frauen, die im Wald Zweige stahlen, wurden von den Förstern mit dem Knotenstock davongejagt In der guten alten Zeit, damals, als die Grafen mehr Macht hatten, wären die Leute wohl nicht so billig davongekommen. Vielleicht aber kehrte die Zeit der Herren wieder. Es gab Anzeichen dafür.
Wissenschaftler sprachen im Rundfunk und teilten mit, daß die Kälte gesund sei. Noch nie sei der Gesundheitszustand im Lande so gut gewesen. Es war gesund, zu frieren. Es würde wohl auch gesund sein, zu hungern, wenn die Lebensmittel einmal knapp würden. Zuweilen war Butter gesünder als Margarine, zuweilen war es umgekehrt. Aber jetzt waren sowohl Butter als auch Margarine knapp, und deshalb war Fett überhaupt ungesund. Wozu hat man schließlich die Wissenschaft!
Der Kaufmann wollte Tabak nur noch an die guten Kunden abgeben. Der letzte Rotwein wurde an Pastor Nørregaard-Olsen verkauft. Er war nicht gut, doch er wurde wohl besser, wenn er lag und wartete. Es war angenehm, in den Keller steigen, aufschließen und eine schöne, verstaubte Flasche holen zu können, wenn der Freund Harald Horn zu Besuch war. In diesem schrecklichen Winter kam er natürlich nicht aufs Land. Er hatte wohl auch genug mit dem nordischen Geistesleben zu tun und konnte sich nicht jederzeit Urlaub gönnen. Aber im Pfarrhof würde er stets willkommen sein. Das Gästezimmer im Giebel, mit den blaugestreiften Gardinen und den kleinen Rosen in der Tapete, stand bereit.
In der „Danmarkstidende“ las der Pfarrer Harald Horns Artikel über den nordischen Raum und die nordischen Urquellen. Harald Horn schrieb viel und schnell, er war ein fleißiger Mann auf dem Wege zum Erfolg, zielbewußt und mit Pfadfindermut. Er hatte einst Dichter werden wollen. Das war lange her, in der Schulzeit, als man noch träumte. Er hatte das Dichten nicht erlernen können. Aber er las die Dichter und legte Prüfungen über sie ab. Die Literatur wurde sein Broterwerb, die Literatur anderer. Später auch die Politik. Als das Nordische in Mode kam. In Lübeck ging er in die Lehre, wo zur rechten Zeit eine Nordische Gesellschaft entstanden war. „Dänemark ist unser Lebensraum, und der Norden ist unser Großraum!“ schrieb Harald Horn in der „Danmarkstidende“.
Pastor Nørregaard-Olsen bekam für seine Arbeit eine Extraration Koks bewilligt; er verdiente seinen Lebensunterhalt zu Hause, er hatte eine Werkstatt, sein Arbeitszimmer, wo er die Sonntagspredigten verfaßte und sie danach zu Rundfunkvorträgen umformte. Auch die Redaktion des kleinen Kirchenblattes befand sich dort, und das berechtigte ebenfalls zum Bezug zusätzlichen Heizmaterials. Schließlich gehörte noch ein kleines Wäldchen zum Pfarrhof, wo Bäume gefällt werden konnten. So war der Pastor in der Lage, sogar ein wenig Brennholz an Bedürftige zu verkaufen. Er war im Handel nicht ganz unbewandert. Da war zum Beispiel die Versorgung der Jugendabteilung mit Uniformen; der Pastor beschaffte die JA-Blusen aus dem Sportgeschäft des Schwagers in Kopenhagen. Und da waren Eier und Kücken, seit zum Pfarrhaus ein Hühnerhof gehörte; den hatte er eingerichtet, als der Krieg drohte und man damit rechnen mußte, daß es eine Hungersnot gab.
Es gab keine Hungersnot. Der Kälte und den Kriegsberichten zum Trotz gediehen Jens Olsens Schweine wunderbar. Jens ging in den Schweinestall, betrachtete die Tiere, kitzelte die große Sau an den Zitzen und sagte „Vaterns Beste“ zu ihr. Er selbst wurde mehr und mehr einem Schwein ähnlich, er konnte seine dicke Nase, die in dem fetten Gesicht wie ein Rüssel wirkte, bewegen, und er hatte es sich angewöhnt zu grunzen, wenn er in guter Stimmung war. Weshalb auch sollte er sich nicht freuen? Alles glückte ihm. Die Schweine nahmen gut zu. Auch seine beiden Töchter nahmen zu. Sie wurden immer dicker und hatten jederzeit satt zu essen. Sie fühlten sich hart wie Marmor an, sie traten ihre Schuhe breit, die Arme standen ihnen seitwärts ab, und sie konnten sie nicht an den Körper legen. Ihre Mutter war auch so unmanierlich dick gewesen, ein herrliches Weib. Nun lag sie auf dem Friedhof, und ihr Grab war für den Winter mit Tannenzweigen zugedeckt; sie sollte es gemütlich haben.
Jens Olsen besaß das kleine Haus am Löschteich, in dem Martin Olsen wohnte, und er war kein harter Hauswirt. Er war ein gutmütiger Mann. Er und seine dicken Töchter waren stets in eine Duftwolke von Soße und Braten und fruchtbarem Dünger gehüllt, sie waren satte und friedfertige Menschen und mischten sich nicht in Politik und Streitereien.
Es gab keine Hungersnot, denn man zählte im Lande mehr Schweine als Menschen. Man konnte sogar noch einen Teil des Auslandes ernähren. Den ganzen Tag lang wurden in den großen Fabriken die Schweine am laufenden Band geschlachtet, und Schiffe und Güterzüge transportierten die toten Körper hinaus in die Welt. Die feinen BaconSchweine gingen nach England, und die riesigen, fetten, gemästeten Schweine gingen nach Deutschland, wo man nicht so verfeinert war.
Im Radio hörte man, daß deutsche U-Boote Schiffe torpedierten. Das waren alltägliche Dinge, und wer niemanden an Bord kannte, mochte wohl nicht allzuviel dabei empfinden. Der Rundfunk teilte es in einer neutralen und rücksichtsvollen Art mit, um die Deutschen nicht zu beleidigen. Dänemark war neutral, man mußte sich jeder Parteinahme enthalten. Man sprach nicht von Torpedierungen, sondern von Kriegsverlusten, das klang unparteiischer. Zwanzig Mann umgekommen, vierzehn vermißt, sagte der Sprecher. Dann verlas er die lange Liste der Namen. War er nicht bald fertig? Waren es noch mehr? Und dann kamen die Sportergebnisse. AB hatte über CD mit vier zu drei gewonnen.
Vielleicht aber ist irgendwo jemand, der sich diesmal nicht die Sportergebnisse anhört und der glaubt, daß es im Leben nichts mehr gibt, was wert wäre, es anzuhören. Zwanzig Mann, vierzehn Mann, vierzig Mann – für einige Menschen sind das nicht nur Zahlen und Namen. Für irgend jemanden ist einer dieser Namen das Wichtigste auf der Welt. Und nun plötzlich ist er ein Nichts.
In dem roten Haus gegenüber der Schule saß der alte Lehrer Tofte, der an Gott und Grundtvig glaubte und der Bevölkerung der ganzen Gegend das Einmaleins und Psalmenverse beigebracht hatte. Er erinnerte sich an einen der Namen, die im Rundfunk genannt wurden; es war der Name eines Jungen, den er das Lesen gelehrt hatte. Er erinnerte sich auch an das Gesicht: ein Junge mit Sommersprossen und struppigem weißblondem Haar, der immer lachte, lustige Augen hatte und sich immer über etwas freute. Er wollte zur See, als er konfirmiert war. Lehrer Tofte erinnerte sich sehr gut an ihn. Es war einer der vielen Namen. Sechzehn Jahre alt war der Junge geworden.
Es wurde nicht davon gesprochen, daß die Deutschen ohne Warnung torpedierten, obwohl man auf die Flanken der Schiffe ganz groß die neutralen Nationalitätskennzeichen gemalt hatte. Der Rundfunk war ein neutraler Rundfunk. Er berichtete nicht, daß die Deutschen die Rettungsboote mit Maschinengewehren beschossen.
Der Krieg war nicht für alle so schlimm. Wo mochten jetzt die Pferde sein, die im Sommer auf Frydenholms Koppeln geweidet hatten? An ihnen war viel Geld verdient worden. Vielleicht waren sie irgendwo in Polen. Ob sie sich wohl an Frydenholm erinnerten? Es wurde an vielen Dingen Geld verdient, die im Jahr zuvor noch völlig wertlos waren. Viereckige Stücke gefrorener Erde verkaufte man nach Gewicht. Rübenschalen verwandelten sich in Kaffee. Tonerde wurde zu Waschmittel in blauen und gelben Paketen. In den Schaufenstern des Kaufmanns konnte man merkwürdige Waren sehen, Kartons mit ganz neuen Substanzen. „Sie sollten sich lieber einige Pakete sichern, gnädige Frau! Wer weiß, wann wir wieder etwas bekommen!“ – „Aber es wird doch wohl keinen Mangel an Ersatzstoffen geben?“ – „Doch, das könnte sein“, meinte der Kaufmann. „Alles wird knapp werden. Der Krieg dauert lange. Es ist klug, zu kaufen!“ Das alles sagte der Kaufmann nur ganz im Vertrauen.
Man legte sieh Vorräte an: Kaffee-Ersatz und Süßstoff und viele Sorten Brotaufstrich mit synthetischem Geschmack. Freundinnen telefonierten miteinander: „Hast du schon gehört? Es heißt, ab morgen wird das Salz rationiert! Da ist es sicher das beste, sich einzudecken. Es wäre wahrhaftig schlimm, das Salz entbehren zu müssen. Vielleicht stimmt es gar nicht, aber es wird erzählt.“ Und dann kauften die Damen Salz. Und der fixe Kommis des Kaufmanns mußte das Salz zu den guten Kunden fahren, die nach Ladenschluß noch anriefen. Er hieß Evald, war aufgeweckt und wohlgelitten und hatte immer kecke Antworten und Witzchen für die Damen parat. Er pfiff aus vollem Halse, während er mit den Salztüten die Straße entlangfuhr.
In den Pökelfässern staken die halben Schweine. Am schlimmsten war es in den Städten, wo man keine Keller hatte und unkundig im Einsalzen war. Die Schweine vertrugen die Zentralheizung schlecht, und die Vorräte und Lager bereiteten den Wohlhabenden Sorgen. Die armen Leute hatten es da leichter.
Dann wurde das Salz doch nicht rationiert. Aber die Damen mußten sich ohnedies um so vieles kümmern. Im Nähzirkel sprach man über die Probleme der Zeit. „Ja, unsere fleißigen Damen müssen jetzt mit Kaffee-Ersatz vorliebnehmen.“ Die Pfarrersfrau füllte die Tassen. „Wir haben keinen besseren.“
„Der ist doch aber wirklich gut“, sagte Frau Andersen, die Kranzkuchen mitgebracht hatte. „Wir haben auch nichts gehamstert. Mein Mann will das nicht. Wenn andere Kaffee-Ersatz trinken können, können wir das auch, sagt er immer.“ Und wer eine Bäckerei hatte, brauchte sich ja wohl um Butter und Weizenmehl keine Sorgen zu machen.
Nein, hamstern! Man redete und schrieb so viel über Gemeinschaftsgeist, den alle beweisen sollten. Das war ein neues Wort. An dieser Stelle konnte sich Pastor Norregaard-Olsen eine Äußerung über die Vögel und Lilien, die ja schließlich auch keine Vorräte zusammenrafften, nicht verkneifen. Über den Sack Kaffee auf dem Boden des Pfarrhauses wurde nicht gesprochen. Eine kleine Schwäche durfte man wohl haben.
In diesem Winter strickte der Nähzirkel Socken und Schals, die für Mannerheims Soldaten in Finnland bestimmt waren. Vor kurzem hatte sich den Finnen am Ladogasee ein Engel gezeigt; in den Zeitungen war viel darüber geschrieben worden, und er soll, wie berichtet wurde, die Soldaten sehr ermuntert haben. Pastor. Nørregaard-Olsen hatte ihn auch in seiner Sonntagspredigt erwähnt. Und die Überschrift im Kirchenblatt lautete: „Der Engel von Lacloga“.
Der Nähzirkel der Damen war mit der Zeit sehr zusammengeschmolzen. Der frische Wind, der in Pastor Nørregaard-Olsens erster Zeit in der Gemeinde geweht hatte, war abgeflaut. Als der Pfarrer damals voll Unternehmungslust sein Amt antrat, setzte er sein ganzes Vertrauen in die Frauen. Es hatte eine Zeit gegeben, da der Nähzirkel ein geistiges Kraftzentrum war, in dem allerliebste Tischdecken und Tischläufer für Wohltätigkeitsbasare gefertigt wurden, da man sich sammelte und in unbefangenem Gesang innig vereint war und da alle darin wetteiferten, prächtigen Kuchen und Bohnenkaffee mitzubringen. Jetzt brachte nur noch die Bäckersfrau Kranzkuchen mit, und viele hegten den Verdacht, es sei Kuchen vom Vortage, den man im Geschäft nicht mehr verkaufen konnte. Alter Kranzkuchen wirkt aber wahrhaftig nicht inspirierend, und so lag gleichsam kein Segen über dem Beisammensein.
Sie waren zu wenige, als daß der Psalmengesang wie in der ersten, fruchtbaren Zeit richtig brausen und sich erheben konnte. Allzu viele waren abgefallen. Niels Madsens Frau kam zwar noch getreulich, doch sie war kein fröhlicher Christ, sie war wortkarg und griesgrämig, und ihr Anteil am Gesang war nur ein mißvergnügtes Brummen. Höschen-Marius’ Wirtschafterin kam, obwohl Marius es nicht wünschte; sie war übrigens nicht mehr Wirtschafterin, sondern Ehefrau, wenn bei den beiden darin überhaupt ein Unterschied bestand. Marius war kein junger Mann mehr und für die Liebe mit lebenden Menschen kaum tauglich; aber er hatte ja Geld, das Vermögen der Eltern, und das würde er natürlich als Erbe hinterlassen. Das war es wohl, womit sie rechnete. Dieser Ehe würden bestimmt keine Kinder entspringen, alles würde also ihr zufallen. Sie weckte eifrig ein, das mußte man ihr lassen. Es gab Marmelade, Saft und Gelee für mehrere Jahre im Hause, obwohl Marius die süßen Sachen sehr liebte und eine Menge davon aß.
Wenn sie ihn nun obendrein bewegen könnte, sich die Nase zu putzen, dann hatte sie etwas fürs Geld geleistet; denn der Rotz hing ihm immer im Schnurrbart, wenngleich er diesen jetzt – wie eine gewisse Person – ganz kurz geschnitten trug; es sah schrecklich aus, wenn er bei dieser Kälte mit Eiszapfen unter der Nase herumlief. Da ging der lange Kerl jeden Tag zum Kaufmann und kaufte gemischte Bonbons, und er ließ sich viel Zeit dabei, denn er wollte gern mit den Leuten über das System und über den jüdischen Sozialismus diskutieren, die ja das Land verheerten. Viele amüsierten sich über seine Darlegungen. „Wie du das alles so im Kopfe hast, Marius! Wo hast du das nur her?“
Ja, wo hatte Marius das her? Er war nie ein strahlendes Talent gewesen. Er besaß ein paar Hühner und Gänse, und selbst die konnte er kaum bändigen. Sein Brot vermochte er damit nicht zu verdienen. Als er fünfzig Jahre alt war, hatte noch seine Mutter ihm die Nase putzen müssen, und er hatte nur des Sonnabends Bonbons bekommen. Seine Mutter war eine kleine, fleißige Frau gewesen, die es verstanden hatte, den großen Sohn zu einer Art Arbeit anzuhalten. Als sie starb, hörte er damit auf. Und seine sonderbare Leidenschaft für Damenhöschen hatte ihn mehreremal in Ungelegenheiten gebracht, seit sie nicht mehr auf ihn aufpassen konnte.
Nicht Weisheit und geistige Gaben waren es, die Marius jetzt so merkwürdig auftreten ließen. Aber er war Arier, und das konnte ihm niemand nehmen. Er gehörte der nordischen Edelrasse an, der es bestimmt war, die Welt zu beherrschen. Auf irgendeiner Versammlung hatte er von diesen Dingen gehört, und es mußte ihn wohl tief ergriffen haben, ein Wesen von Wert zu sein und der Herrenrasse anzugehören. Seit kurzer Zeit hielt er sich eine nationalsozialistische Wochenzeitschrift, und aus dieser schöpfte er seine Philosophie. Er las nicht leicht und flüssig, er folgte den Zeilen mit dem breiten schwarzen Zeigefinger und buchstabierte halblaut, während er von jüdischen Untermenschen – wie zum Beispiel Albert Einstein – las, deren Ausrottung notwendig war, wenn die menschliche Rasse nicht verunreinigt werden sollte.
Marius kannte die Juden, und er wußte, wie sie waren. In seiner Kindheit hatte sich in der Gegend von Zeit zu Zeit ein alter Jude gezeigt, der lange, zerlumpte Kleider trug, einen grauen Bart hatte und schwarze, funkelnde Augen. Er wanderte von Haus zu Haus und verkaufte Seife. Seine Ware führte er in einem hohen, rostigen Kinderwagen mit sich, und wenn man nichts kaufen wollte oder seine Seife gar kritisierte, geriet er in furchtbaren Zorn und schimpfte laut und grob. Dieser hitzige alte Mann war der Schrecken seiner Kindheit gewesen, und seine Mutter drohte damit, daß der Jude ihn holen würde, wenn er nicht artig sei. So waren die Juden.
Die gemischten Bonbons waren nicht mehr so wie in Marius’ Kindheit, als er vom Kaufmann jeden Sonnabend eine Tüte voll gratis bekam. Damals waren die Bonbons angenehmer im Geschmack gewesen und schöner in Form und Farbe. Es ging eben abwärts, mit den Bonbons und mit allem anderen. Auf allen Gebieten machten sich Verfall und Degeneration bemerkbar.
„Daran ist bestimmt das ,System‘ schuld“, sagt der Kommis. „Du wirst sehen, Marius, es sind die Sozialisten und Juden, die deine Bonbons verhunzen!“ Und die Leute im Laden amüsierten sich über Marius.
Aber Marius war nicht mehr der Mann, über den man sich amüsieren durfte. Schon bald kam die Zeit, wo man mit Höschen-Marius und seinesgleichen rechnen mußte. Er lutschte Bonbons und hatte Rotz im Schnurrbart. Doch er ging selbstbewußt und würdig die weiße Dorfstraße entlang. Er stampfte in neuen Schaftstiefeln dahin und stieß seinen Stock grimmig in den Schnee. Wartet nur, die Zeit kommt, da die Köpfe rollen werden!