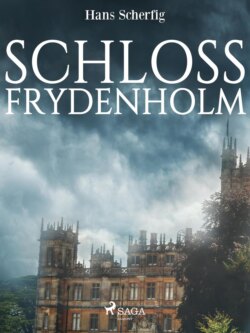Читать книгу Schloss Frydenholm - Hans Scherfig - Страница 22
19
ОглавлениеAuf der Landstraße, die durch Frydenholm führt, rollte eine lange Kolonne deutscher Militärfahrzeuge. Es waren kleine, dunkelgrüne, geschlossene Wagen ohne Fenster; sie ähnelten Leichenwagen.
Die Leute sahen sie von ihren Häusern aus, und ihnen war unbehaglich zumute. Die alte Emma, die in ihrem Garten werkelte, drohte ihnen böse. Höschen-Marius stürzte aus dem Haus, stand am Straßenrand stramm und grüßte auf germanisch mit ausgestrecktem Arm. „Heil!“ rief er zu den geschlossenen Autos hin. „Heil!“
„Mutti, komm, Mutti! Sieh mal, deutsche Autos! Beeil dich!“ riefen Gerda und Niels.
„Kommt sofort ins Haus! Aber schnell!“ sagte Margrete und zog die Kinder hinein. Durch das Fenster sah sie die dunklen, fensterlosen Autos, und sie empfand ein seltsames Grauen.
Danach wußte sie nicht recht, ob sie geträumt hatte oder ob ein alter Angsttraum nun plötzlich Wirklichkeit geworden war. Diese lange, unheimliche Kolonne dunkelgrüner, deutscher Leichenwagen – Margrete glaubte, sie schon einmal gesehen zu haben.
Es war ein strahlender Sonnentag. Die Lerchen sangen hoch im Blau. Es war Frühling und rundum grün und herrlich. Und Margrete fühlte quälende Angst, die ihr das Herz zusammenpreßte.
Später fuhren einige deutsche Pferdewagen durch das Dorf. Es waren merkwürdige, altmodische Wagen mit Verzierungen und Schnitzereien; wahrscheinlich Bauernwagen, die man in Polen erbeutet hatte. Einer davon hielt vor Emmas Haus, ein deutscher Soldat sprang herab und fragte sie etwas.
„Ich verstehe nicht, was du sagst“, antwortete Emma.
„Und ich will nichts mit euch zu tun haben! Verschwindet!“
Der Wagen fuhr weiter und hielt vor Jens Olsens Hof.
„Eier!“ sagten die deutschen Soldaten zu Jens Olsen.
„Jawohl, das bin ich. Ich bin der Besitzer 4 “, sagte der Bauer.
„Haben Sie Eier?“ fragte ein Deutscher. „Wir wollen Eier kaufen!“ Und da Jens Olsen nicht verstand, begann der Deutsche wie ein Huhn zu gackern.
„Ich glaube, er will Eier haben, sagte die eine von Jens Olsens dicken Töchtern.
Und Jens ließ das Mädchen einige Eier holen. Die Deutschen schlürften sie roh. „Danke schön“, sagten sie. Und: „Bitte schön!“ Sie reichten Jens Olsen einen Fünfkronenschein und gaben ihm zu verstehen, daß es so stimme. Jens Olsen besah den Schein, der war dänisch und echt, und steckte ihn in sein Portemonnaie. „Das war doch eine gute Bezahlung! Hihi! Das sind ja nette Leute!“
„Wie, zum Teufel, kommst du nur auf den Gedanken, die Deutschen zu füttern?“ fragte Martin ihn wenig später.
„Ich war doch dazu gezwungen. Sie hätten mich sonst vielleicht erschossen. Ich habe doch die Gewehre in ihrem Wagen gesehen. Übrigens haben sie ja ganz gut bezahlt, fünf Kronen für ein paar Eier! Sie haben mir einen richtigen dänischen Fünfkronenschein gegeben. Ich habe sie ganz schön an der Nase herumgeführt, hihi!“ Jens Olsen lachte und blickte Martin verschmitzt an.
„Man sollte sich schämen, etwas mit ihnen zu tun zu haben“, sagte Martin. „Man muß so tun, als wären sie gar nicht da. Man sollte sie nicht sehen und nicht hören und nicht mit ihnen sprechen!“
„Es waren nette Leute“, verteidigte sich Jens Olsen. „Wirklich nette junge Menschen. Man braucht doch schließlich kein Fanatiker zu sein. Es war ganz interessant, mit ihnen zu sprechen. Ich habe sie recht gut verstanden. Unser dänisches Wort Besitzer zum Beispiel bedeutet auf deutsch Hühnereier. Man kann deutlich hören, wie die Sprachen sich ähneln. Und trotzdem ist es merkwürdig, daß dasselbe Wort etwas ganz anderes bedeuten kann.“
Später erzählte Jens Olsen den Leuten: „Ja, ich habe mich da ein bißchen mit den Deutschen unterhalten. Es ist ganz interessant, wenn man ein bißchen was von der Sprache versteht.“
Es geschah nicht viel. Die Schule wurde nicht geschlossen, wie es die Kinder gehofft hatten. Der lange Anton durfte sein Jagdgewehr behalten. Die Zeitungen erschienen. Auch das „Arbejderbladet“ erschien. Johanne trug sie des Sonntags aus, und Dr. Damsø kaufte jetzt wieder das „Arbejderbladet“, um zu sehen, was man dort schrieb. „Aber die schreiben wohl das gleiche wie alle anderen“, meinte er.
Die Leute hatten ihre Gärten in Ordnung gebracht, und sie hatten gesät, trotz der Deutschen. Und die Kartoffeln keimten, und die Erbsen und der Salat und die Mohrrüben gingen auf wie gewöhnlich. Der Milchmann kam des Morgens, und das Bäckerauto kam; es fuhr ohne Motor, ein Pferd war davorgespannt. Das sah seltsam aus. Jeden Donnerstag kam der Fischmann mit seinem Lieferrad, doch die Leute wollten keine Fische kaufen. Er brachte den ersten Hornfisch des Jahres, und die Leute sagten: „Pfui Teufel, die haben ja grüne Gräten, die haben die Uniformen mitgefressen!“
Im Skagerrak waren ein paar deutsche Transportschiffe auf der Fahrt nach Norwegen gesunken. Zehntausend deutsche Soldaten sollten in den Laderäumen ertrunken sein. Das Meer spülte viele Leichen an die Küste. Sie wurden in Gummisäcke gesteckt und nach Deutschland zurückgeschickt. Eisenbahner erzählten, daß Tag für Tag lange Güterzüge mit solchen Gummisäcken durch Jütland rollten. Der Führer habe feierlich gelobt, jeder gefallene deutsche Held solle in der heiligen Heimaterde ruhen.
„Auch diese zehntausend jungen toten Deutschen waren Menschen“, sagte der alte Lehrer Tofte. „Sie sind kleine Schulkinder gewesen mit Taschen und Tafeln und Federkästen, genau wie die dänischen Kinder. Sie haben ein Ziel im Leben gehabt, jeder von ihnen!“ Lehrer Tofte konnte nicht um zehntausend Tote trauern, aber er trauerte um jeden einzelnen. Er stellte sich vor, wie jeder einzelne aussah. Ein junger Deutscher unterschied sich bestimmt nicht von einem Dänen. Und Tofte dachte an den jungen Seemann, der in seine Schule gegangen war, der Sommersprossen und struppiges hellblondes Haar gehabt, der immer gelacht und sich über etwas gefreut hatte und der einer der Namen und eine der Nummern auf der Liste der ertrunkenen dänischen Seeleute war.
Tofte war schon Lehrer an der Frydenholmer Schule gewesen, als sie noch ganz klein und altmodisch und nur eine Zweiklassenschule war. Da es nur den einen Lehrer gegeben hatte, war die Einheitlichkeit im Unterricht und der Zusammenhang zwischen den Fächern jederzeit gewahrt worden; die Leute fanden, daß die Kinder bei Tofte viel gelernt hatten. Das Besondere an ihm war, daß er die Kinder gern hatte. Er kannte alle Einwohner und sah sie vor sich, wie sie einmal gewesen waren, als sie in kleinen Holzschuhen zur Schule rannten. Und er verzieh ihnen vieles, weil sie seine Kinder gewesen waren. Alles, was Kinder erlebten, war für sie bedeutungsvoll. Nichts war gleichgültig. Ein kleines Lackbild als Belohnung für richtig gelöste Rechenaufgaben war ein großes Glück. Ein Hopsestein, der entzweiging, war ein großes Leid. Der Schulausflug mit Pferdewagen zum Strand bei Præstø war einer der Höhepunkte des Lebens. Dort geschah zwar nichts anderes, als daß die Kinder draußen im Grünen rote Brause tranken und hinterher ein paar Stunden lang einen kleinen Hügel hinauf- und hinunterliefen, doch die Erwartung bewegte das Gemüt so stark, daß man des Nachts nicht schlafen konnte vor Aufregung. Das Leben war so wichtig, es durfte niemals gleichgültig werden.
Tofte war längst pensioniert, und die Schule war größer und modern geworden. Jetzt war sie Zentralschule, hatte große Klassen und viele Lehrer, die sich auf Psychologie verstanden, Auto fuhren und viele Nebenbeschäftigungen ausübten. Nicht alle von ihnen hatten Kinder gern. Die Schule wurde jetzt von einem Direktor geleitet, der Macht besaß und administrative Fähigkeiten hatte. Als Kirchensänger war Tofte von dem jungen Lehrer Agerlund abgelöst worden, der ein Sportler war und ein Bahnbrecher. Er war es auch gewesen, der „Pelle der Eroberer“ und „Ditte Menschenkind“ ins Feuer warf, als in der kleinen Parkanlage die Finnlandfeier abgehalten wurde.
Ab und zu kam es noch vor, daß Tofte einen Lehrer vertrat, der krank war oder einen Psychologiekursus besuchte.
Sonntags gingen Lehrer Tofte und seine Frau in die Kirche und sangen die Psalmen mit. Es waren nicht viele da zum Singen. Die Schule war soviel größer geworden, aber die Gemeinde in der Kirche kleiner. Damals, als Tofte noch Küster war, hatte es mehr Kirchgänger gegeben. Pastor Nørregaard-Olsen hatte im Rundfunk mehr Erfolg als in seinem Kirchspiel. Da stand nun dieser Mann, dessen Stimme Tausenden von Hörern bekannt war, in seiner Kirche und sprach zu fünfzehn Menschen.
„Dänemark wird in diesen Tagen geprüft“, sagte er. „Gott hat seine Hand zum Schlag erhoben. Unser Volk steht vor dem Tore von Damaskus. Gottes Licht ist wie ein Blitz auf dieses trotzige Volk gefallen.
Was die Menschen säen, werden sie auch ernten. Gott läßt sich nicht spotten. Hat man in der vergangenen Zeit nicht Gott und seine Kirche geringschätzig verhöhnt? Antichristliche Minister haben unser Land mit Gesetzen überschwemmt. Das dänische Volk sollte in aller Stille zu einem heidnischen Volk gemacht werden. Mit der Demokratie und der Mehrheit im Rücken haben gottlose Minister gottlose Gesetze gemacht. Sie haben sich gegen den Herrn und seine Gesalbten verschworen.
Am neunten April hat der Blitz uns getroffen. Plötzlich, betäubend. Aber blendend klar beleuchtet sein Licht uns und unser vergangenes Leben. War das nun Satans Schlag oder war es ein Schlag Gottes? Ja, was war denn Christi Tod am Kreuze? War es Satans Hand, die sich zum Schlag erhob, oder die Hand Gottes?
Der Blitz hat uns getroffen. Das Licht umstrahlt uns. ,Was willst du, daß ich tun soll?‘ hat Saulus gefragt. Was willst du, Herr, daß wir tun?
,Es wird dir schwer werden, wider den Stachel zu lecken‘, verkündete Gott durch den Lichterglanz. Es wird diesem Volk schwer werden. Aber seht, der Weg liegt offen vor euch: Zurück zu Gott! Von Gott gelenkte Gesetzgeber und ein von Gott gelenktes Volk! Wenn wir das wollen, dann haben wir um Gottes Barmherzigkeit willen eine Zukunft vor uns. Doch wenn wir den Weg der Gottlosigkeit wie in den vergangenen Jahren auch in der Zukunft gehen wollen, dann wird Er in Zorn zu uns sprechen und uns mit seinem Zorn entsetzen!
Unser dänisches Volk steht vor dem Tore. Dahinter liegt das Heil unseres Volkes!“
„Das konnte man wohl eine gewaltige Predigt nennen“, sagte Pastor Nørregaard-Olsen wenig später zu seiner Frau.
„Am Freitag für den Rundfunk kannst du sie wohl kaum gebrauchen“, antwortete sie.
„Nein. Für den Rundfunk kann ich sie wahrhaftig nicht gebrauchen! Meine derben Worte über gottlose Minister und gottlose Gesetze würden unserem guten Kaspar Bobbel bestimmt nicht gefallen. Aber hier, in Gottes eigenem Hause, darf ein Pfarrer wohl wagen, offen und dreist wie Meister Ole Vind 5 zu sprechen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Für den Rundfunk muß ich natürlich etwas anderes machen. Ich würde ja gern einmal Harald das Manuskript dieser Predigt zeigen, um zu hören, was er dazu meint. Ich kann mir gut denken, was er sagen würde. Ich glaube, er würde mit dem Psalmisten sagen: Ihr seid ein braver Gottesmann und predigt, wie Ihr müßt!“
Aber Harald Horn kam vorläufig nicht zu Besuch in das Pfarrhaus. Er hatte in der Hauptstadt mehr als genug zu tun mit vielen neuen Freunden, mit viel Schreiberei, mit Versammlungen und Vorträgen und mit gesellschaftlichen Verpflichtungen. In der „Danmarkstidende“ schrieb er Artikel über den Kulturbolschewismus und nannte darin die Namen der Schriftsteller, deren zersetzende Tätigkeit in einer Zeit der nationalen Besinnung und der germanischen Gemeinschaft nicht länger geduldet werden könne. „Ihr roter Stern ist im Sinken!“ schrieb er prophetisch. Er hielt Reden und wöchentlich einen Rundfunkvortrag über den nordischen Geist im germanischen Raum, er war eifrig und unermüdlich und auf der Höhe der Zeit.
Da blieb auch nicht ein Tag für Ferienreisen oder stille Stunden im Pfarrhof. Zudem war es beschwerlich geworden, im Lande zu reisen. Es verkehrten weniger Züge, und die Abteile waren überfüllt und ungemütlich. Benzin für Privatwagen gab es nicht; sie mußten in den Garagen aufgebockt werden, standen da und veralteten. Die Autobesitzer mußten sich in kollektiven Verkehrsmitteln unter geringere Menschen mischen, und sie saßen in den Zügen und Straßenbahnen und ließen sich anmerken, daß sie Besseres gewohnt waren. Benzin gab es nur für lebenswichtige Fahrten.
Der gelbe Autobus fuhr mit einem Gasgenerator; ein rauchender Kachelofen an der Rückwand und Säcke mit Buchenklötzchen und Torf auf dem Dach. Von Zeit zu Zeit mußte der Fahrer anhalten, auf das Dach klettern, mit einer Eisenstange im Kachelofen rühren und Heizmaterial nachschütten. Daß man auf diese Art fahren konnte, war ein technisches Wunder.
Aber François von Hahn kam in einem richtigen Benzinauto nach Frydenholm, seine Fahrten waren wohl ebenso lebenswichtig wie die des Arztes. Auch deutsche Offiziere kamen in großen, eleganten Autos nach Frydenholm. Fliegergeneral Leonard von Kaupisch in eigener Person kam nach Frydenholm, aß im Schloß zu Mittag und übernachtete in dem historischen Himmelbett, während deutsche Soldaten und dänische Gefolgsleute Wache hielten. Es gab Festlichkeit und Vornehmheit und Betrunkenheit wie in alten Zeiten, als der Schwedenkönig und Oberst Sparre und seine Dragoner Frydenholm besuchten. Graf Rosenkop-Frydenskjold war ein lustiger und verschwenderischer Wirt, wie auch seine Vorfahren es gewesen waren.
Am Abend, wenn die Fenster der kleinen Häuser im Dorf mit schwarzem Papier verdunkelt sind, strahlt das Licht aus den Fenstern des Schlosses, und Musik und Gesang klingen weit über das Land. Die Leute stehen im Dunkeln an der Gittertür und sehen hinauf zu der Herrlichkeit. Höschen-Marius steht dort mit offenem Mund und feuchter Nase und reckt den Hals. Und ein paar von Niels Madsens Fürsorgejungen stehen dort und starren. Einer von ihnen hat eine unsympathische Physiognomie, eine gebrochene Nase und einen lauernden Blick.