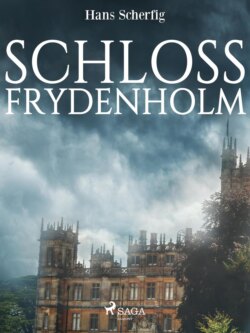Читать книгу Schloss Frydenholm - Hans Scherfig - Страница 23
20
ОглавлениеDr. Damsø hatte ein Menschenalter lang treu das „Dagbladet“ abonniert. Nun bestellte er es ab.
Er setzte sich hin und schrieb eine ausführliche Begründung zu diesem Schritt. Er schrieb sie mehreremal um, gab sich erhebliche Mühe dabei, las sie sich dann selbst vor und war nicht unzufrieden mit seinem Schreiben, das er an Chefredakteur Jens Angvis adressierte.
Angvis hatte sich gewissenhaft an die Instruktionen gehalten und einen Leitartikel verfaßt, in dem er feststellte, daß nur Englands Haltung und Maßnahmen die Ereignisse im Norden ausgelöst hätten. Vieles deute darauf hin, daß Churchill in seiner Auffassung beharre, die skandinavischen Länder seien eine gute Operationsbasis gegen Deutschland. Doch man habe in London nicht mit der Schnelligkeit und dem Wagemut der Deutschen gerechnet.
Die Deutschen hatten nichts gegen den Artikel einzuwenden, aber die dänischen Leser des „Dagbladet“ verhielten sich überraschend. Nicht nur Dr. Damsø bestellte die Zeitung ab. Fast zehntausend Abonnenten reagierten ebenso, und viele von ihnen begründeten ihren Schritt wie Dr. Damsø in langen, wohlüberlegten Briefen an die Redaktion.
Chefredakteur Angvis war erstaunt. Er verstand seine Landsleute nicht. Hatten sie noch nicht begriffen, daß Dänemark von den Deutschen besetzt war? Da bestellten die Leute einfach die Zeitung ab. Zehntausend! Gut, das durften sie. Alle konnten die Zeitung abbestellen, wenn sie es wollten. Dann ging die Zeitung ein. War es das, was sie wollten? Dann würden sie statt des „Dagbladet“ deutsche Zeitungen bekommen!
Der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft war besorgt und berief eine Tagung ein, um über die Sache zu beraten. Sich den neuen Zuständen im Lande anzupassen schien schwieriger zu sein, als man erwartet hatte. Der Redaktion wurde dringend empfohlen, in Zukunft etwas geschickter vorzugehen. Deutsche Gefühle dürften selbstverständlich unter gar keinen Umständen verletzt werden, aber man sollte doch auch ein wenig Rücksicht auf die dänischen Abonnenten nehmen.
Als Ausdruck der dänischen Gesinnung des „Dagbladet“ brachte man nun in jeder Ausgabe Bilder des Königs. Der tägliche Spazierritt des Königs wurde wie eine bedeutungsvolle nationale Tat beschrieben. In dieser für Dänemark so ernsten Zeit ritt unser König! Konnte es etwas Stärkendres und Aufmunternderes geben? Dort ritt er. Ein Vorbild und ein Beispiel für sein Volk, so saß er zu Pferde. Dieses Reiten glich einem Versprechen, das König und Volk sich gaben. Es war wie ein wärmender Handschlag. Kerzengerade ritt der König. Er glich der brennenden Kerze, nach der alles Lebende sich in der Nacht umschaut. Ein Lichtschimmer, Feldzeichen des Volkes. Seht, so soll ein König sein! schrieb „Dagbladet“.
Redakteur Jens Angvis kam auf den Gedanken, im „Dagbladet“ müsse ein Gedicht über den reitenden König erscheinen, und verständigte den Lyriker der Aktiengesellschaft, Ole Jastrau. Der Dichter hatte sich in den zwanziger Jahren durch ekstatische Revolutionsgedichte einen Namen gemacht. Er war es auch, der am Ostermorgen des Jahres 1920 von der Treppe der Marmorkirche herab vor einem Haufen Studenten die Räterepublik ausgerufen hatte, ohne daß die Polizei es für notwendig hielt einzuschreiten. Nun war er Gelegenheitsdichter für das „Dagbladet“. Sein Spezialgebiet waren Familienangelegenheiten des Königshauses, im übrigen war er für alles verwendbar, was sonst noch anfiel. Er war der Mann, der kurzfristig das Gedicht über den reitenden König liefern konnte.
Ole Jastrau dichtete. Er saß in seinem schmalen Redaktionsbüro und formte schwitzend und schnaufend Strophen. Was reimte sich auf reiten? Nein, das ging nicht. 6 Als der Reim endlich sich zu glätten und zufriedenstellende Formen anzunehmen begann, klopfte es an der Tür.
„Wer zum Teufel ist da? Ich will nicht gestört werden! Ach, du bist es, Vuldum.“
Sein Kollege Arne Vuldum stand, einen englischen Bowler auf dem Kopf, einen Regenschirm in der Hand, groß und spöttisch lächelnd vor ihm. „Oh, mein Herr, störe ich etwa?“
Der schwitzende Jastrau sah seinen Kollegen böse an. „Selbstverständlich störst du! Was willst du? Falls du Geld borgen willst, ich habe keins!“
„Lieber Freund, ich sehe, du dichtest, und ich merke, du bist reizbar“, sagte Arne Vuldum mit leichtem Oxfordakzent. „Ich will dich nicht aufhalten. Ich wollte dir nur in aller Höflichkeit die Abendausgabe des ,Morgenbladet‘ überreichen.“
„Leg sie hin und laß mich in Frieden!“ sagte Jastrau.
„,Morgenbladets‘ Abendausgabe bringt heute ein Poem, das dich bestimmt ergreifen wird. Aber du dichtest ja selbst gerade und bist in gereizter Stimmung, da will ich mich lieber rasch zurückziehen.“ Vuldum entfernte sich, ließ aber die Zeitung vor dem Schreibenden liegen. Sie war so gefaltet, daß Jastrau unter allen Umständen ein großaufgemachtes Gedicht sehen mußte, das den Titel trug: „Der König reitet.“ Das „Morgenbladet“ war wieder zuvorgekommen. Ein konkurrierender Lyriker hatte das Gedicht über den reitenden König geliefert.
„Verdammt!“ knurrte Jastrau, zerknüllte das Manuskript und schleuderte es in den Papierkorb. Dann ging er in die Kantine.
„Dagbladet“ durfte den König nicht für sich allein haben. Wie er seine Tage verbrachte und wo er sich in den Ferien aufhielt wurde das Hauptthema der meisten Zeitungen, und seine Leistungen als Reiter wertete man plötzlich als eine nationale Kundgebung. Sein Porträt erschien Tag für Tag in den Zeitungen; es wurde auch als farbiger Sonderdruck verkauft. Man konnte den König auf Briefpapier, auf Lackbildern und als Puzzlespiel kaufen. Auch auf Papierservietten wurde er dargestellt, und seine Untertanen wischten sich den Mund mit ihm ab; das veranlaßte Redakteur Langeskov, einen Leitartikel zu schreiben, in dem er vor dem Mißbrauch von Papier in dieser papierarmen Zeit warnte.
Eine Firma begann, kleine Embleme mit dem Namenszug des Königs in Silber und Emaille herzustellen, und viele Leute waren darauf versessen, dieses Emblem im Knopfloch zu tragen, um ihre patriotische Gesinnung zu demonstrieren. Die Fabrikation von Königsemblemen wurde in dieser Periode der Warenknappheit und Stagnation ein blühendes Geschäft.
Während andere Menschen das Königsabzeichen trugen, steckte sich Arne Vuldum eine kleine englische Fahne ins Knopfloch und ging damit unbekümmert auf der Straße und in der Redaktion des „Dagbladet“ umher. Chefredakteur Angvis bemerkte das mit einiger Unruhe; er legte dem Literaten nahe, die britische Fahne mit Rücksicht auf seine Sicherheit und die der Zeitung zu entfernen. „Lieber Angvis, ich darf mir doch wohl Vorschriften in bezug auf meine Kleidung verbitten“, sagte Vuldum und behielt seine Knopflochfahne.
An Stelle des „Dagbladet“ ließ Dr. Damsø sich eine schwedische Zeitung schicken. Nun las er die Nachrichten zwar mit einigen Tagen Verspätung, aber mit weniger täglichem Ärger. Auch die schwedische Zeitung wurde im Wartezimmer des Doktors ausgelegt und an andere Leute verliehen. Die Leute hörten fast alle den schwedischen Rundfunk und gewöhnten sich an die Sprache.
Traurige Nachrichten waren es, die der Rundfunk brachte. Deutsche Truppen überfielen das friedliche Holland. Die offene Stadt Rotterdam wurde grausam bombardiert. Belgien wurde erobert. Die unüberwindliche Maginotlinie wurde rasch umgangen und bezwungen. Die Rundfunkhörer lernten neue Wörter und Begriffe kennen: aufrollen, einkesseln, Zangenbewegung, Sturzkampfflieger.
Man hörte das auf schwedisch, man hörte es auf dänisch. Und man hörte nach jedem deutschen Sieg die Sondermeldungen mit Trommelwirbeln und Fanfaren. Man hörte das Deutschlandlied und das Horst-Wessel-Lied und die Heilrufe. Und wenn ein neues Land überfallen worden war, hörte man Adolf Hitler zum deutschen Volk sprechen, und man hörte das Volk vor Begeisterung brüllen.
„Was wir wollen, ist nicht die Unterdrückung anderer Völker“, schrie der Führer, „es ist unsere Freiheit, unsere Sicherheit, die Sicherheit unseres Lebensraumes! Es ist die Sicherheit des Lebens unseres Volkes selbst. Dafür kämpfen wir!
Die Vorsehung hat bisher diesen Kampf gesegnet, tausendfältig gesegnet. Kann sie das getan haben, würde sie das getan haben, wenn es ihre Absicht wäre, nun plötzlich diesen Kampf zu unseren Ungunsten ausgehen zu lassen? Ich glaube hier an eine höhere und an eine ewige Gerechtigkeit. Die wird dem zuteil, der sich ihrer würdig erweist.“
Der dänische Universitätsprofessor Sigurd Pileus kommentierte das historische Geschehen im Rundfunk und machte Voraussagen über Dänemarks geopolitische Stellung in Neuropa und im Großraum. Der ebenso dänische Professor Poul Pferd sprach über den deutschen Mythos und den Nibelungengeist. Dr. Harald Horn hielt erfrischende Vorträge über die Entartungen des Kulturbolschewismus und über das Licht von Lübeck. Pastor Nørregaard-Olsen formte seine Sonntagspredigten um in Alltagsvorträge mit aktueller Tendenz, sprach von der Obrigkeit, die ihr Schwert nicht vergebens trägt, und davon, daß man dem Kaiser geben solle, was des Kaisers ist. Und es kamen gewaltige Wagner-Konzerte mit Orgelgetöse und Glockenklang und Harfengebraus aus dem Radio. Und es kam muntere Unterhaltungsmusik mit deutschen Soldatenliedern und Märschen. „Denn wir fahren, denn wir fahren, denn wir fahren gegen Engelland!“
Dr. Damsø ärgerte sich, daß man nicht auch das Radio abbestellen konnte, aber das ließ sich nicht machen, wenn man Schweden hören wollte und die dänischen Sendungen aus England, die man trotz der deutschen Störsender empfangen konnte. Aus den meisten Häusern war zu bestimmten Zeiten das seltsam gurgelnde Geräusch zu vernehmen, das von deutschen Rundfunksendern in Dänemark ausgestrahlt wurde, und durch dieses Geräusch drang die Stimme Leif Gundels aus London. Nur auf Niels Madsens Hof und in Höschen-Marius’ Haus spielte der dänische Rundfunk mit voller Lautstärke und stimulierte und ermunterte die Bewohner.
Wenn Höschen-Marius zum Kaufmann ging, um Bonbons zu kaufen, die nun rationiert und von schlechter Qualität waren, summte und brummte er ein deutsches Soldatenlied und marschierte danach. Er trug das runde Emailleabzeichen der DNSAP, ein weißes Hakenkreuz auf rotem Grund, und daneben das SA-Zeichen, eine runde Silberplatte mit den Runen S und A auf farbigem Untergrund; die Farbe gab an, in welcher SA-Division er Dienst tat. Vielleicht sah er sich schon, uniformiert und mit Orden behängt, an der Spitze eines siegreich einrückenden Heeres. „Denn wir fahren, denn wir fahren, denn wir fahren gegen Engelland!“ summte er.
Vor dem Laden des Kaufmanns wurde der Marschierende von Martin Olsen eingeholt. „Warte mal, nur ein paar Worte, Marius!“
Marius hörte auf zu summen und blickte Martin überrascht an. „Was willst du von mir?“
„Ich will dir nur sagen, daß du sehr bald die Jacke voll gehauen kriegst“, sagte Martin. „Wenn du auch ein gewaltiger Nazikerl bist, brauchst du noch lange nicht die Kinder zu belästigen! Wenn du nicht aufhörst, ihnen deine Schweinereien nachzurufen, dann kriegst du Dresche, daß du nicht mehr kriechen kannst!“
„Drohst du mir?“ fragte Marius.
Martin trat dicht vor ihn hin und hielt ihm seine große Faust unter den Schnurrbart. „Wenn du noch ein einziges Mal die Kinder belästigst, hau ich dir eins in die Fresse, daß du dein Gebiß und deine Bonbons zugleich verschluckst! Ist das deutlich genug? Hast du das verstanden?“
„Ja.“ Marius wich zurück. „Ja, ja. Nicht hauen!“
„Du kannst es ja noch mal probieren, du Nazischwein“, sagte Martin. „Dann wirst du was erleben!“
Vor dem Kaufmannsladen standen einige Leute. Sie hörten zu und freuten sich über den kleinen Auftritt. Im Laden wurde davon gesprochen, und bald sprach man im ganzen Dorf davon. Es gab so wenig Erfreuliches in diesen Tagen.
Als Marius den Laden betrat, rief der witzige Kommis ihm zu: „Heute haben wir keine Bonbons für dich, Marius! Die Deutschen haben alle Bonbons im Land beschlagnahmt!“
Evald rief das so laut, daß alle es hörten.