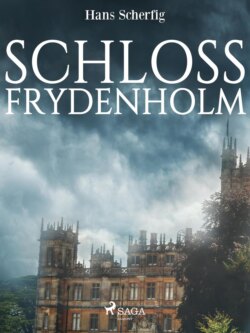Читать книгу Schloss Frydenholm - Hans Scherfig - Страница 14
11
ОглавлениеNoch im März staken die Fähren im Eis fest. Seeland war von Europa abgeschnitten. Und trotz Osterferien und Verkehrsschwierigkeiten trat das Folketing zusammen und beschloß, das Gesetz zu verlängern, das eine zentrale Warmwasserversorgung und Zimmertemperaturen von mehr als achtzehn Grad Celsius verbot.
Draußen auf den eisfreien Meeren wurden die Schiffe des Landes von den Deutschen versenkt. Es war schon angenehmer, zu Hause zu sitzen, mochte das Eis auch Schwierigkeiten bereiten und das Heizmaterial knapp sein. Und doch war die Kälte für viele sehr schlimm, auch wenn die Ärzte im Rundfunk behaupteten, sie sei gesund.
Pastor Nørregaard-Olsen sprach in seinen Sonntagspredigten über die alte, erprobte Wahrheit, daß dem Winter der Frühling folge. So sei es immer gewesen, und so werde es immer sein. Gott halte sein Wort. Er mogele nicht. Dem Winter folge der Frühling.
Aber der Schnee stob über das Land, mächtige Schneewehen versperrten die Straßen. Der gelbe Linienbus fuhr zwischen Wänden von Schnee dahin. Die kleinen Gartenzäune und die mißhandelte Ligusterhecke der alten Emma waren begraben. Eigentlich müßte man in den Gärten schon säen und Zwiebeln stecken. Und die Bauern müßten mit der Frühjahrsbestellung anfangen. Alles verspätete sich in diesem Jahr. Man konnte bereits jetzt beginnen, über die Ernte zu jammern. Und das viele Eis, das das Land einschloß und es abkühlte! Die alte Emma war in ihrem Leben noch nie von Seeland heruntergekommen; doch nun fühlte sie sich plötzlich unsicher, wenn sie daran dachte, daß die Fähren festsaßen.
Der gelbe Linienbus rollte zwischen weißen Wällen vorsichtig auf der glatten Straße dahin. Die Fahrgäste unterhielten sich über das Wetter und über die Mühen der Zeit. Sie kannten sich alle. Doch diesmal fuhr da ein Mann mit, den man seit langer Zeit in der Gegend nicht mehr gesehen hatte. Man wußte nicht sofort, wer es war, aber einer nach dem anderen erkannte ihn wieder, und die Leute guckten und flüsterten. Olsen, der als Diener auf Frydenholm gedient und den man des Mordes an Skjern-Svendsen verdächtigt hatte, saß in dem gelben Bus. Er war dicker geworden. Und er ging besser gekleidet. Er trug einen neuen Mantel mit Pelzkragen und eine Astrachanmütze. Ob er wieder nach Frydenholm kam? Ob er den neuen Grafen kannte?
Das Land sah noch im März wie auf einer Weihnachtskarte aus, überall Schnee und an den Häusern lange Eiszapfen. Aber es war ein anderer Himmel als im Winter, das Licht war anders. Die Stare hätten längst kommen müssen. Die Lerchen müßten schon singen. Und in den Gärten müßten die Krokusse blühen und an den Wegböschungen der Huflattich. Statt dessen gab es eingefrorene Wasserleitungen und Verkehrsschwierigkeiten. Man hatte noch nicht eine Kartoffel legen können, und die Saat erfror in den Mieten. Nur die Katzen fühlten den Frühling und schrien vor Geilheit bei fünfzehn Grad Kälte.
Der Linienbus mußte ganz dicht an den Schneewall heranfahren, um ein anderes Auto vorbeizulassen. „Das war sicher der Doktor“, meinte jemand im Bus. Ja, Krankheit gab es genug, obwohl das Radio sagte, es sei gesund, zu frieren. Der Doktor war ständig unterwegs. Auch er trug jetzt eine Pelzmütze. Er hielt vor den kleinen Häusern an, ging hinein und rieb sich die Hände, bevor er den Patienten berührte. „Na, wie geht es uns denn heute so?“
Die alte Emma wußte nicht, wie es uns geht. Sie konnte nur für sich allein antworten. Ihr ging es ganz und gar nicht gut. Die verteufelte Gicht wurde immer schlimmer. Ebenso die Ischias. Das zog und zerrte im ganzen Bein, bis hinunter in den Fuß, es war, als sei der große Hauptnerv geschwollen.
„Das ist doch Unsinn“, sagte der Doktor. „Es gibt keinen ,großen Hauptnerv‘. Das ist nichts als Aberglaube.“
„So“, brummte Emma. „So. Man hat keinen Hauptnerv mehr? Dann ist es wohl auch Aberglaube, daß es weh tut?“ Sie blickte den Doktor zornig an, beleidigt, daß man ihr nicht ihren großen Hauptnerv gönnte. Aber Schmerzen hatte sie jedenfalls, ganz gleich, was die Wissenschaft dazu meinte.
„Sie brauchen Wärme“, sagte Doktor Damsø. Emma fauchte: „Wärme! Mit dem Torf, den man heutzutage bekommt!“
„Wissen Sie, Emma, Sie könnten es im Altersheim doch viel besser haben“, sagte der Doktor. „Es ist warm und gemütlich dort. Und Sie hätten auch Gesellschaft. Dort sind noch andere Damen. Und man würde dort auf Sie aufpassen.“
„Ich kann selbst auf mich aufpassen!“
„Sie dürfen das nicht als Armenfürsorge betrachten“, redete der Doktor ihr zu. „Das ist nicht so etwas wie in alten Zeiten. Sie haben einfach ein Recht darauf, ein Recht wie wir alle. Sie haben doch selbst dazu beigetragen, das Altersheim zu bezahlen. Es ist unser Recht, dort zu wohnen, wenn wir alt sind.“
„Geht der Herr Doktor auch ins Altersheim?“ fragte Emma.
„Ich? Nein, ich weiß nicht. Ich bin ja noch nicht so alt. Noch nicht. Man soll ja nicht über das Alter der Damen sprechen, das ist mir bekannt, aber Sie sind doch bestimmt siebzig, wenn Sie auch jünger aussehen.“
„Ich bin achtundsiebzig.“
„Ja, dann haben Sie es aber wahrhaftig verdient, gemütlich und behaglich in unserem Altersheim zu wohnen“, sagte der Doktor.
„Ich habe mein eigenes Haus.“
„Aber das Altersheim ist ja auf eine Art auch Ihr Haus. Es ist unser aller Haus.“
„Und ich habe meinen Garten.“
„Zum Altersheim gehört ein wirklich schöner Garten.“
„Ich habe meine Sachen hier”, sagte Emma. „Ich will meine Sachen behalten.“
„Im Altersheim gibt es doch auch Möbel. Dort sind sehr schöne Möbel. Ein Architekt hat sie entworfen. Sie würden sich dort bestimmt wohl fühlen.“
„Ich will meine eigenen Möbel behalten“, beharrte Emma.
Emma besaß nicht gerade prachtvolle Sachen. Sie waren nichts wert. Da war eine wurmstichige Kommode mit Fotografien, einer Muschel und einem gehäkelten Deckchen darauf. Dann gab es noch einen schiefen Kleiderschrank, eine vom Schwamm befallene Waschtoilette, einen Tisch mit Fransendecke und ein paar wacklige Stühle. Die Katze lag auf dem besten. Ein wenig Gerümpel stand auf dem Boden, eine Truhe und ein altes Spinnrad. Es war viele Jahre her, daß jemand darauf gesponnen hatte. Emma würde kein elegantes Mobiliar hinterlassen, wenn sie ins Altersheim zog, wo es gute, geschmackvolle Sofas und Ledersessel gab und wo es hygienisch duftete.
Der Doktor sah sich in Emmas Stube um. Es roch nach Erde und Schimmel, nach Katze und alter Frau. Über der Kommode hing ein verblichener Öldruck, der den russischen Zaren Alexander und seine dänische Gemahlin darstellte. Er war so verblichen, daß nur noch die gelben und blauen Farben übriggeblieben waren. Weshalb mochte der hier hängen? Die Wand gegenüber schmückte ein eingerahmtes Blatt zum Gedenken an Frederik den Sechsten. „In seiner Güte löste er die Fessel des Bauern, und die Klage der Neger rührte ihn“, war darauf zu lesen. Rundherum waren vergoldete Weihnachtskarten angeheftet, die vor Fliegendreck starrten. Die Bibel lag aufgeschlagen auf der Tischdecke.
In den beiden Fenstern standen Blumentöpfe mit englischen Pelargonien, zwischen ihnen eine Porzellankatze. Die richtige Katze lag breit und riesengroß auf einem Kissen auf dem besten Stuhl und sah den Doktor aus schmalen Augen mißtrauisch an. „Ja, das ist meine einzige, kleine Kreatur“, sagte Emma. „Ich will meinen Manse behalten. Er ist genauso klug wie ein Mensch.“
„So, er heißt Manse? Wie groß er ist!“
„Ich will ihn nicht verlieren!“ sagte Emma. „Nein, ich will nicht.“
„Ist ja gut“, beruhigte sie der Doktor. „Uberlegen Sie es sich! Wie steht es mit den Pillen? Haben Sie noch welche? Na, ich verschreibe Ihnen neue. Sie sollen natürlich nicht heute oder morgen umziehen, ich rate Ihnen nur, es sich zu überlegen. Es wäre doch das beste für Sie.“
„Ich werde nirgendswo hinziehen!“ Emma war voller Starrsinn und Trotz und sah den Doktor, der doch nur ihr Bestes wollte, feindselig an. O dieses Mißtrauen der kleinen Leute! Diese eigensinnige Ablehnung von Fortschritt und Verbesserung! Man will diesen Menschen helfen, aber sie sträuben sich dagegen!
„Ja, ja. Das bestimmen nur Sie selbst“, sagte der Doktor geduldig. „Wir sind freie Menschen hierzulande.“
Dann setzte der Doktor seine Mütze auf, zog die Fausthandschuhe an und fuhr weiter zu einem Hof, wo eine Witwe wohnte, die an einem Ekzem litt.
Es war ein großer, schöner Hof. Die Witwe lebte mit ihrem vierzigjährigen Sohn zusammen. Er wollte sich schon seit langem verheiraten, aber die Mutter erlaubte es nicht. Sie wollte ihn nicht missen. Er mußte ihr Ekzem pflegen. Er schlief neben ihr im Doppelbett, und im Laufe der Nacht mußte er ihr einigemal den Rücken mit einer grauenhaften schwarzen Salbe einreiben. Sie konnte das nicht allein. Deshalb durfte der Sohn nicht heiraten.
Der Hof war gepflegt, die beiden waren wohlhabende Leute, die ihr Geld nicht verbrauchten, sondern sparten. Aber niemand würde sie beerben und kein Nachkomme Nutzen von ihrer Sparsamkeit haben.
„Sehen Sie“, sagte die Witwe. „Sehen Sie nur, wie ich mich schäle! Jeden Morgen kann ich eine ganze Müllschaufel voll Hautschuppen aus dem Bett heraustragen.“
Das Ekzem war wie eine Riesenschlange, die sich jede Nacht häutete. Und das war Verschwendung bei dieser geizigen Frau. Sie düngte ihre Topfpflanzen mit den Hautschuppen, damit Gottes Gaben nicht verlorengingen, und die Pflanzen gediehen davon. Der Doktor verschrieb ihr wieder schwarze Salbe, spritzte ihr B-Vitamin in den Schenkel und ließ sie weiße Tabletten mit Arsen essen, die sie fett machten. Und er dachte daran, daß es eine Tat der Barmherzigkeit wäre gegenüber dem vierzigjährigen Sohn, der so gern heiraten wollte, wenn er dieser Mutter eine größere Portion Arsen verschriebe. Doktor Damsø war ein hilfsbereiter und vorurteilsfreier Mann, aber er wollte kein Mörder sein. Er seufzte und schrieb das Rezept. Und der Sohn der Witwe konnte nicht heiraten.
Der Doktor fuhr weiter durch das Winterwetter. Die ältere von Jens Olsens dicken Töchtern hatte einen Bandwurm. Sie liebte Fleisch über alle Maßen, und wenn sie ein Schwein geschlachtet hatten, konnte sie sich nicht beherrschen und warten, bis es zubereitet auf den Tisch kam: Sie biß in das warme, rohe Fleisch des eben geschlachteten Tieres. Und nun fanden sich weiße Bandwurmglieder im Stuhl, die dem Doktor präsentiert wurden; der Wurm fraß ihr das Essen weg, so daß sie ständig unter Hunger litt.
Ja, da mußte streng gefastet werden, bis der Bandwurm ausgehungert war. Und dann sollte sie Salz und Pfeffer und Essig und scharfe Sachen zu sich nehmen, damit das Tier beleidigt wurde und Fräulein Olsens Darmwand losließ. Und dann sollte sie Rizinusöl trinken, damit das Ungeheuer ausgetrieben würde. Aber der Doktor war nicht sicher, ob das dicke, hungrige Mädchen charakterfest genug war, diese harte Kur zu Hause durchzuführen. „Es wird wohl besser sein, wenn ich eine Einweisung für das Krankenhaus schreibe. Sie können ruhig mit dem Bus dorthin fahren. Wegen dieses Bandwurms brauchen wir keinen Krankenwagen zu bemühen, wir sollen ja jetzt Benzin sparen. Wie ist bitte Ihre Krankenkassennummer?“
Auf der anderen Seite des Löschteiches war Martin Olsens Tochter Rosa an den Masern erkrankt; sie hatte hohes Fieber und phantasierte. Rosa war die Älteste und ging schon zur Schule; nun würden die anderen drei wohl auch die Masern bekommen. Das mußte eben überstanden werden.
„Aber seien Sie bloß vorsichtig! Danach kommt es sehr oft zur Lungen- oder Mittelohrentzündung. Sie muß mindestens noch fünf Tage im Bett bleiben, nachdem das Fieber vorüber ist. Und passen Sie auf die Augen auf! Das Fenster muß zugezogen sein, und um die Lampe muß rotes Papier gewickelt werden?“
Doktor Damsø setzte sich an den blanken, ovalen Tisch und machte Eintragungen ins Krankenbuch. In der Mitte des Tisches lag eine zierliche gestickte Decke, auf der eine versilberte Schale mit Weihnachtskarten und Neujahrsrechnungen stand. Die Stube war so niedrig, daß man an die Decke fassen konnte. Eine große, neue Wanduhr – mit Mahagonigehäuse – tickte laut. Sie wirkte sehr fremd in der niedrigen Bauernstube. Die Leute haben keinen Geschmack, dachte der Arzt.
„Wie alt ist Rosa denn schon? Sie ist ja schon ein großes Schulmädchen.“ War es wirklich so lange her, seit der Arzt geholfen hatte, sie zur Welt zu bringen? „Ja, wir werden alle älter. Und der Jüngste gedeiht gut? Er sieht ja prächtig aus.“ Er hatte so dicke Bäckchen, daß der Doktor mit dem Zeigefinger killekille machen mußte. Das amüsierte den Kleinen, das war ein guter Spaß, über den er lachen mußte. „Vielleicht ist er noch zu klein, und er bekommt die Masern gar nicht. Die Kleinen sind ja zumindest in den ersten vier Monaten immun, das heißt, wenn die Mutter die Masern gehabt hat. Und das hatte Margrete wohl?“
Das war das Gute an diesem Doktor, daß er sich die Zeit nahm, mit den Leuten zu reden. Er war nicht einsilbig und erhaben, sondern erzählte, wie es sich mit einer Krankheit verhielt. Er fand es auch nicht anstößig, wenn ein Patient zu wissen wünschte, worum es sich bei seiner Krankheit handelte. Der Doktor erklärte ohne Latein und Hochmut. Er war ein demokratischer Doktor. Und als er über die Masern alles ausreichend erklärt hatte, fand er es passend, seine Meinung über den Krieg in Finnland und über Martin Olsens Mitverantwortung auszusprechen.
Martin Olsen aber fühlte sich nicht schuldig. Er war mehr mit lokalen Angelegenheiten als mit der großen Politik beschäftigt. Er wußte viel über die Verhältnisse an den Arbeitsplätzen und über den Zustand der örtlichen Gewerkschaft. In der Gemeinde gab es viele Arbeitslose, es gab Probleme mit der Krankenkasse, dem Steuer- und dem Wohlfahrtsamt. Die Leute kamen zu ihm und fragten um Rat, er kannte die Gesetze, Vorschriften und Satzungen, doch über die deutschen Befestigungsanlagen an der finnischen Grenze wußte er nicht viel zu sagen. Er hatte nicht an der Sonnenwendfeier in der kleinen Anlage bei Skjern-Svendsens Monument teilgenommen, wo Rasmus Larsen und Pastor Nørregaard-Olsen Reden für Finnland gehalten hatten und wo Lehrer Agerlund unter großem Beifall Bücher von Martin Andersen Nexö ins Feuer geworfen hatte.
Martin Olsen fühlte sich nicht mit der finnischen Oberklasse solidarisch. Hegte der Doktor wirklich so große Sympathien für Mannerheim?
Doktor Damsø hegte Sympathie für ein kleines, tapferes Volk, das um seine Freiheit kämpfte.
Aber Martin Olsen war sich nicht so sicher, daß es dort wirklich um die Freiheit ging. Etwas anderes war es damals, als die finnischen Arbeiter gegen Mannerheims Weißgardisten kämpften. Aber jetzt? War die finnische Oberklasse nicht eng mit dem Nazismus verbündet? War es nicht so, daß die sogenannte Mannerheim-Linie sehr nahe bei Leningrad verlief? Lebensgefährlich nahe, wenn man damit rechnen mußte, daß Finnland in einem Krieg als Sprungbrett benutzt werden sollte? Man hatte Verhandlungen über eine friedliche Regelung angeboten, aber die finnische Oberklasse hatte die Provokation den Verhandlungen vorgezogen.
Der Doktor schnaubte: „Hören Sie auf, Mann! Das ist ja zu idiotisch! Glauben Sie etwa selbst daran, daß Finnland den zweihundert Millionen Russen gefährlich werden könnte? Glauben Sie, das kleine Finnland könnte das große Asien erobern? Daß Sie es überhaupt fertigbringen, so etwas zu sagen! Das ist wirklich zu schäbig!“
Vielleicht nicht Finnland allein, aber die Mächte, die hinter Finnland stehen. War die Mannerheim-Linie nicht ein deutsches Unternehmen?
„Ja aber, zum Teufel, Mann. Sie sind doch mit den Deutschen befreundet! Sie haben doch einen Pakt mit Hitler geschlossen! Sie dürften doch von Ihren Alliierten nichts zu befürchten haben!“
So war man wieder in der ewigen Diskussion. Nein, die Nazis sind keine Freunde der Alliierten! Es waren die Regierungen Chamberlains und Daladiers, die Hitler bewaffnet und ihm erlaubt hatten, ein Land nach dem anderen zu schlucken. Hatte die Sowjetunion nicht jahrelang versucht, das faschistische Deutschland zu isolieren? Hatte sie nicht angeboten, der Tschechoslowakei zu helfen, wenn auch die anderen helfen würden? Hatte Stalin nicht im vergangenen Jahr vorgeschlagen, ein Dreimächtebündnis mit England und Frankreich abzuschließen? Und war nicht jedes Angebot abgelehnt worden?
Ach, immer dieses Gerede! Immer diese politische Kannegießerei! Konnte man denn nicht mit eigenen Augen Stalin und Ribbentrop zusammen auf einem Foto sehen?
Na und? Hatte man nicht schon früher Bilder von Chamberlain und Hitler gesehen? Hatte man nicht München erlebt? Den Verrat an Spanien? Eine Kette von Verrat und Wortbruch!
„Ja“, sagte der Doktor. „Die Welt ist voller Lumperei. Aber daß Sie sich daran beteiligen wollen!“
Martin Olsen meinte nicht, an irgend etwas in Finnland beteiligt zu sein. Er war ein dänischer Arbeiter. Er fühlte sich mit den Arbeitern in der ganzen Welt solidarisch, aber nicht mit der finnischen Oberklasse. Es gab Reiche und Arme auf Erden. Es gab eine Oberklasse und eine Unterklasse. Es gab die wenigen, die die vielen ausbeuteten. Es gab Leute wie Skjern-Svendsen und den Grafen von Frydenholm, und es gab die vielen Menschen, die für sie arbeiteten und sie ernährten. Es gab die Schmarotzer, die von der Arbeit anderer lebten, und es gab die Arbeiter, die die Werte schufen. Das wußte Martin Olsen, und dazu konnte er Stellung nehmen. Über die Curzonlinie in Polen, über die strategischen Probleme in Finnland und über die Verhältnisse in Bessarabien konnte er nicht viel sagen. Aber es gab zwei Klassen von Menschen, in seinem eigenen Land und auch in anderen Ländern: die Kapitalisten und die Arbeiter. Er gehörte zur Arbeiterklasse, und was auch im Ausland geschehen mochte, er würde vom Standpunkt seiner Klasse aus dazu Stellung nehmen.
„Oh, diese Phrasen!“ rief der Doktor aus. „Diese ewigen, uralten Klischees! Martin Olsen hat seine Lektion gut gelernt! Oberklasse und Unterklasse! Kapitalisten und Proletarier! Ausbeuter und Ausgebeutete! Man wirft eine Münze in den Automaten, und schon spielt das Grammophon: Es gibt zwei Klassen! Es gibt zwei Klassen! Es gibt zwei Klassen!“ Pfui, er hätte ausspucken mögen, aber das wäre unhygienisch gewesen.
Und Margrete, die bemerkte, daß Martin auch heftig wurde, fragte rasch etwas über die Masern. Ob es nicht ein Serum gäbe wie gegen die Pocken oder so wie damals, als die Kinder den Keuchhusten hatten.
„Nein“, sagte der Doktor.
Margrete glaubte, etwas davon gehört zu haben ...
„Ja, es gibt schon ein Serum, das aus dem Blut von Patienten gewonnen wird, die die Krankheit gerade überstanden haben; aber es ist teuer, und es gibt nur sehr wenig davon. Es darf nur den Kindern gegeben werden, die an Tuberkulose leiden oder an etwas anderem, das es besonders gefährlich für sie macht, an Masern zu erkranken. Aber Ihre Kinder sind ja gesund und stark, da ist keine Gefahr. Es muß nur überstanden werden. Behalten Sie Rosa aber noch einige Tage im Bett, nachdem sie fieberfrei ist – am besten fünf, sechs Tage, wenn Sie die Kleine dazu bringen können!“
Und als der Doktor ging, sagte er: „Vergessen Sie nicht, rotes Papier um die Lampe zu wickeln und die Fenster zuzuziehen. Sie müssen auf die Augen des Mädchens achtgeben. Es reicht eben nicht, daß Sie selbst immer eine rote Brille tragen!“
Dann fuhr er weiter zur nächsten Patientin. Draußen am Moor lebte eine Frau, die entsetzlich an Ausfluß litt.
Der gelbe Linienbus hatte am Dorfkrug, der historisch war wie viele andere, Endstation. Dort ruhte er sich eine Weile aus, der Chauffeur aß im Krug seine belegten Brote, trank dazu eine Tasse Kaffee-Ersatz und las in der Kreiszeitung von den neuesten Unglücksfällen.
Und Olsen ging mit neuem Mantel und Pelzmütze die Allee nach Frydenholm hinauf.