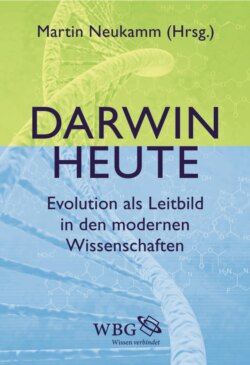Читать книгу Darwin heute - Harald Lesch - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.8.1 Evolutionäre Erkenntnistheorie
ОглавлениеDie kognitiven Leistungen des Menschen sind erstaunlich. Man kann diese Leistungen als gegeben hinnehmen; man kann aber auch fragen, wie es eigentlich kommt, dass wir die Welt so gut erkennen können. Klassische Erkenntnistheoretiker waren sogar der Meinung, dass es sicheres Wissen über die Welt gebe, und versuchten, diese Sicherheit nachzuweisen und zu erklären. Skeptiker folgen ihnen darin nicht mehr. Angesichts von Vergesslichkeit, Sinnestäuschungen, Fehlschlüssen und vielen Irrtümern kann man natürlich auch fragen, warum unser Erkenntnisvermögen nicht noch besser ist. Warum sind wir nicht klüger? lautet dementsprechend der Titel eines Buches von NICHOLAS RESCHER. Die Evolutionäre Erkenntnistheorie versucht, auf beide Fragen eine Antwort zu geben. Ihre Hauptthesen lauten:
Denken und Erkennen sind Leistungen des menschlichen Gehirns, und dieses Gehirn ist in der biologischen Evolution entstanden – als Überlebensorgan, nicht als Erkenntnisorgan. Unsere kognitiven Strukturen passen (wenigstens teilweise) auf die Welt, weil sie sich – phylogenetisch – in Anpassung an diese reale Welt herausgebildet haben und weil sie sich – ontogenetisch – auch bei jedem Einzelwesen mit der Umwelt auseinandersetzen müssen. So können wir Leistungen und Fehlleistungen unseres Gehirns erklären. Der Evolutionsbiologe GEORGE G. SIMPSON (1902–1984) drückt es sehr bildhaft aus: „Der Affe, der keine realistische Wahrnehmung von dem Ast hatte, nach dem er sprang, war bald ein toter Affe – und gehört deshalb nicht zu unseren Urahnen.“21
Ein besseres Erkenntnisvermögen – schärfere Sinne, genauere Vorstellungen, besseres Gedächtnis, zuverlässigere Folgerungen, damit auch bessere Prognosen, mehr Selbstkritik – ist zwar denkbar, wäre aber aufwendiger. Um in der Evolution Erfolg zu haben, muss man eben nicht perfekt sein, sondern nur etwas besser als die Konkurrenz.
Der Vater der Evolutionären Erkenntnistheorie ist der deutsche Verhaltensforscher KONRAD LORENZ (1903–1989), vor allem durch sein Buch Die Rückseite des Spiegels von 1973. Ihren Namen erhielt sie jedoch von dem Psychologen DONALD T. CAMPBELL, der damit Ideen des Philosophen KARL POPPER (1902–1994) charakterisieren wollte. Poppers Interesse galt jedoch mehr der Wissenschaftstheorie, sodass man seine Lehre eher als Evolutionäre Wissenschaftstheorie bezeichnen sollte.
Eine wichtige Denkfigur der Evolutionären Erkenntnistheorie ist der Mesokosmos. Das ist der Ausschnitt der realen Welt, den wir erkennend, also wahrnehmend, erfahrend, rekonstruierend und handelnd überblicken und intuitiv bewältigen. Es ist eine Welt der mittleren Dimensionen.
Wir können diesen Mesokosmos verlassen; dazu benötigen wir jedoch zusätzliche „Denkzeuge“ wie Sprache, Schrift, Logik, Mathematik, Algorithmen, Computer. Der Ursprung der Sprache ist nur unter Zuhilfenahme kühner Vermutungen datierbar, liegt aber mindestens 200.000 Jahre zurück; sie hat für die (biologische) Evolution des Menschen eine wesentliche Rolle gespielt. Alle weiteren Denkzeuge sind Errungenschaften der letzten 5000 Jahre, zum Teil sogar der letzten Jahrhunderte. Man kann zwar auch dann noch von einer „Evolution“ des Wissens und der Wissenschaft sprechen; hierfür spielt jedoch die biologische Evolution, insbesondere die natürliche Auslese, keine wesentliche Rolle mehr. Für die Kosmologie, für Relativitäts- und Quantentheorie, Molekularbiologie und Plattentektonik gibt es keine biologischen Wurzeln. Kein Wunder, liegen sie doch im ganz Großen, im ganz Kleinen, im Unanschaulichen und im sehr Komplizierten und damit weit außerhalb des Mesokosmos. Immerhin kann man die biologischen Hindernisse verstehen, die der „Evolution“ der Wissenschaft im Wege standen. Insofern hat auch die eher historisch orientierte Evolutionäre Wissenschaftstheorie enge Bezüge zur biologisch orientierten Evolutionären Erkenntnistheorie.