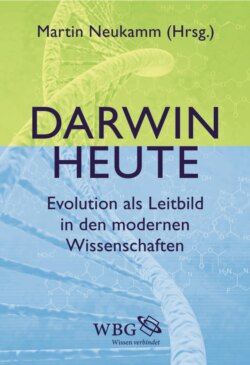Читать книгу Darwin heute - Harald Lesch - Страница 41
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.8.4 Evolutionäre Logik
ОглавлениеDer Begriff Logik wird sehr unterschiedlich gebraucht. In einem recht weiten Sinne meint man damit nicht mehr als Struktur oder – etwas enger – als argumentative Struktur. Im Folgenden halten wir uns jedoch an die engere Bedeutung; danach ist Logik die Lehre vom korrekten Schließen. Als solche liefert sie also keine neuen Wahrheiten, sondern stellt sicher, dass in einem Gedankengang oder in einer Schlusskette einmal gewonnene oder wenigstens vorausgesetzte Wahrheit nicht verlorengeht.
Worum geht es dann in einer Evolutionären Logik? Wir meinen nicht den Lernprozess, in dem das Individuum logische Fähigkeiten erwirbt. Natürlich meinen wir auch nicht die Geschichte der Logik als einer wissenschaftlichen Disziplin, selbst wenn man versucht sein könnte, hier eine Art Evolution zu sehen, wie das für alle wissenschaftlichen Disziplinen möglich ist. Schließlich will eine Evolutionäre Logik auch nicht die Struktur der Evolution, also die Evolutionsstrategie herausarbeiten, obwohl auch das eine interessante Aufgabe wäre.
Evolutionäre Logik versucht vielmehr, unser logisches Schließen aus dem evolutionären Ursprung des Menschen zu erklären, vielleicht sogar zu begründen. Ein solches Unterfangen ist nur dann sinnvoll, wenn man annimmt, dass unser Schließen wenigstens zum Teil genetisch verankert ist. Genetische Elemente könnten schon vorsprachlich existieren und wirken; sie könnten aber auch über das Sprachvermögen und das Sprechen des Menschen zum Tragen kommen. Welche dieser Möglichkeiten zutrifft, ist leider sehr schwer herauszufinden.
Bereits im Vorfeld ist umstritten, ob die Logik überhaupt empirische Elemente enthält. Im Allgemeinen wird diese Frage verneint, und es gilt als das große Verdienst des Mathematikers, Logikers und Philosophen GOTTLOB FREGE, die Logik von aller Psychologie befreit zu haben. Die Regeln der Logik gelten dann als konventionell, als zunächst unbewusste Vereinbarungen, zu denen es durchaus Alternativen geben könnte. Tatsächlich hat man mit der Ausarbeitung und Präzisierung der modernen Logik auch andere Logiken entwickelt.
Kennt man aber erst einmal verschiedene Logiken, so wird man sofort fragen, warum man eine bestimmte Logik anderen gegenüber bevorzugt und unter welchen Umständen man eine andere Wahl treffen würde oder sogar treffen sollte. Warum haben sich Menschen ausgerechnet auf die Regeln der klassischen Logik geeinigt und warum waren sie gerade mit diesen Regeln erfolgreich? Die Fragen nach Erklärung und Begründung der logischen Regeln ist also auch dann berechtigt, wenn es sich dabei um Konventionen handelt. Ebenfalls berechtigt wäre die Frage, ob diese Konventionen sich in unserem Erbgut niedergeschlagen haben. An der Möglichkeit, die Logik ohne Rücksicht auf ihre Herkunft als formales System aufzufassen, ändert sich dadurch nichts. So kommt es wohl auch, dass wir Logik als wissenschaftliche Disziplin betreiben können, ohne uns über ihre Herkunft, ihre Geschichte oder ihre Begründung Gedanken zu machen.
Gibt es also doch empirische Elemente in der Logik? Solche Elemente könnten individuell erworben werden oder schon stammesgeschichtlich ausgebildet sein. In beiden Fällen ließe sich argumentieren, dass es sich offenbar lohnt, folgerichtig zu denken, zu handeln, zu sprechen und zu argumentieren. Genauso könnte es sich lohnen, solche Regeln, die jedem nützen, genetisch zu fixieren und an die Nachkommen weiterzugeben; das erspart es dem Einzelnen, immer alles neu zu lernen. Im Falle einer solchen stammesgeschichtlichen Entstehung des logischen Schließens würden wir ganz zu Recht von Evolutionärer Logik sprechen. Dazu wäre nicht erforderlich, dass wir immer logisch korrekt schließen, also immer folgerichtig denken und argumentieren – was wir ja auch nicht tun; in der Stammesgeschichte dürfte es genügen, wenn die meisten Menschen in den meisten für die Verbreitung ihrer Gene relevanten Fällen einigermaßen korrekt schließen.
Nun aber eine entscheidende Frage: Wenn das logisches Schließen phylogenetisch entstanden ist, und zwar deshalb, weil es sich unter dem Druck der natürlichen Auslese bewährt hat, woran ist es dann eigentlich angepasst? Die Antwort hängt von der Natur der Logik ab – oder besser davon, was wir als die Natur der Logik ansehen. So könnte man die Gesetze der Logik als allgemeinste Naturgesetze auffassen oder als Denkgesetze, die entweder beschreiben, wie wir im Allgemeinen denken, oder vorschreiben, wie wir denken sollten, oder einfach als Regelmäßigkeiten in unserem Sprachgebrauch. Im Folgenden verstehen wir die Logik als Struktur beschreibender und argumentativer Sprachen.
Wenn wir aber Logik brauchen, um bestimmte Ziele zu erreichen, wenn die Verwendung der Logik also zweckmäßig ist, dann haben wir jetzt auch eine Antwort auf die Frage, woran unsere Logik angepasst ist: Sie ist angepasst an unser Bedürfnis, miteinander zu sprechen, die Welt zu beschreiben und zu erklären, wahre Mitteilungen zu erhalten und zu machen, zu argumentieren und zu diskutieren, Falsches als falsch zu erkennen und nach Möglichkeit zu korrigieren.
Besonders verlockend ist die Möglichkeit, eine Beziehung zur Kausalstruktur der Welt herzustellen. So kann man sagen, dass in unserer Sprache kausale Zusammenhänge auf logische Zusammenhänge abgebildet werden. Die Logik ist dann nicht erst für eine Erklärung, sondern auch schon für eine angemessene Beschreibung der Welt nützlich, sogar unerlässlich.
Diese Beziehung legt die Vermutung nahe, dass wenigstens eine gewisse Minimallogik sich evolutionär herausgebildet hat, und zwar in Anpassung an die Kausalstruktur der Welt, die wir erleben, berücksichtigen und nützen. Dass die Logik als Disziplin, ist sie erst einmal sprachlich formuliert und bewusst gemacht, noch viele weitere Feinheiten hinzugewonnen hat, ist dann durchaus einleuchtend.