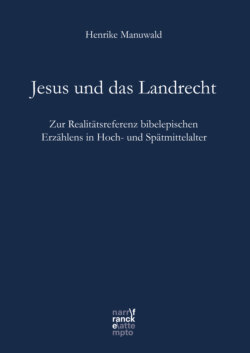Читать книгу Jesus und das Landrecht - Henrike Manuwald - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.2 Implizite Adressierung zeitgenössischer Erfahrungswirklichkeit
ОглавлениеBei Übersetzungen oder Bearbeitungen von Texten für Adressaten, denen das ursprüngliche kulturelle Umfeld der Ausgangstexte fremd ist, stellt der Umgang mit Realien1BibelübersetzungNotker III. von St. Gallen ein Kriterium dar, an dem sich die Übersetzungs- bzw. Übertragungsprinzipien besonders deutlich ablesen lassen: Bleibt eine Übersetzung stark an der Ausgangssprache orientiert, sind auch die Bezeichnungen für Realien nur in ihrem ursprünglichen kulturellen Kontext verständlich, d.h., es sind in der Regel zusätzliche Erläuterungen nötig. Werden dagegen die im Ausgangstext vermittelten außersprachlichen Sachverhalte in die Sprache und Kultur des Zielpublikums übertragen,2 gewinnt die Übersetzung kommunikative Qualität,3 legt den Ausgangstext jedoch vereindeutigend fest. Das Grundproblem, wie Sachbezeichnungen aus einer fremden Kultur umzusetzen sind, stellt sich bei bibelepischen Texten, die sich übersetzungstechnisch als erweiterte Versübersetzungen begreifen lassen,4Heliand in demselben Maße,5Bibelübersetzung auch wenn die Anforderungen hinsichtlich der ,textnormativen Äquivalenz‘6 anders gelagert sind als etwa bei BibelübersetzungenBibelübersetzung in Prosa.7 Wie bei Prosaübersetzungen kann sich bei bibelepischen Versdichtungen bereits auf der Ebene des Einzelwortes eine Adressierung der zeitgenössischen Erfahrungswirklichkeit zeigen, wenn nämlich etwa für eine Sachbezeichnung ein Wort aus der Kultur zur Entstehungszeit des Textes gewählt ist. Darüber hinaus können sich BibelepenBibelepik aber eines breiteren Spektrums der kulturellen Adaptation bedienen, zu dem – neben expliziten Erläuterungen oder Vergleichen – auch szenische Ausgestaltungen gehören. Sie setzen oft an kulturell fremden Elementen an, die auch in der exegetischen LiteraturExegetik Aufmerksamkeit gefunden haben und dort kommentiert worden sind, sodass ein Blick darauf gegebenenfalls helfen kann, um die impliziten Transformationsprozesse in den bibelepischen Texten einzuordnen.
Um die in den Kerntexten gewählten Verfahrensweisen besser charakterisieren zu können, sind ihnen im Folgenden punktuell Lösungen aus den Prosaübersetzungen des NikodemusevangeliumsNikodemusevangeliumdeutsche Prosafassungen8 gegenübergestellt, außerdem Passagen aus Der Kreuziger des Johannes von FrankensteinJohannes von FrankensteinDer Kreuziger, einem exegetischen volkssprachigen VerstextExegetik, der durch Kommentierung von Sachverhalten, an denen er für zeitgenössische Leser Erklärungsbedarf sah, die Vermittlungsprobleme exemplarisch erkennbar macht.9Prosa-Passio (Vorlage von Johannes von Frankenstein, Der Kreuziger)Johannes von FrankensteinDer Kreuziger Die Vergleichstexte, die später entstanden sind als die Kerntexte und zu ihnen nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, sind aus systematischen Gründen ausgewählt worden: Die Prosaübersetzungen teilen mit den Kerntexten das lateinische Nikodemusevangelium als Ausgangstext; Der Kreuziger geht – wie die Kerntexte – auf Elemente der ,deutschen‘ Rechtskultur ein, wie die Bearbeitung der lateinischen Vorlage zeigt.10ExegetikThomas von AquinCatena aurea-ÜbersetzungCatena aurea-ÜbersetzungThomas von Aquin
Wenn in den Kerntexten von der Passion Jesu erzählt wird, dann sind für die Darstellung nicht nur die bereits angesprochenen historischen und geographischen Distanzen zu bewältigen, sondern die Ereignisse auch in einem religiösen Kontext zu verorten, der dem christlichen Zielpublikum unter Umständen nicht selbstverständlich war: Amtsträger wie ,Hohepriester‘ oder ein religiöses Fest wie das Passahfest mussten in irgendeiner Form in der Schilderung der Ereignisse Erwähnung finden. In den deutschen Versdichtungen sind dafür überwiegend Bezeichnungen aus einem christlichen Kontext gewählt: Kaiphas und Annas werden zum Beispiel in Diu urstende (v. 94) und im Evangelium Nicodemi (v. 792) bischof(e) genannt.11Neues TestamentJohannesevangelium Io18,13 In Christi Hort, wo an einer Stelle sogar der Ausdruck der hohe priester (v. 3419 in Bezug auf Finees) belegt ist, bleibt die Übersetzung der Amtsbezeichnung für Kaiphas und Annas als fursten priester näher am Vorlagentext;12Neues TestamentLukasevangelium Lc3,2FrankfurtUniversitätsbibl.Mgq 55 [Fr]Johannes von FrankensteinDer Kreuziger5217Johannes von FrankensteinDer Kreuziger5257 doch hat einer der drei Himmelfahrtszeugen, der priester Egeas (v. 3040), das christliche Amt eines Diakons verliehen bekommen (vv. 3044; 3396).13 Passah wird an mehreren Stellen mit ,Ostern‘ wiedergegeben;14 der Sabbat15 ist in allen Texten zum ,Samstag‘ geworden (vgl. z.B. Diu urstende, v. 624; Christi Hort, v. 1411; Evangelium Nicodemi, v. 738; jeweils in der wörtlichen Rede ,der Juden‘).16Heinrich von MünchenWeltchronikHeinrich von MünchenWeltchronik6,844MünchenBSBCgm 7330 (Cim 314) [H9, M3, Ms]WolfenbüttelHABCod. Guelf. 1.16 Aug. 2° [H12, Wo2, Ws] Ein solcher ,kolonialer‘17 Zugang zur jüdischen Religion ist kein Einzelfall,18Wolfram von EschenbachWillehalm307,23f. man denke nur an die in Bischofsstädten eingeführte Bezeichnung des Vorstehers einer lokalen Judenschaft als episcopus JudaeorumJudenJudenbischof.19 Das Überstülpen der eigenen Kultur ist vermutlich nicht allein im Kontext der Übertragung ins Deutsche geschehen, denn der Vulgata-Text, der neben dem Nikodemusevangelium für die Wortwahl eine Rolle gespielt haben könnte, verwendet mit pontifices für ,Hohepriester‘ (vgl. z.B. Io 11,47Neues TestamentJohannesevangelium Io11,47) und Paschæ (z.B. Io 19,14Neues TestamentJohannesevangelium Io19,14) Termini, die im Mittellateinischen für christliche Deutungen offen waren.20Johannes von FrankensteinDer Kreuziger144–432Petrus ComestorHistoria ScholasticaHistoria Evangelicacap. 147 In den Texten scheint stellenweise ein Bewusstsein von den verschiedenen Bezugsmöglichkeiten auf, wenn nämlich von Passah als ,Ostern der Juden‘ die Rede ist (vgl. Christi Hort: ze iuren ostern, v. 1861 [Pilatus als Sprecher]; zeir ostern, v. 1871 [Erzähler als Sprecher]). Entsprechende Zuordnungen, die vereinzelt auch bei den Amtsbezeichnungen (vgl. Evangelium Nicodemi: ir bischof, v. 403) begegnen, gehen über Phänomene der impliziten Aneignung hinaus; sie setzen distanzierend die eigene christliche Erfahrungswirklichkeit der Verfasser in der postulierten Gemeinschaft mit den Rezipienten gegen die fremde Religion ab.21
Die Methode der impliziten Aneignung, wie sie beim Umgang mit der jüdischen Religion dominant ist, lässt sich auch bei historischen Sachbezeichnungen und Ämtern beobachten: So ist der handlungsrelevante Ort des Verfahrens im Nikodemusevangelium (wie auch in Mc 15,16Neues TestamentMarkusevangelium Mc15,16; Io 18,28Neues TestamentJohannesevangelium Io18,28; 19,9) das PrätoriumGerichtsortePrätorium, das betreten und wieder verlassen wird (z.B. cap. I 6; III 1). Welches Amt mit diesem Amtssitz verbunden ist, wird im Nikodemusevangelium nicht näher spezifiziert. Nach dem Matthäusevangelium (27,2Neues TestamentMatthäusevangelium Mt27,2; 11Neues TestamentMatthäusevangelium Mt11) war Pilatus praeses,22 nach dem Lukasevangelium ist für Pilatus das Amt eines procurator zu erschließen.23Neues TestamentLukasevangelium Lc3,1f.Tacitus, Publius CorneliusAnnales15,44,3Philon von AlexandriaLegatio ad Gaium299Josephus, FlaviusBellum Iudaicum2,9,2 Angesichts der diffusen Überlieferungslage war für die mittelalterlichen Verfasser also nicht so sehr eine einzelne Sachbezeichnung umzusetzen als vielmehr ein Funktionsäquivalent24 für den vom Kaiser eingesetzten Verwalter von Judäa zu finden, der – wie der Prozess gegen Jesus zeigt – dort die Gerichtsgewalt ausübte. Sowohl die herrschaftliche als auch die richterliche Komponente sind in der in allen Kerntexten gewählten Bezeichnung rihter präsent,25 die auch als gängige Übersetzung von praetor bzw. pretor belegt ist – ein Amt mit der Kombination administrativer und jurisdiktioneller Aufgaben, das unter Umständen von mittelalterlichen Autoren mit dem ,Prätorium‘ assoziiert worden sein könnte.26 In den Kerntexten steht allein schon durch den Handlungsausschnitt des Prozesses die Richterfunktion des Pilatus im Vordergrund. In Christi Hort, dem einzigen Text, der schildert, wie Pilatus zu seiner Stellung kam, ist sogar diese Vorgeschichte dahingehend vereindeutigt worden, dass Pilatus direkt vom Kaiser richterliche GewaltRichterGerichtsbann (gerichte […] / […] unt den pan) bekommen habe (vv. 1343–1348).27
Zwar geben sich diese Erläuterungen als Erklärung der Verhältnisse zur Römerzeit (vgl. Christi Hort, vv. 1327; 1334; 1343), nicht zuletzt über die Verwendung des Wortes pan (v. 1346) werden die geschilderten ,römischen‘ Verhältnisse jedoch anschlussfähig an das Rechtswesen zur Entstehungszeit des Textes gemacht.28 Eine entsprechende Mischung von expliziter Distanzierung und impliziter Aneignung lässt sich in Diu urstende und im Evangelium Nicodemi hinsichtlich des Umgangs mit den signa beobachten, die Pilatus nach dem Nikodemusevangelium (cap. I 5) mit sich führt.29 Einerseits wird die damit verbundene fremde Sitte erläutert (Diu urstende, vv. 274f.; Evangelium Nicodemi, vv. 835–855), andererseits versucht, die materielle Realie als ,Fahnen‘ (Diu urstende, v. 275: baniere; Evangelium Nicodemi, v. 841: des riches vanen) zu konkretisieren.30MadridBibl. nat.Vitr. 23–8, vol. IISchaffhausenStadtbibl.Cod. Gen. 8 [S, H<sup>1</sup>](Klosterneuburger) EvangelienwerkSpiegel des Leidens ChristiColmarBibliothèque municipaleMs. 306 Auch wenn die Entsprechungen zur Fahne als Gerichtssymbol allein schon wegen der Mehrzahl der Fahnen verschwommen bleiben,31 werden die ,römischen‘ Sitten durch die Umsetzung als (Reichs-)Fahnen an Gepflogenheiten zur Entstehungszeit der Texte angenähert.
Wo aber sitzt nach mittelalterlichen Vorstellungen ein rihter zu Gericht?Gerichtsorte Die wohl ab dem 14. Jahrhundert entstandenen Prosaübersetzungen des NikodemusevangeliumsNikodemusevangeliumdeutsche Prosafassungen verorten die Verhandlung mehrheitlich in bzw. vor dem richthus;32Nikodemusevangeliumdeutsche ProsafassungenProsafassung EKarlsruheBadische Landesbibl.Cod. St. Georgen 83 [E3](Klosterneuburger) Evangelienwerk in einer Handschrift aus dem späten 15. Jahrhundert (A8), in der der Wortschatz der Übersetzung A modernisiert wurde,33 ist vom RathaußGerichtsorteRathaus (Z. 73) die Rede, ebenso in der Handschrift G1 (Rothaws, Z. 132), deren Text in der betreffenden Partie auf 1447 datiert ist.34MünchenBSBCgm 7240 [G<sup>1</sup>] In beiden Fällen ist die denotative Bedeutung von ,Prätorium‘ als ,Gebäude mit Gerichtsfunktion‘ beibehalten worden, wobei das ,Rathaus‘ einen konkreten städtischen Kontext evoziert. In Der Kreuziger des Johannes von Frankenstein ist sogar versucht worden, die Angabe, dass Pilatus vor dem Gebäude zu Gericht sitzt, auf ein Rathaus zu beziehen. Nachdem erklärt worden ist, dass die Heiden ihr Gericht im Rathaus abhalten müssten, ,die Juden‘ wegen der bevorstehenden ,Oster‘feierlichkeiten aber nicht hineingegangen seien, um nicht unrein zu werden (vv. 5911–5942Johannes von FrankensteinDer Kreuziger5911–5942), heißt es, dass Pilatus zu ,den Juden‘ hinausgegangen sei (vv. 5943–5947Johannes von FrankensteinDer Kreuziger5943–5947). Am Ende der Prozessschilderung werden die Örtlichkeiten folgendermaßen beschrieben:
Als nû di rede Pilatus
het erhôrt, er vûrt her ûz
Jesum und besaz hî vor
daz gerichte bî dem tor
des râthûses an der stat
di sand Johannes genennet hât
in krîchisch lithostrotos
(daz wort man ê geschriben kôs)
und heizt in judisch ˛golgatha’,
daz recht wart begangen dâ.
waz lithostrotos moge wesen,
da von ist êmâln genûc gelesen,
als BedaBeda iz hât ûz geleit:
di stat von steinen was bereit.
dar satzte sînes stûles stant
Pilatus, daz dô wurde erkant
offenlich sîn gericht.
ob Jesus durch di inzicht
zû dem tôde wurde verteilt,
daz im di schult icht angeseilt
wurde und nicht verdâcht dar an,
und ûf den juden blibe der wân. (Der Kreuziger, vv. 7783–7804)Johannes von FrankensteinDer Kreuziger7783–7804
Das Richten vor der Tür des Rathauses in aller Öffentlichkeit erscheint hier als eine Ausnahmeregelung, die einer speziellen Begründung bedarf. Bei der Diskussion der (schließlich zurückgewiesenen) These, das Rathaus sei ein Teil der wonung des Kaiphas gewesen, hatte sich aber das zeitgenössische Konzept einer Rathauslaube35 eingeschlichen:
von dem gewalte er besaz
ein wonung, dar zû gehôrte
daz râthûs in des phorte
man richten solde und râten,
und si daz von rechte tâten. (Der Kreuziger, vv. 5882–5886)Johannes von FrankensteinDer Kreuziger5882–588636
Neben die Quellentreue, die in der Berufung auf den Evangelisten Johannes zum Ausdruck kommt, ist hier eine argumentative Logik getreten, die sich aus dem Bezug auf die zeitgenössische Erfahrungswirklichkeit speist und durch das Einzelwort ,Rathaus‘ ausgelöst zu sein scheint, das ein Konzept (Richten in der Rathauslaube) nach sich zieht. Solche Verselbstständigungen kommen bei den streng vorlagengebundenen Prosaübersetzungen des NikodemusevangeliumsNikodemusevangeliumdeutsche Prosafassungen nicht vor;37Bibelübersetzung die Versdichtungen sind dafür aber durchaus affin.
In den drei Kerntexten, die früher als die Prosaübersetzungen und Der Kreuziger entstanden sind, ist ebenfalls terminologisch der römische Kontext getilgt, aber es ist – anders als bei den genannten Vergleichsbeispielen – auch das Konzept aufgegeben, dass die Gerichtsverhandlung in einem Gebäude abgehalten wird.38 Der Ort der Gerichtsverhandlung ist nach Diu urstende (z.B. v. 265) und Christi Hort (z.B. v. 1435) durch eine AbschrankungGerichtsorteAbschrankung (unter freiem Himmel) (schrange) gekennzeichnet; für das Evangelium Nicodemi ist ein entsprechendes Setting ebenfalls eine plausible Annahme, die Lokalisierung bleibt jedoch diffus.39 Eine kulturelle Transposition ist daran erkennbar, dass die Gerichtsverhandlung am ,Hof‘ angesiedelt ist,40 wobei damit wohl die Institution der Gerichtsversammlung unter landesherrschaftlicher Leitung gemeint ist, nicht ein konkretes Gebäude.41
Wie die Einzelinterpretationen bereits gezeigt haben, sind mit dem veränderten Setting der Verhandlung weitere Aktualisierungen verbunden, die bis in die Gestaltung des Verfahrensablaufes hineinreichen. Auf der Ebene des Einzelwortes tritt in Christi Hort und im Evangelium Nicodemi die Übersetzung von praeco mit scherge bzw. butelBüttel, Fronbote, Gerichtsbote hinzu:42 Die Handlung erfordert es, dass ,die Juden‘ bemängeln, dass Pilatus Jesus durch einen ‚Läufer‘43 hat holen lassen, und stattdessen eine Vorladung durch einen Gerichtsboten verlangen. Wechselnde Bezeichnungen für die von Pilatus ausgesandte Person im Evangelium Nicodemi lassen jedoch die Vorstellung durchscheinen, dass auch für den Verfasser bzw. den Redaktor des Textes die Vorladung durch einen Schergen bzw. Büttel der Normalfall war.44 In dem der Handschrift S folgenden Ausgabentext steht:45WienÖNBCod. Ser. nova 207 [W]Bruder PhilippMarienlebenLondonBritish LibraryMS Add. 10432 [L]
„[…]
Ir enwizzet“ sprach Pilat
„wes ir den schergen46WienÖNBCod. Ser. nova 207 [W] hat gezigen.“
Die Juden alle gemeine swigen.
Pilat den butel47StuttgartLandesbibl.Cod. theol. et phil. 4° 98 [s]HeidelbergUniversitätsbibl.Cpg 342 [p] ane sach,
zu im anderweide er sprach:
„Nu ginc, sit dus berufen sis,48GörlitzBibl. der Oberlausitzischen Gesellschaft der WissenschaftenCod. A III.1.10 [G]LondonBritish LibraryMS Add. 10432 [L]
und lade Jesum solche wis,
als du wilt.“ (Evangelium Nicodemi, vv. 824–831)
In den Handschriften sStuttgartLandesbibl.Cod. theol. et phil. 4° 98 [s] und pHeidelbergUniversitätsbibl.Cpg 342 [p] ist dagegen – handlungslogisch ,korrekt‘ – durchgehend vom ,Läufer‘ die Rede. Nach Karl Helm (1899) gehören diese beiden Handschriften einer späteren Bearbeitungsstufe an;49 ob die Varianten an dieser Stelle tatsächlich sekundär sind, wird man aber nicht entscheiden können. Für die systematische Frage danach, wie Referenzen auf die Erfahrungswirklichkeit funktionieren, lässt sich der Befund auf jeden Fall so auswerten, dass in den Handschriften, in denen der Läufer als Gerichtsbote bezeichnet wird, die Situation offenbar produktionsseitig die Vorladung durch einen Gerichtsboten als ,Script‘ aktiviert hat, das sich im Text manifestiert.50
Zwar wird die Funktion kognitiver Schemata insbesondere für die Rezeption von Texten diskutiert,51 sie sind jedoch auch für die Produktion von Texten relevant.52 Für die bibelepischen Kerntexte gilt das in besonderem Maße, da deren Verfasser zugleich Rezipienten der autoritativen Prätexte (mit für sie invariablen Grundsituationen) waren. Wie sich Elemente eines Scripts an Vorgefundenes anlagern können, lässt sich exemplarisch an der (nicht-kanonischen) Szene beobachten, in der dem von Jesus befreiten Joseph von Arimathia von Boten ,der Juden‘, die ihn hatten einsperren lassen, Frieden garantiert wird. Nach dem Nikodemusevangelium (cap. XV 2) schicken ihm die Hohepriester eine schriftliche Botschaft nach Arimathia, in der ihm Friede zugesagt wird; der Wortlaut ist dabei an biblische Formeln angelehnt.53Altes TestamentPs106[107],17Neues TestamentLukasevangelium Lc15,21 Im Evangelium Nicodemi ist das Motiv der schriftlichen Botschaft beibehalten, aber der Bezugsrahmen der Formulierungen ist ein rechtlicher:
„[…]
Ist daz du irvorhtes iht,
so habe getrulichen vride
di [bi] dem halse und bi der wide,54GörlitzBibl. der Oberlausitzischen Gesellschaft der WissenschaftenCod. A III.1.10 [G]
daz dir hie nieman niht entut,
wen allez lieb und allez gut,
[…]“ (Evangelium Nicodemi, vv. 2538–2542)
Die Doppelformel bi dem halse und bi der wide als Androhung der Bestrafung für einen Friedensbrecher ist literarisch belegt und dürfte zur Entstehungszeit des Evangelium Nicodemi Assoziationen an Landfriedensordnungen geweckt haben.55 Hier ist also eine zeitgenössische sprachliche Formel integriert, die für die Situation ,Frieden anbieten‘ plausibel wirkt.56Mai und BeaflorLe jeu d’Adam
In Diu urstende heißt es entsprechend von den Überbringern der schriftlichen Botschaft (briefe, v. 1282): die tâten alle sicherheit: / si buten triuwe und manigen eit / daz er âne angest wære (vv. 1283–1285). Die Formel sicherheit tuon ist wie sicherheit nemen häufig in Erzählungen von Gefangennahmen zu finden.57 Beide Formeln begegnen in Christi Hort (vv. 3229; 3232), wo eine Ausgestaltung des Scripts ,Boten bieten Sicherheit an‘ das Motiv der schriftlichen Botschaft vollständig ersetzt hat (vv. 3157–3250): Die Boten, sieben mit Joseph verwandte Männer, weise unt wol gezogen und schön gekleidet (vv. 3177–3184), reden höflich mit Joseph und bieten sich selbst als Geiseln an (v. 3237).58 Christi Hort scheint hier wie Diu urstende vor allem auf literarisch vorgeprägte Muster zu rekurrieren.
Die produktionsseitige Aktivierung eines Scripts zeigt sich im Evangelium Nicodemi auch an dem Punkt der Handlung, an dem ,die Juden‘ Pilatus bitten, über Jesus Gericht zu halten (Nikodemusevangelium, cap. I 2). Mit der Aufforderung, dass er früh, bevor er gegessen habeRichterNüchternheit, die Gerichtsverhandlung eröffnen möge (vv. 720–724), wird die Bitte im Evangelium Nicodemi nach dem Schema eines ,deutschrechtlichen‘ Verfahrens konkretisiert.59 Dass eine selbstverständliche Vorbedingung für das Abhalten einer Gerichtsverhandlung überhaupt benannt wird, hat damit zu tun, dass nach dem Evangelium Nicodemi die jüdischen Ankläger Pilatus im Morgengrauen aufsuchen (vv. 712–719; vgl. auch Diu urstende, vv. 259–266), d.h., es ist handlungsrelevant, dass sie der ersten Mahlzeit des Pilatus zuvorkommen. Danach tritt das Script einer ,deutschrechtlichen‘ Verhandlung in den Hintergrund,60 z.B. wird die Hegung des Gerichts mit dem FriedensgebotGerichtsfrieden ausgespart.61 Dass es aber nach wie vor präsent ist, zeigt sich zum Beispiel an der – vom Prätext unabhängigen – Handlung des Richters, der mit seiner Hand Ruhe gebietet (vv. 870f.).62
Der Vorgang ,der Richter gebietet Ruhe‘ als Teil des Scripts ,Gerichtsverhandlung‘ manifestiert sich (an einem anderen Punkt der Handlung) auch in Diu urstende, und zwar lässt Pilatus dort einen schergenBüttel, Fronbote, Gerichtsbote seine Stimme erheben (vv. 529–546). Dass in Diu urstende überhaupt die Anwesenheit eines bis zur betreffenden Textstelle nicht erwähnten schergen als selbstverständlich angenommen wird, lässt sich damit erklären, dass er zum Frame ,Gericht‘ gehört, wie er sich für die Entstehungszeit des Textes erschließen lässt.63Nikodemusevangeliumdeutsche ProsafassungenProsafassung E Weitere Implikaturen zeigen sich in Diu urstende punktuell an der Textoberfläche: So setzt die Bemerkung, dass sich etliche Juden und Heiden der phlihte entzogen hätten (vv. 332–335), voraus, dass es eine DingpflichtDingpflicht gibt. Der von Pilatus vorgebrachte Tadel, dass ,die Juden‘ mit übeler urteil (v. 509) einen ordnungsgemäßen Ablauf der Verhandlung störten, gibt nur vor dem Hintergrund Sinn, dass die Gerichtsgemeinde Urteile fällt. Und bei dem Zweifel ,der Juden‘ an der Zeugnisfähigkeit der vermeintlichen Proselyten (vv. 702–706) impliziert das Wort lantreht das PersonalitätsprinzipRechtsordnungenLandrechtPersonalitätsprinzip.
Für die Rezeption ist zu vermuten, dass durch die einzelnen Wörter jeweils das damit angesprochene Schema insgesamt oder in seinen relevanten Komponenten in der Vorstellungswelt aufgerufen werden konnte.64 Entsprechend dürften etwa in Christi Hort Handlungsmuster wie ,der Richter stellt eine UrteilsfrageUrteilUrteilsfrage‘ (vv. 1876f.) beim Rezipienten zur Assoziation des dazu gehörigen Scripts geführt haben. Umso auffälliger wird es gewesen sein, dass Pilatus das Urteil nicht ausgibt.65 Ob die sinnstiftende „Abweichung von vorgegebenen Erfahrungsmustern“66 an dieser Stelle als Erzählstrategie anzusehen ist, lässt sich angesichts der diffusen Angaben zum Prozessende in den Prätexten schwer entscheiden. Mithilfe einer Passage in Diu urstende, in der eine Abweichung vom Schema explizit benannt wird, lässt sich jedoch nachweisen, dass solche Abweichungen punktuell zur Sinnstiftung eingesetzt werden: Dass ,die Juden‘ nicht die ,rechte Zeit‘ für eine Gerichtsverhandlung abwarten können und noch im Morgengrauen Pilatus aufsuchen (vv. 259–266), trägt vor dem Hintergrund des prototypischen Beginns einer Gerichtsverhandlung bei Tagesanbruch zu deren negativer Charakterisierung bei.
Wenn mit der ,rechten Zeit‘ in Diu urstende ausdrücklich auf zeitgenössische Gepflogenheiten als Bezugsrahmen verwiesen wird, ist das auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Gegenwartskultur keineswegs den einzigen Bezugsrahmen für die Kerntexte darstellt.67 Das Nebeneinander verschiedener Bezugsräume zeigt sich etwa am Umgang der Texte mit dem Schweigen Jesu vor Gericht: In Christi Hort wird es – offenbar im Kontext des Scripts ,Gerichtsverhandlung‘ – vom Erzähler als Verstoß gegen die Gerichtsordnung klassifiziert.68 In Diu urstende dagegen wird von vornherein ein heilsgeschichtlicher Kontext für das Schweigen Jesu aufgerufen, wenn der heidnische Zeuge auf die alttestamentarische Prophezeiung vom Lamm, das willig und swîgende Marter und Tod erleiden wird, verweist (vv. 374–388).69
Weil verschiedene Bezüge möglich sind, lässt sich eine kulturelle Aneignung in dem Sinne, dass ein Bezug auf die handlungspraktische Erfahrungswirklichkeit gegeben ist,70 nur sichern, wenn im Text eindeutige Signale vorliegen (z.B. zeitgenössisch geprägtes Vokabular). Jedoch ist auch damit zu rechnen, dass ein Gegenwartsbezug dadurch zustande kommt, dass ein bereits im spätantiken Nikodemusevangelium enthaltenes Motiv im Kontext eines mittelalterlichen Textes, der die Gerichtsverhandlung in einem abgeschrankten Bereich konzipiert, neue Konnotationen bekommt, dass sich also nur die ,nichttextualisierten Verstehensbedingungen‘71 geändert haben. Ein solches Motiv ist das Weinen etlicher Juden angesichts der Forderung ‚der Juden‘, Jesus kreuzigenStrafeKreuzigung zu lassen (Nikodemusevangelium, cap. IV 5), das Pilatus als Willen der multitudo (Z. 3f.) in seine Entscheidungsfindung mit einbezieht. Wie bereits ausgeführt, könnte die Menge in einem deutschrechtlichen Kontext zu einem UmstandUmstand umgedeutet werden, doch nur im Evangelium Nicodemi (vv. 1145–1154) finden sich dafür verhaltene Signale im Text.72Nikodemusevangeliumdeutsche ProsafassungenProsafassung E Nicht in den Texten artikuliert sind zumeist auch Wertesysteme,73 die Textproduzenten und den von ihnen anvisierten Rezipienten gemeinsam gewesen sein dürften. Dass beispielsweise in Diu urstende bei der Schilderung des Tumults bei der Gerichtsverhandlung ausdrücklich gesagt wird, dass ,die Juden‘ in der schrangen entwer (v. 737) eindringen, dürfte für zeitgenössische Rezipienten ausgereicht haben, um nicht nur das Script ,Bruch des GerichtsfriedensGerichtsfrieden‘, sondern auch Bewertungskategorien (Ungeheuerlichkeit des Vergehens, Schwäche des Richters) zu assoziieren.
Die hier als ,implizit‘ zusammengestellten Adressierungen der zeitgenössischen Erfahrungswirklichkeit haben also unterschiedliche Implizitheitsgrade. Sie reichen von der Verwendung von Wörtern oder der Schilderung von Verhaltensweisen mit einem klaren Bezug zur zeitgenössischen Kultur bis hin zur Bezugnahme auf oder Berücksichtigung von Konzepten, die für einen heutigen Interpreten nur mithilfe kontextuellen Materials zu rekonstruieren sind. Anhand der in allen drei Kerntexten (in unterschiedlicher Weise) präsenten Idee, dass mit Jesus umgegangen wird wie mit einem Verbrecher, ist das gesamte Spektrum der Implizitheitsgrade zu demonstrieren.
In Christi Hort lässt der Erzähler Maria in ihrer Klage unter dem Kreuz die Hinrichtung Jesu explizit mit der eines Diebes vergleichen: ‘[…] / der hangt vor mir als ein diep / zwischen schæchern74Neues TestamentMatthäusevangelium Mt27,44Neues TestamentMarkusevangelium Mc15,27Neues TestamentLukasevangelium Lc23,39 da zwein. / […]’ (vv. 2130f.).75 Der Vergleich hat eine theologische Dimension, indem er die Erfüllung des Jesajawortes et cum sceleratis reputatus est (53,12Altes TestamentIs53,12) verdeutlicht. Dass Jesus nicht zu einem Schächer, sondern zu einem diep in Beziehung gesetzt wird, dürfte nicht allein mit dem Reimwort liep in v. 2129 zusammenhängen. Vielmehr lässt sich nachweisen, dass die KreuzigungsstrafeStrafeKreuzigung in verschiedenen mittelalterlichen Text- und Bildzeugnissen vor dem Hintergrund der Bestrafung von Dieben neu interpretiert wurde.76StrafeKreuzigung Die Assoziation der für Diebe typischen Strafe des ErhängensStrafeErhängen ist im deutschsprachigen Kontext bereits in der Umschreibung für ,kreuzigen‘, an daz kriuze hâhen,77 angelegt, denn diebe sol man hâhen, wie es zum Beispiel in Freidanks Bescheidenheit (v. 47,19)FreidankBescheidenheit47,19 heißt.78Eike von RepgowSachsenspiegelLdr. II13,1DeutschenspiegelLdr.110SchwabenspiegelLdr.174a Eine solche Phrase hat unter Umständen bei der Forderung der Hohepriester im Evangelium Niocdemi (v. 1412) „[…] / so ha disen als einen dieb.“ Pate gestanden.79 Typologisch hat man es hier also mit einem Gegenwartsbezug durch eine sprachlich vorgeprägte Formel zu tun; bei den ebenfalls im Evangelium Nicodemi ausgedrückten Forderungen, man solle Jesus an das cruze han,80 ist allein in der Wortwahl eine kulturelle Adaptation spürbar.
Eine weitere Stelle im Evangelium Nicodemi deutet darauf hin, dass die Diebesmotivik auch mit einem Script verbunden sein könnte. So heißt es im Bericht, den Adrian Vespasian gibt, rückblickend:
„[…]
des hazten in so sere
die Juden, daz si in viengen
und an ein cruze hiengen.
Sie giengen an Pilaten,
vil ture sie in baten,
daz er in vorteilde als einen dieb.
[…]“ (Evangelium Nicodemi, vv. 3976–3981)
Zunächst wird die Gefangennahme rekapituliert, dann die Bitte ,der Juden‘, dass Pilatus Jesus wie einen Dieb verurteilen solle. Aus den Versen ist nicht sicher zu erkennen, ob sich das Verurteilen nur auf das Resultat oder den gesamten Verfahrensablauf bezieht, aber Letzteres ist zumindest möglich.81 Im (Klosterneuburger) Evangelienwerk(Klosterneuburger) Evangelienwerk wird eindeutig ein standardisierter Ablauf anzitiert, wenn in der Fassung H1 gesagt wird, dass, als Jesus in Fesseln zu Pilatus geführt wird,82SchaffhausenStadtbibl.Cod. Gen. 8 [S, H<sup>1</sup>] ,die Juden‘ tumultartig zusammenlaufen rehte. als da man dieb. oder morder. verterben sol.83
Dass allein schon die Fesselung JesuFesselung des Angeklagten in einem deutschrechtlichen Kontext als Signal für den üblichen Umgang mit einem Schwerstverbrecher gewertet werden konnte, zeigt der Kommentar dazu in Der KreuzigerJohannes von FrankensteinDer Kreuziger.84 Während im lateinischen Prätext die Fesselung (ligaverunt, Io 18,12Neues TestamentJohannesevangelium Io18,12) todeswürdiger Verbrecher als jüdische Sitte erklärt wird (die bis heute fortdauere),85 hat in der deutschen Version eine kulturelle Aneignung stattgefunden, da gesagt wird, dass man es noch heute so mache.
Daz man unsern hêren bant,
sulches sites phlac daz lant,
als noch ist gewonheit.
swen man einen uberseit
der des tôdes wirdic ist,
dem selben bint man zû der vrist
zû enander beide hende, 86 SchaffhausenStadtbibl.Cod. Gen. 8 [S, H1]
im gêt zû sîn ende,
man vûrt in vur den richtêre:
sô wart gebunden unser hêre. (Der Kreuziger, vv. 4313–4322Johannes von FrankensteinDer Kreuziger4313–4322)
Der Kreuziger weist in Bezug auf die Fesselung Jesu noch an einer zweiten Stelle signifikante Änderungen gegenüber dem lateinischen Prätext auf. Der Prozessbeginn wird im deutschen Text folgendermaßen eingeleitet:
Als nû Pilatus daz ersach
daz di juden alsô swach
nicht wolden gên in sîn hûs,
zû in gînc er selb her ûz
in zû êren mit gelimph,
wan si brâchten sunder schimph
Jesum dar gebunden,
sam er uberwunden
wêr und des tôdes wirdic.
swî wol Pilatus sach den stric
an Jesu, doch er in nicht
verteilen wolde ân gericht,
er hôrte vor ir klagen,
war umme si besagen
in wolden, ob daz redelich
wêr, und daz Jesus werte sich
gên der dît dâ wider kûn,
dem wolde er ouch des stat tûn. (Der Kreuziger, vv. 5943–5960)Johannes von FrankensteinDer Kreuziger5943–5960
Die Konzessivkonstruktion (,obwohl Pilatus den Strick sah, wollte er Jesus nicht ohne Gerichtsverhandlung verurteilen‘) hat die Kausalkonstruktion des lateinischen Textes (,weil Jesus gefesselt wie ein todeswürdiger Verbrecher vorgeführt wurde, wollte Pilatus ihn nicht ohne Anhörung verurteilen‘) ersetzt.87 Die Logik des deutschen Textes speist sich offenbar daraus, dass jemandem, der gefangen vor Gericht gebracht wird, in der Regel die Möglichkeit zur Verteidigung genommen istVerfahrenHandhaftverfahren.88 Die zeitgenössische Erfahrungswirklichkeit wird hier dadurch adressiert, dass die Abweichung von den zeitgenössischen Gepflogenheiten erklärt wird.
Diu urstende ist zwar mindestens ein Jahrhundert früher entstanden als Der Kreuziger, nicht aber in einem grundlegend anderen rechtlichen Umfeld. Auch in Diu urstende wird Jesus (in Absetzung vom Nikodemusevangelium) gefangen zu Pilatus geführt (si brâhten in gevangen dar, v. 278). Ein ausdrücklicher Vergleich mit einem Dieb oder Mörder ist nicht vorhanden, aber aus dem Vorwurf ,der Juden‘, Jesus wolle durch Zauberei das Gerichtsverfahren in die Länge ziehen, damit ihn niemand hengen89 sollte (vv. 307–312), wird Jesus indirekt als todeswürdiger Verbrecher charakterisiert. Pilatus lässt Jesus nicht sofort töten, aber immerhin ohne jegliche Befragung an eine Säule binden und geißeln, um ihn danach gehen zu lassen (vv. 325–329). Im Text wird für die GeißelungStrafeGeißelung ausdrücklich eine Begründung gegeben, nämlich dass Pilatus wegen der starchen rüege, d.h. der Drohungen und feindseligen Gebärden ,der Juden‘,90 glaubt, dass Jesus schuldig sei (vv. 319–324). Von einer Fesselung Jesu vor der Geißelung ist nicht die Rede, und nach der Geißelung beginnt wegen der Forderung ‚der Juden‘, man solle Jesus hâhen, eine Gerichtsverhandlung. Trotzdem ist es nicht unwahrscheinlich, dass bei der Bewertung des Verhaltens des Pilatus zur Entstehungszeit des Textes das Script ,Vorführen eines Angeklagten in Fesseln‘ mit der Implikation, dass dessen Schuld feststeht, eine Rolle gespielt hat. Absolute Sicherheit lässt sich zwar nicht gewinnen, aber im Kontext der Aktualisierung anderer Komponenten des Gerichtsverfahrens ist das eine plausible Spekulation. Dass indirekte Referenzen auf die zeitgenössische Erfahrungswirklichkeit den Normalfall darstellen, sollte der systematisierende Überblick gezeigt haben.