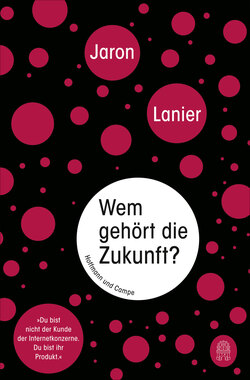Читать книгу Wem gehört die Zukunft? - Jaron Lanier - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 5 Sirenenserver
Komplexität ohne Ambivalenz ist unmöglich
Wir wissen über anstehende komplexe Probleme wie beispielsweise den globalen Klimawandel nur Bescheid, weil es viele Daten dazu gibt. Doch die Einschätzung von Problemen, die wir aufgrund großer Datenmengen kennen, stellt uns vor besondere Herausforderungen. Es ist schwierig, einen definitiven Beleg für die Existenz eines Problems von diesen Dimensionen zu finden. Und selbst wenn man sich über dessen Existenz einig ist, ist es kompliziert, Gegenmittel auszuprobieren. Im Netzwerkzeitalter hat sich folgende Binsenweisheit entwickelt: Die bloße Existenz von Big Data heißt nicht, dass man sich auch über ihre Bedeutung einig ist.
Ich beschäftige mich mit dem Problem, dass die Art und Weise, wie wir wirtschaftliche und kulturelle Tätigkeiten digitalisieren, letztendlich zu einer schrumpfenden Wirtschaft und einer neuartigen Konzentration von Macht und Reichtum führt, die nicht nachhaltig ist. Dieser Fehler hat gravierende Folgen, die allerdings vermeidbar sind, denn die Maschinen werden in diesem Jahrhundert noch deutlich besser werden.
Manche behaupten vielleicht, dass das Problem, das mir Sorgen bereitet, in Wirklichkeit gar nicht existiert. Es ist da eine gewisse Ambivalenz im Spiel, und diese Ambivalenz ist typisch für die Art und Weise, wie sich Probleme in unserer modernen Welt der vernetzten Daten präsentieren. So könnte man beispielsweise behaupten, dass anstelle der über hunderttausend Arbeitsplätze, die durch den Untergang von Kodak und das Aufkommen von Instagram verlorengingen, nun neue Arbeitsplätze entstehen, weil man das Foto-Sharing dazu nutzen kann, eigene Fotoarbeiten zu verkaufen. Das mag für den einen oder anderen Fall ja zutreffen, aber insgesamt ist das sicher keine Lösung.
Mein ursprüngliches Interesse wurde durch eine einfache Frage geweckt: Wenn die Netzwerktechnologie angeblich so gut für alle ist, warum geht es den Industrieländern ausgerechnet dann so schlecht, wenn sich die Technologie immer weiter verbreitet? Warum gab es genau in dem Moment so viele wirtschaftliche Probleme in den Industrieländern, als die Computernetzwerke Anfang des 21. Jahrhunderts jeden Aspekt menschlicher Tätigkeit durchdrangen? War das bloß Zufall?
Es gibt viele verschiedene Erklärungen für die Finanz- und Wirtschaftskrise. Eine Erklärung lautet, dass man an die grundlegenden Grenzen des Wachstums gestoßen ist, eine andere, dass durch den Aufstieg neuer Wirtschaftsmächte wie Indien, China und Brasilien mehr Hersteller und Verbraucher mit den entsprechenden Mitteln um dieselben Ressourcen konkurrieren. Außerdem gibt es in den meisten Industrieländern deutlich mehr alte Menschen, für deren Versorgung und Pflege mehr Geld ausgegeben werden muss als je zuvor.
Es spielt sich aber noch etwas anderes ab. Die Mechanismen der Finanzmärkte haben versagt, und unter diesem Versagen hatte fast jeder zu leiden. Wenn wir uns noch einmal die außergewöhnliche Entwicklung vor Augen führen, dass praktisch sämtliche Industrieländer auf einen Schlag hoffnungslos verschuldet waren, benötigt man eine Erklärung, die weiter reicht als der Aufstieg Chinas zur Wirtschaftsmacht oder die hohen soziale Kosten in Südeuropa oder die Deregulierung in den USA.
Und diese Erklärung ist eigentlich ganz einfach: Die Finanzmärkte sind falsch vernetzt. Die großen Rechnerkapazitäten, die andere Branchen wie die Musikindustrie »effizienter« machten (zumindest aus einem bestimmten Blickwinkel), wurden auch in der Finanzbranche genutzt, und das brach ihr das Genick. Die Finanzmärkte wurden dadurch dumm.
Betrachten wir einmal die Expansion des Finanzsektors vor der Finanzkrise. Es ist nicht so, dass der Sektor mehr leistete als je zuvor. Wenn die Aufgabe der Finanzbranche darin bestand, Risiken zu verwalten, dann hat sie eindeutig versagt. Die Branche expandierte nur aufgrund ihrer Spitzenpositionen in den Netzwerken. Der Moral-Hazard-Effekt, also die Förderung leichtfertigen Verhaltens, weil man weiß, dass die Allgemeinheit das Schadensrisiko trägt, ist mit dem Aufkommen des Netzes auf nie dagewesene Weise verstärkt worden. Je mehr der Einfluss der Netze zunimmt, desto größer wird das Potenzial für einen Moral Hazard – es sei denn, wir ändern die Netzwerkarchitektur.
Versuch einer ersten Definition
Ein Sirenenserver ist laut meiner Definition ein Elitecomputer oder eine koordinierte Ansammlung von Computern in einem Netzwerk. Typische Eigenschaften sind Narzissmus, eine unproportionale Risikoscheu und eine extreme Informationsasymmetrie. Ein Sirenenserver ist der Sieger in einem Alles-oder-nichts-Wettbewerb, und alle, die mit ihm interagieren, werden in kleinere Wettbewerbe hineingezogen, bei denen es ebenfalls um alles oder nichts geht.
Sirenenserver sammeln Daten im Netzwerk, für die sie meist nichts bezahlen müssen. Die Daten werden mit den leistungsfähigsten Computern analysiert, die von Spitzenkräften gewartet werden. Die Ergebnisse der Analysen werden geheim gehalten, aber dazu genutzt, die übrige Welt zum eigenen Vorteil zu manipulieren.
Doch dieses Prinzip wird irgendwann nach hinten losgehen, weil die übrige Welt für das erhöhte Risiko, die Kosten und den Müll auf Dauer nicht aufkommen kann. Homer warnte Seeleute eindringlich, nicht dem Ruf der Sirenen zu folgen. Doch nicht die Sirene schadet dem Seemann, sondern die Tatsache, dass er angesichts der Sirenen nicht mehr vernünftig denken kann. Und so verhält es sich auch mit uns und unseren Maschinen.
Sirenenserver sind dazu bestimmt, Illusionen zu verbreiten. Sie sind verwandt mit einem anderen fiktiven Geschöpf, dem Maxwell’schen Dämon, benannt nach dem Physiker James Clerk Maxwell. In Maxwells Gedankenexperiment aus dem Jahr 1871 befindet sich der Dämon neben einer kleinen verschließbaren Öffnung, die zwei mit Wasser oder Luft gefüllte Behälter voneinander trennt. Der Dämon lässt die heißen Moleküle nur in die eine Richtung und die kalten Moleküle nur in die andere. Nach einer Weile wäre die eine Seite heiß und die andere kalt. Danach würde man sie sich wieder mischen lassen, was so schnell gehen würde, dass man damit einen Generator antreiben könnte. Durch die Unterscheidung zwischen heißen und kalten Molekülen könnte man unbegrenzt Energie erzeugen, weil sich der Vorgang endlos wiederholen lässt. Doch den Maxwell’schen Dämon gibt es nicht, denn für die Trennung benötigt man Energie.
Wir glauben, dass Rechnerleistung kostenlos ist, aber das ist sie nie. Der bloße Akt der Unterscheidung, ob ein Molekül heiß oder kalt ist, erfordert Energie und führt daher zu Wärmeverlusten. Dieses Prinzip ist auch als No-Free-Lunch-Theorem bekannt – »nichts ist umsonst«.
Wir versuchen dennoch, den Maxwell’schen Dämon für unsere Zwecke in Anspruch zu nehmen, wenn wir die Realität mit unseren Technologien manipulieren, aber das gelingt uns nie so ganz. Wir hinken der Entropie immer hinterher. Alle Klimaanlagen in einer Stadt geben Hitze ab, wodurch die Stadt am Ende noch stärker aufgeheizt ist. Man kann zwar etwas einsetzen, was wie ein Maxwell’scher Dämon wirkt, wenn man nicht zu genau hinschaut, doch am Ende verliert man immer mehr, als man gewinnt.
Jedes Bit in einem Computer ist eine Art Möchtegern-Dämon, der für eine Weile, und zu bestimmten Kosten, den Zustand »eins« vom Zustand »null« trennt. Auch ein Computer in einem Netzwerk kann wie ein Möchtegern-Dämon agieren, wenn er versucht, Daten von vernetzten Personen auf die eine oder andere Seite der imaginären Tür zu sortieren, und dabei so tut, als seien damit keine Kosten oder Risiken verbunden. Beispielsweise könnte ein Sirenenserver nur diejenigen durch die Türöffnung lassen, die billig zu versichern sind, um so eine unnatürlich ideale Versicherungsgesellschaft mit sehr geringem Risiko zu schaffen. Die Personen, die ein hohes Risiko aufweisen, würden in die eine Richtung sortiert, die mit geringem Risiko in die andere Richtung. Es wäre ein Pseudo-Perpetuum-mobile, angewandt auf die menschliche Gesellschaft. Allerdings würde die nicht-versicherte Welt nicht einfach aufhören zu existieren. Vielmehr würde sie die Kosten des Gesamtsystems erhöhen, zu dem auch diejenigen gehören, die den Sirenenserver betreiben. Eine kurzfristige Illusion der Risikoreduzierung würde langfristig sogar zu einem höheren Risiko führen.
Wo Sirenen locken
Zu den bekannten aktuellen Sirenenservern gehören die Hightech-Methoden der Finanzmärkte, etwa der Hochfrequenzhandel oder Derivatefonds, angesagte Unternehmen aus dem Silicon Valley wie Suchmaschinen und soziale Netzwerke, moderne Versicherungen, moderne Geheimdienste und noch viele weitere.
Die letzten Wellen der Hightech-Innovationen haben nicht in dem Maße Arbeitsplätze geschaffen wie frühere technische Neuerungen.19 Neue Kult-Unternehmen wie Facebook beschäftigen deutlich weniger Mitarbeiter als die großen »klassischen« Firmen wie beispielsweise General Motors. Anders ausgedrückt, die Sirenenserver lenken einen Großteil der Produktivität gewöhnlicher Menschen in Richtung einer informellen Tausch- und Reputationswirtschaft, während sie das gewonnene altmodische Vermögen auf sich selbst konzentrieren. Jede Aktivität, die über digitale Netzwerke erfolgt, ist der Arbitrage unterworfen, das heißt, dass das Risiko dorthin geleitet wird, wo es schlechtere Rechnerleistung gibt.
Ein allgemeiner Ratschlag für unsere Zeit könnte daher lauten, dass man, um ein gutes Leben zu führen, mit dem Fortschreiten der Informationstechnologie seine technischen Kenntnisse verdoppelt und lernt, unternehmerisch und anpassungsfähig zu sein, denn diese Eigenschaften ermöglichen eine Position in der Nähe eines Sirenenservers.
Kurzfristig betrachtet ist es ein guter Rat, zu versuchen, so nah wie möglich an einen Sirenenserver heranzukommen. Dort werden die großen Vermögen unserer Zeit gemacht. Aber es wird nicht genügend Positionen im Umfeld eines Sirenenservers geben, um eine ganze Gesellschaft zu versorgen, es sei denn, wir ändern ein paar Dinge.