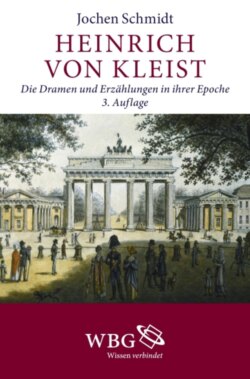Читать книгу Heinrich von Kleist - Jochen Schmidt - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Entstehung und Grundkonstellation
ОглавлениеSein dramatisches Erstlingswerk, das 1803 anonym erschien, schrieb Kleist 1802 in der Schweiz, und wie die Briefe aus dieser Zeit steht es ganz im Zeichen Rousseaus. Der erste Entwurf trug den Titel Die Familie Thierrez, darauf folgte eine schon ausgearbeitete Fassung mit dem Titel Die Familie Ghonorez, das Geschehen sollte also ursprünglich in Spanien spielen. Daß Kleist für das Stück, das von despotischer Willkür und bereits am Anfang von einer zu Haß und Fanatismus treibenden Religion bestimmt ist, gerade diesen Schauplatz wählte, entspricht einem Stereotyp der zeitgenössischen Literatur: Spanien galt als Land der Despotie und des religiösen Fanatismus. Zu dieser Vorstellung hatte die in Spanien besonders harte Inquisition beigetragen, noch mehr aber die blutige Unterdrückung der Niederländer, die in einem langen Kampf das spanische Joch abgeworfen hatten. Schiller beschrieb diesen Befreiungskampf im Abfall der Vereinigten Niederlande, und Goethe stellte ihn im Egmont so dar, daß die spanische Tyrannei voll zum Ausdruck kam. Vor allem behandelte Schiller im Don Karlos, den Kleist mit Begeisterung las1 , die weltliche und geistliche Despotie am Beispiel Spaniens. Selbst noch im Faust finden sich davon Spuren, denn als Mephisto mit Faust in Auerbachs Keller erscheint, wo er alsbald ein gegen die Monarchie und ihr Höflingswesen gerichtetes Freiheitslied anstimmt, sagt er bezeichnenderweise zur Vorstellung die Worte: „Wir kommen erst aus Spanien zurück“ (V. 2205). Als Land der Tyrannei und des religiösen Fanatismus repräsentierte Spanien zugleich den Fluch eines unaufgeklärten Zustands – die Wahl eines spanischen Schauplatzes hätte eine für die Zeitgenossen sofort erkennbare Bedeutung gehabt.
Nach einem Bericht soll Ludwig Wieland, der Sohn Christoph Martin Wielands, Kleist dazu überredet haben, „das Stück nochmals umzuschreiben und die erst in Spanien vorgesehene Handlung nach der Schweiz zu verlegen“.2 Jedenfalls ersetzte Kleist alle ursprünglich spanischen Namen der Personen durch deutsche Namen. Der Schauplatz „Schwaben“ meint das mittelalterliche Schwaben, zu dem noch die erst später selbständige Schweiz gehörte. Statt das Mittelalter romantisch zu verklären, folgte Kleist einer für die Aufklärung typischen Sicht und setzte es als Chiffre für zurückgebliebene gesellschaftliche Zustände und religiösen Fanatismus ein.
Mehrere Äußerungen von Zeitgenossen deuten auf weitgehende Eingriffe von Freunden Kleists in den Text. Er selbst soll das Stück, an dem ihm nicht viel lag – in einem Brief vom 13. Und 14. März 1803 an seine Schwester Ulrike bezeichnete er es zunächst als „elende Scharteke“3 – einfach einigen Freunden zu Veränderungen nach ihrem Gutdünken überlassen haben. In einem Bericht seines Freundes Heinrich Zschokke heißt es: „Als uns Kleist eines Tages sein Trauerspiel Die Familie Schroffenstein vorlas, ward im letzten Akt das allseitige Gelächter der Zuhörerschaft, wie auch des Dichters, so stürmisch und endlos, daß, bis zu seiner letzten Mordszene zu gelangen, Unmöglichkeit wurde“.4 Der Grund hierfür dürfte in der Anhäufung von Schauer-Szenen liegen, die das Ganze schwer erträglich macht. Dennoch bescheinigen mehrere frühe Rezensionen dem Stück dichterische Genialität. Kleists gedankliche Grundpositionen zeichnen sich durch die krassen Übertreibungen überdeutlich ab.
Die Basis der Handlung bildet das Zerwürfnis zwischen den beiden Linien des Hauses Schroffenstein. Die Schroffensteiner aus dem Hause Warwand leben mit denen aus dem Hause Rossitz in Feindschaft, weil ein Erbvertrag besteht, demzufolge beim Aussterben der einen Linie die andere den Besitz übernimmt. Daraus entsteht verhängnisvolles Mißtrauen, da jede der beiden Linien glaubt, die andere strebe nach ihrer Vernichtung, vor allem nach der Beseitigung der Erben, um den Besitz übernehmen zu können. Nachdem der jüngste Sohn des Grafen Rupert von Rossitz durch einen unglücklichen Zufall zu Tode gekommen ist, kennt zwar niemand den wahren Sachverhalt, aber da man aufgrund des Erbvertrages im Hause Rossitz den Warwandern mißtraut, werden diese des Mordes verdächtigt.
Die Tragödie setzt damit ein, daß die Rossitzer in der Kapelle ihres Schlosses den Angehörigen des Hauses Warwand blutige Rache schwören. Auch Ottokar, der ältere Sohn des Hauses Rossitz, tut diesen Racheschwur, ohne zu wissen, daß Agnes, das Mädchen, das er liebt, eine Tochter aus dem Hause Warwand ist. Offenkundig orientierte sich Kleist an Shakespeares Tragödie Romeo und Julia: Zwei Kinder aus tödlich verfeindeten Vaterhäusern lieben sich. Doch modifizierte Kleist diese Konstellation auf bezeichnende Weise, um seine von Rousseau inspirierte Gesellschaftskritik zu verschärfen: Bei ihm gehören die beiden Liebenden nahe verwandten Häusern einer Adels-„Familie“ an. Als Ottokar entdeckt, wen er liebt, versucht er die verfeindeten Häuser miteinander zu versöhnen, doch scheitert er am blinden Haß seines Vaters, Rupert vom Hause Rossitz. Dieser läßt sogar einen Unterhändler erschlagen, der die Vermittlung übernimmt; und auch daß sich sein Kontrahent, Sylvester vom Hause Warwand, um Ausgleich und Verständigung bemüht, hilft nichts, denn Rupert ist in seinem Haß vollständig unzugänglich geworden. So nimmt das Unheil seinen Lauf. Ottokar und Agnes treffen sich in einer einsamen Höhle, werden dort aber von den Rossitzern überrascht. Um Agnes zu retten, gibt Ottokar ihr seinen Mantel und legt dafür den ihrigen um. Im Glauben, es sei die Tochter des Feindes, ersticht Rupert den eigenen Sohn Ottokar. Als Agnes sich über den Sterbenden wirft, hält Sylvester, der mit den Warwandern hinzukommt, sie für Ottokar, und in der Annahme, er töte den Mörder seiner Tochter, bringt er diese selbst um. Am Ende erkennen beide Familien, daß sie jeweils das eigene einzige Kind ermordet haben, und schließlich stellt sich auch noch heraus, daß der jüngere Sohn aus dem Hause Rossitz, dessen Tod den Warwandern angelastet worden war, keineswegs von diesen erschlagen wurde, sondern ertrunken ist. Eine hinzukommende Frau aus dem Volk sagt, gewissermaßen als Epilog: „Wenn ihr euch totschlagt, ist es ein Versehen“ (V. 2705).
Den Satz „Wenn ihr euch totschlagt, ist es ein Versehen“ hat die Kleistforschung lange Zeit zum Anlaß genommen, um Kleists Erstlingswerk als Schicksalsdrama zu interpretieren. Diesem Deutungsmuster zufolge hätte Kleist, der in seinen Briefen immer wieder die Macht des Zufalls und des Schicksals beschwört5 , darstellen wollen, daß der Mensch blind den Zufällen, folglich dem Sinnlosen ausgeliefert ist und einer undurchschaubaren Wirklichkeit verfällt – ohne Möglichkeit, durch eigene Erkenntnis und eigenes Verhalten am Lauf der Dinge etwas zu ändern. Sein Drama wäre dann Vorläufer einer Literaturmode, die in den Jahren 1810 – 1818 in Gestalt der sogenannten ‚Schicksalsdramen‘ große Bedeutung erlangte. Sie gehen von der Grundidee aus, daß der Mensch nicht frei entscheiden und handeln könne, vielmehr schicksalhaften Zwängen unterliege. Das erste und am meisten Aufsehen erregende Stück unter diesen Dramen, Der vierundzwanzigste Februar, stammt von Zacharias Werner und wurde 1810 aufgeführt, 1815 erschien es im Druck. Ein Autor namens Adolf Müllner ließ 1812 ein Stück mit dem Titel Der neunundzwanzigste Februar folgen. Schon diese beiden Titel sind charakteristisch, denn sie deuten auf einen Schicksalstag, an dem das vorherbestimmte Verhängnis unvermeidbar eintrifft. Mit dem bekanntesten dieser Schicksalsdramen, Grillparzers 1817 erschienenem Erstlingswerk Die Ahnfrau, und Houbens Stück Die Heimkehr (1818 aufgeführt, 1821 gedruckt), fand diese Literaturmode ihr Ende.6 Sie ist weniger künstlerisch als von der historischen Psychologie her interessant, denn die Verhältnisse ganz vom Schicksal und vom Zufall her bestimmen heißt an der gestalterischen Kraft des Ichs und an der Möglichkeit zur Selbstbestimmung verzweifeln. Gefördert worden war diese fatalistische Haltung durch die Wirrnisse der Revolutionskriege und die Napoleonischen Kriege, in denen sich der einzelne als Spielball fremder Gewalten erfuhr.
Mit diesem Gefühl verband sich für Kleist der auch sein ganzes späteres Werk durchziehende Gedanke, daß das Leben oft von sinnlosen Zufällen abhängt. Charakteristisch ist die Art, wie er von einem Unfall erzählt, der ihm und seiner Schwester im Sommer 1801 auf der Fahrt nach Paris zustieß. „Wir hatten ihnen“, so schreibt er in einem Brief vom 18. Juli 1801 über die Pferde seines Reisewagens,
die Zügel abnehmen lassen vor einem Wirtshause, sie zu tränken u mit Heu zu futtern. Dabei war Ulrike so wie ich in dem Wagen sitzen geblieben, als mit einemmal ein Esel hinter uns ein so abscheuliches Geschrei erhob, daß wir wirklich grade so vernünftig sein mußten, wie wir sind, um dabei nicht scheu zu werden. Die armen Pferde aber, die das Unglück haben keine Vernunft zu besitzen, hoben sich hoch in die Höhe u giengen spornstreichs mit uns in vollem Carriere über das Steinpflaster der Stadt durch. Ich griff nach den Zügeln, aber die hiengen ihnen, aufgelöset, über der Brust, u ehe ich Zeit hatte, an die Größe der Gefahr zu denken, schlug schon der Wagen mit uns um, u wir stürzten – Und an einem Eselsgeschrei hieng ein Menschenleben? Und wenn es nun in dieser Minute geschlossen gewesen wäre, darum also hätte ich gelebt? Darum? Das hätte der Himmel mit diesem dunkeln, räthselhaften, irrdischen Leben gewollt, und weiter nichts –?7
Dieses Ereignis ist Kleist so wichtig, daß er es noch einmal in einem anderen Brief berichtet.8 Aus den beigefügten Reflexionen, die in polemischer Hypothese vom Willen des „Himmels“ sprechen, ergibt sich, daß solche sinnlosen Zufälle die Annahme einer Vorsehung ad absurdum führen. Wo ein Eselsgeschrei dem Leben ein Ende zu setzen vermag, fällt es schwer, an Vorsehung, ja überhaupt an einen Sinn zu glauben. Wenn Kleist, durchaus an eine schon literarisch und philosophisch thematisierte Krisendiagnose anschließend9 , in seinem Werk an Schicksalhaftigkeit grenzende Geschehnisse und Zufälle inszeniert, die jeden Glauben an einen höheren Sinn dementieren, so allerdings nur, um eine höhere Sinngarantie zu bestreiten und andererseits die Grenzen menschlicher Freiheit zu betonen, aber nicht um diese Freiheit grundsätzlich und vollständig zu negieren. Einseitig ist es daher, wenn man das Erstlingswerk und auch manches spätere ganz unter den Begriff des Schicksals und des Zufalls stellt, wie Gerhard Fricke in seinem Buch Gefühl und Schicksal bei Heinrich von Kleist und nach ihm viele andere. Zwar ist für Kleist die Schicksals- und Zufallsabhängigkeit wichtig, aber doch nur als ein Faktor. Der andere ist die menschliche Vernunft. Natürlich beginnen hier weitere Fragen. Kann sich die Vernunft und damit die menschliche Freiheit gegenüber den objektiv determinierenden Faktoren durchsetzen? Und unter welchen Bedingungen?
Kleist antwortet auf diese Fragen im Sinne eines aufgeklärten Pessimismus. Aufgeklärt und aufklärerisch insofern, als er die historisch entstandenen gesellschaftlichen Strukturen kritisiert. Das historisch Relativierbare und Kritisierbare kann aber kein blind hinzunehmendes „Schicksal“ sein; Fatalismus im strengen Sinn des Wortes ließe keine Kritik mehr zu. Pessimistisch ist seine Kritik insofern, als er die faktische Verfallenheit der Menschen an die Verhältnisse darstellt; die von ihm entworfenen Gestalten sind oft unfrei, weil unfähig, ihre Vernunft walten zu lassen, und daraus ergibt sich ihr tragisches Verhängnis.
Auch das rein Irrationale des Zufalls bringt Kleist häufig ins Spiel, doch bestimmen die Zufälle das Geschehen meistens nicht im Sinne eines unentrinnbaren Schicksals, vielmehr werden sie zu Stützpunkten von falschen Verhaltensweisen und Vorurteilen. Der Zufall aktualisiert diese nur, indem er ihnen scheinbar recht gibt. Manchmal, wie in der Familie Schroffenstein, wird ein an sich bedeutungsloser Zufall erst durch die Deutung geschichtsmächtig, die ihm das schon bestehende und seinerseits gesellschaftlich bedingte Vorurteil verleiht. Damit aber erweist sich nicht der Zufall, sondern das Vorurteil, das sich seiner bemächtigt, als eigentlicher Grund des verhängnisvollen Geschehens. Zugleich allerdings spielt auch eine spezifische Orientierungsschwäche der Menschen in das Geschehen hinein. Aus mehreren Dialogpartien geht hervor, daß die äußere Wirklichkeit so scheinhaft und trügerisch sein kann, daß Irrtümer nicht nur aus Vorurteilen entstehen, sondern auch aufgrund der Unfähigkeit der Menschen, die Tatsachen richtig zu erkennen. Selbst das Gefühl, sogar das Rechtsgefühl, kann in die Irre leiten, weil es nicht unabhängig von der nicht zuverlässigen, aber für zuverlässig gehaltenen Wahrnehmung der Tatsachen ist.10 Doch wirkt diese Orientierungsschwäche im Verhältnis zu den vorurteilshaften Einstellungen nicht als ausschlaggebend.
In der Familie Schroffenstein gehört der handlungsauslösende, weil das Vorurteil aktualisierende Zufall zur Vorgeschichte. Dem jüngsten Sohn des Hauses Rossitz, der tot aufgefunden wurde, ist der kleine Finger abgeschnitten worden. Man weiß nicht, von wem, aber der aufgrund des Erbvertrags in haßerfüllten Vorurteilen lebende Rupert von Rossitz nimmt diese Spur der Gewalt sofort zum Anlaß, um Sylvester von Warwand des Mordes zu bezichtigen. Eine unsinnige Verdächtigung, denn warum sollte ein Mörder gerade auf den kleinen Finger seines Opfers Wert legen? Ganz abgesehen davon, daß keine Spur von dem toten Sohn zum Haus Warwand führt. Die Wahrheit kommt erst am Schluß heraus: Eine Frau hat der Leiche des ertrunkenen Knaben aus einem abergläubischen Motiv den kleinen Finger abgeschnitten und mitgenommen.
In der Vorstufe zur Familie Schroffenstein, die den Titel Familie Ghonorez trägt, stehen allerdings folgende interessante Randnotizen Kleists: „Das Schicksal ist ein Taschenspieler“11 , „Man könnte eine Hexe aufführen, die wirklich das Schicksal gelenkt hätte“12 , „Ursula [so der Name der abergläubischen Frau] muß zuletzt, ihr Kind suchend, als Schicksalsleiterinn auftreten“.13 Kleist selbst spielt hier mit dem Begriff eines irrationalen Schicksals. Dennoch ist in dem ausgeführten Drama der durch Zufall abgeschnittene Kindesfinger nur der äußere Anlaß eines Geschehens, dessen eigentliche Ursache tiefer liegt.
Schon die erste Szene ist ganz rousseauistisch und zugleich von der antiklerikalen aufklärerischen Tendenz bestimmt, der Kleist auch sonst gerne folgt. In der Kapelle des Schlosses Rossitz schwören die Mitglieder der Familie Rache „auf die Hostie“ (V. 23). Man empfängt das Abendmahl, um den Racheschwur vor Gott bindend zu machen. Und als Ruperts Frau aus einem richtigen Gefühl heraus widerstrebt, gibt er ihr den erbaulichen Rat: „Würge sie betend“ (V. 39), womit er die Warwander meint, denen man Rache wegen des angeblichen Kindesmordes schwört. Das alles ist gewaltsam übertrieben wie vieles in Kleists erstem Stück. Scharf kritisiert er die Religion, die nur zur ideologischen Legitimation dient, und die Kirche, insofern sie den bestehenden, gesellschaftlich bedingten Vorurteilen bis hin zu tödlichem Haß Vorschub leistet. In der Schloßkirche spielt sich ein perverser Exzess ab, der das christliche Gebot der Nächstenliebe in sein Gegenteil verkehrt. In Anbetracht des menschlich-natürlichen Widerstrebens seiner Frau sagt Rupert: „[…] nichts mehr von Natur“ (V. 42). Damit steht alles folgende Geschehen ganz nach Rousseau im Zeichen des Abfalls der Gesellschaft von der Natur.
Eine nachgeholte Exposition läßt erkennen, daß dieses Verhalten aus der Festlegung auf das Eigentum resultiert, aus der Bindung an einen Erbvertrag, „kraft dessen nach dem gänzlichen Aussterben / Des einen Stamms, der gänzliche Besitztum/Desselben an den andern fallen sollte“ (V. 180ff.). Diese Auskunft gibt der Kirchenvogt des Hauses Rossitz einem Verwandten namens Jeronimus, der zwischen den beiden verfeindeten Häusern vermitteln möchte und deshalb den Grund der Verfeindung zu erfahren sucht. Kleist verwendet ein ebenso einfaches wie wirkungsvolles Mittel, um den Leser auf die Schlüsselfunktion des Erbvertrages für das gesamte Geschehen zu stoßen. Zunächst versteht Jeronimus nicht, daß der Erbvertrag die eigentliche Ursache für die schlimme Verfeindung zwischen den beiden Familien ist; die Geschichte vom Erbvertrag hält er nur für beiläufiges Geschwätz des alten Kirchenvogts, und deshalb mahnt er ihn: „Zur Sache, Alter! das gehört zur Sache nicht“. Worauf der Kirchenvogt bedeutungsvoll beharrt: „Ei, Herr, der Erbvertrag gehört zur Sache. / Denn das ist just als sagtest du, der Apfel / Gehöre nicht zum Sündenfall“. Mittels solchen Insistierens erreicht es Kleist, daß der Leser über die Geschichte vom Erbvertrag nicht wie über irgendein Detail hinwegliest, sondern sie als Angelpunkt des gesamten Geschehens wahrnimmt.
Nicht also ein blind waltendes Schicksal, sondern ein gesellschaftlicher, nach Rousseau der gesellschaftliche Mißstand in Gestalt der Eigentums-Fixierung bestimmt das Geschehen; er entfesselt eine Hölle von Angst, Verdacht und Aggression, der schließlich beide Häuser, Warwand und Rossitz, zum Opfer fallen – bis es nach dem Tod der Kinder keine Erben mehr gibt. Die von dem Vermittler Jeronimus und Sylvester, dem vernünftiger und innerlich freier gebliebenen Chef des Hauses Warwand, wiederholt angesetzte Analyse führt immer nur zu dem Ergebnis, daß alle Verdächtigungen keinen sachlichen Anhaltspunkt haben, sie beruhen nur auf Gerücht und Gerede. Gerücht und Gerede wuchern überall14 , und die meisten Akteure machen sich nicht die Mühe, den Wahrheitsgehalt zu prüfen, weil sich das Vorurteil im Gerücht bestätigt fühlt.