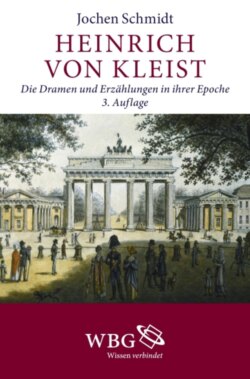Читать книгу Heinrich von Kleist - Jochen Schmidt - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Mißerfolg der Weimarer Aufführung und die Bedeutung des ursprünglichen Schlusses für das Gesamtverständnis
ОглавлениеAus der Strukturanalyse ergibt sich eine klare Gliederung in fünf aktartige Handlungseinheiten. Der einzige Grund, warum Kleist das Stück nicht in Akte einteilte, dürfte die dichte Geschlossenheit des Geschehens sein. Sie kommt zustande durch die konkrete Einheit des Ortes – die niederländische Gerichtsstube – und durch die sinnfällige zeitliche Kontinuität der Gerichtsverhandlung. Dennoch resultiert daraus keine dramaturgische Notwendigkeit, das Stück in einem Zuge, ohne Akteinschnitt, im Theater also ohne Vorhang zu spielen, wie immer wieder angesichts eines der berühmtesten Theaterskandale in der deutschen Literaturgeschichte behauptet wurde. Er wirkte sich sowohl auf Kleist wie auch auf die endgültige Gestalt des Zerbrochnen Krugs aus. Goethe inszenierte als Weimarer Theaterdirektor das Drama in Akten, in drei Akten allerdings, nicht in fünf. Aber der Dreiakter komprimiert nur das klassische Fünfaktschema, denn er nimmt die Schürzung des Knotens, die im Fünfakter zum zweiten Akt gehört, in den ersten hinein und plaziert die entscheidende Peripetie, die sich im Fünfakter meistens im vierten Akt befindet, im dritten. Indem Goethe den Zerbrochnen Krug in drei Akte einteilte, verstieß er also nicht gegen die Struktur der sich tatsächlich zu aktähnlichen Einheiten zusammenschließenden Handlung – prinzipiell wenigstens nicht, denn wo er die Aktgrenzen tatsächlich zog, läßt sich nicht mehr mit Sicherheit feststellen.
Zum Mißerfolg, für den Kleist fälschlicherweise Goethe verantwortlich machte35 , geriet die Aufführung des Lustspiels aus einem anderen Grund, der bei Kleist selbst lag. Denn das in Weimar aufgeführte Stück hatte noch eine wesentlich andere Schlußpartie als das heute in den Kleist-Ausgaben abgedruckte. In der Gestalt, die wir kennen, schuf Kleist den Zerbrochnen Krug erst nach der Weimarer Aufführung und höchstwahrscheinlich aufgrund der Kritiken, die diese Aufführung auslöste. In der ursprünglichen Fassung, nach deren Text in Weimar gespielt wurde, stand an der Stelle des späteren, knapp-epiloghaften zwölften Auftritts, der die Versöhnung des Liebespaars enthält und die Folgen für Adam in eine leidlich versöhnliche Perspektive rückt, eine außerordentlich umfangreiche Schlußpartie, der von Kleist später selbst so genannte Variant. Daß dieser Variant in der Weimarer Aufführung gespielt wurde und daß er die eigentliche Ursache des Mißerfolges war, läßt sich anhand eines Berichts über die Aufführung in der Allgemeinen deutschen Theaterzeitung vom 11. März 1808 nachweisen. „Nun müssen wir noch“, so heißt es in diesem Bericht, „den zweiten und den (das ganze Stück verdarb dritthalb Stunden) eine Stunde währenden, dritten Akt, alles ein einziges Verhör, mit anhören“; dabei, so fährt der Kritiker fort, sei die Darstellerin des Evchens „die eigentliche plagende Erzählerin“ gewesen.36 Hier liegt in der Tat die entscheidende Schwäche des ursprünglichen Schlusses. Evchen erzählt darin noch einmal und ausführlich alles, was der Zuschauer aus der vorangehenden Handlung auf wirklich spannende Weise schon erfahren hat. Zu Recht nennt deshalb der zeitgenössische Kritiker Eve eine „plagende Erzählerin“. Auch die von ihm kritisierte Überlänge des dritten Aktes kommt nur durch die ursprüngliche Schlußpartie zustande. Die in Weimar gespielte Fassung hat 2429 Verse, die endgültige nur noch 1974 Verse. Diese Differenz von 455 Versen oder 20% des Gesamtumfangs macht deutlich, wie überschwer allein schon in quantitativer Hinsicht der abschließende Teil war.
Wichtiger als diese formale Disproportion ist die dramaturgische Fehlleistung des ursprünglichen Schlusses. Die detaillierte Schilderung des Hergangs in Eves rückblickendem Bericht wirkt so schwerfällig wie überflüssig. Ein charakteristisches Detail: Als Adam zu Beginn der Gerichtsverhandlung (V. 498 – 549) hört, bei Eve sei ein Krug zerbrochen, sagt er für sich: „Verflucht! […] / – Es klirrte etwas, da ich Abschied nahm –“. Licht schreckt ihn auf: „Herr Richter! Seid ihr –?“ („Seid ihr taub?“ will er fragen, da Adam Walters Anweisungen für den Beginn der Verhandlung überhört). Adam bezieht diesen Frage-Ansatz irrtümlich sofort auf seine nächtliche Übeltat und glaubt sich schon ertappt: „Ich? Auf Ehre nicht! / Ich hatte sie behutsam drauf gehängt, / Und müßt ein Ochs gewesen sein“. Der bereits hellhörige Leser oder Zuschauer bemerkt sehr wohl, daß „sie“ die zuvor schon vermißte Perücke ist und daß das „drauf“ den Krug meint. Solch enthüllendes Versteckspiel macht die direkte und breitangelegte Schilderung in der ursprünglichen Schlußpartie überflüssig, ja die Direktheit und Ausdrücklichkeit dieser Schilderung vernichtet den Reiz des indirekten Erkennens. Es wirkt als beschwerliche Wiederholung, wenn Eve von Richter Adams Gebaren in ihrer Kammer berichtet: „Und nimmt sich die Perücke förmlich ab, / Und hängt, weil der Perückenstock ihm fehlt, / Sie auf den Krug dort […]“ (V. 2209).
Endlich fällt der ursprüngliche Schluß gegenüber den früheren Partien des Lustspiels ab, weil nun Adam fehlt – mit seinen ergötzlichen Finten und seiner Vitalkomik war er bisher die Hauptquelle des lustspielhaften Vergnügens. Kein vergleichbares Lustspiel-Element ersetzt sie. So verstärkt sich auch in dieser Hinsicht der Eindruck, es handle sich um einen Appendix eigener Art.
Obwohl Kleist das Scheitern der Weimarer Aufführung im Jahre 1808 zunächst Goethe anlastete, zog er dann doch eine konstruktive Konsequenz. Für die Buchausgabe des Zerbrochnen Krugs von 1811 plazierte er an der Stelle des weit und umständlich ausholenden ursprünglichen Schlusses ein kurzes, mit wenigen Strichen hingeworfenes Happy end. Dennoch blieb ihm der ursprüngliche Schluß so wichtig, daß er ihn als Variant im Anhang der Buchausgabe abdruckte. Er muß doch irgendein Defizit darin gesehen haben, daß dieser ursprüngliche Schluß wegfiel. Da wir von Kleist selbst hierzu keinerlei erläuternde Aussage besitzen, muß sich die Erklärung aus dem Variant selbst ergeben. Das Verständnis des in der Forschung heißumstrittenen Variants wirkt entscheidend auf eine adäquate Wahrnehmung des Zerbrochnen Krugs zurück. Vor allem geht es um die angemessene Bewertung der vieldiskutierten Vertrauenskrise zwischen Ruprecht und Evchen. Sie führt auch zu Konsequenzen für die Theater-Aufführung dieses Stückes, das zu den beliebtesten Repertoire-Nummern der deutschen Bühne gehört.37
Das Geschehen des Variants38 zeigt Evchen in einem Stadium, in dem sie von dem entlarvten Richter zwar nichts mehr zu befürchten hat, jedoch noch immer ein Opfer seiner Machenschaften ist. Denn Adam hat nicht nur die nächtliche Attacke auf Evchen unternommen, deren er nun überführt ist; er hat ihr auch eine lügenhafte Geschichte erzählt, derzufolge Ruprecht unter dem betrügerischen Vorgeben, er müsse für die Landmiliz Dienst tun, mit den anderen zum Militärdienst eingezogenen jungen Männern in ferne fieberverseuchte Kolonien verfrachtet werden solle. Mit dieser Lügengeschichte und der darauf aufbauenden Behauptung, nur er könne durch ein Attest Ruprecht vor diesem Los bewahren, suchte Adam Evchen sexuell gefügig zu machen. Entscheidend für das Geschehen im Variant ist es, daß Adam nicht etwa nur von der angeblich bevorstehenden Verschickung Ruprechts in die todbringenden Kolonien gesprochen hat, sondern zugleich auch noch davon, daß die Obrigkeit die zum Militär eingezogenen jungen Männer bewußt hinters Licht führe, indem sie vorgebe, es handle sich um normalen Militärdienst im Lande, während in Wahrheit die Einberufenen nach den Kolonien verschickt würden. Damit ist Evchen die Möglichkeit genommen, in irgendeine gegenteilige Versicherung Vertrauen zu setzen und sich zu beruhigen. Denn wenn der Gerichtsrat Walter als Vertreter der Obrigkeit ihr versichert, es treffe nicht zu, daß die jungen Männer in die Kolonie Batavia verschickt werden sollen, muß sie ja annehmen, es handle sich um die betrügerische Strategie der Obrigkeit, welche nach Adams Aussage die Bevölkerung bewußt täusche.
Die dialogische Situation ist kompliziert. Den Ausgangspunkt bildet Walters Versicherung, daß die Miliz „nach Batavia nicht eingeschifft“ wird (V. 2309), vielmehr „in Holland“ bleibt (V. 2310) – im Gegensatz zu Adams lügenhafter Darstellung. Da aber Adam zugleich (fälschlich) behauptete, daß die Obrigkeit die Bevölkerung hinters Licht führe, indem sie verbreite, die Miliz bleibe in Holland, glaubt Eve, Walter spiele als Vertreter der Obrigkeit dieses falsche Spiel. Der irreführenden Fährte folgend, auf die sie Adam gesetzt hat, antwortet sie deshalb auf Walters Versicherung bitter abwehrend (V. 2311): „Gut, gut, gut“, um dann Walters Aussage, „ein gemeiner, grober Betrug“ habe sie verführt (V. 2307 f.), abweisend zu parodieren: „Der Brief, den ich gesehen, war verfälscht; / Er las mirs aus dem Stegreif nur so vor“ (V. 2313f.). Eben dies hält sie für Walters obrigkeitlich-lügenhafte Version. Worte, die ja von vornherein im Verdacht der Lüge stehen, können sie nicht vom Gegenteil überzeugen. Deshalb antwortet sie auf Walters Entgegnung „Ja, ich versichr’ es dich“ (V. 2315) in noch bittrerem Ton, indem sie Walter der ihr suggerierten obrigkeitlichen Täuschungsabsicht verdächtigt: „O gnädger Herr! – / O Gott! Wie könnt Ihr mir das tun?“ (V. 2315f.). Und sie bekräftigt diese Meinung, indem sie zu dem begriffsstutzigen Ruprecht sagt: „Du hörst es, Alles, Alles, / Auch dies, daß sie uns täuschen sollen, Freund“ (V. 2324f.). In wachsender Hilflosigkeit hält ihr Walter entgegen: „Wenn ich mein Wort dir gebe –“, worauf sie mit nochmals gesteigerter Abwehr reagiert: „O gnädger Herr!“ (V. 2326). Wo Worte von vornherein (infolge von Adams seinerseits lügnerischer, für Eve aber nicht durchschaubarer Machination) als nicht vertrauenswürdig gelten, kann ihnen nicht vertraut werden. Deshalb zeugt Walters Replik: „Sieh da! So arm dein Busen an Vertrauen?“ (V. 2340) nur von seiner eigenen wachsenden Ratlosigkeit – ebenso wie seine alsbaldige Berufung auf Gegenseitigkeit: „Dir glaubt ich Wort vor Wort“ (V. 2342). Das hier so eindringlich beschworene „Wort“ hat ausgedient, weil es an sich die Wahrheit nicht versichern kann. Walter greift daher zu einem Mittel, das die Wahrheit seiner Worte beweist. Er macht sich selbst mit seinem Geld haftbar für den Fall, daß er, wie Eve immer noch glaubt, die Unwahrheit gesagt hat. Mit dem Beutel voller Gulden, den er ihr anbietet, könnte sie Ruprecht vom Militär und damit auch von der gefürchteten Verschickung in die Kolonien freikaufen. Walters Insistieren auf den „vollwichtig neugeprägten“ Gulden mit dem Antlitz des Spanierkönigs als Prägestempel macht ihr nachdrücklich klar, daß er mit der Echtheit und Gültigkeit der Gulden die Beweiskraft seines Angebots pointiert. Auf seine Nachfrage „So glaubst du jetzt, daß ich dir Wahrheit gab?“ antwortet sie: „Ob ihr mir Wahrheit gabt? O scharfgeprägte, / Und Gottes leuchtend Antlitz drauf. O Himmel39 / Daß ich nicht solche Münze mehr erkenne!“ (V. 2374 – 2377) Im Überschwang der nun durch einen schlagenden Beweis gewonnenen Einsicht, daß Walters Worte wahr sind, verklärt sie das Konterfei des Spanierkönigs – der den Niederländern verhaßt ist! (vgl. V. 1962 – 1965) – zu Gottes leuchtendem Antlitz. Dieser Überschwang und die Vorstellungsform, in der er sich artikuliert, entspringt der als geradezu erlösend empfundenen Befreiung von der Angst um Ruprechts Schicksal. Ihre abschließenden Worte in dieser Sache: „O Himmel! / Daß ich nicht solche Münze mehr erkenne!“ zeigen, wie sehr sie nachträglich erschrickt über die verfinsternde Macht des (von Adam verursachten) Mißtrauens, die sie zunächst sogar zögern ließ, die Beweiskraft der Gulden anzuerkennen. Festzuhalten ist, daß ausschließlich Adams lügenhafte Behauptung, die Obrigkeit wolle die Bevölkerung über die wirklichen Absichten bei der Truppenaushebung täuschen, Eve es unmöglich gemacht hat, Walters Worten zu vertrauen. Es handelt sich um eine objektive Unmöglichkeit zu vertrauen, nicht um einen Eve subjektiv anzulastenden Vertrauensmangel.40
Im Variant geht es um die Schwierigkeit Evchens, durch Walter dennoch wieder Vertrauen zu fassen. Mit großer dialektischer Kunst zeigt Kleist, wie schwierig es ist, ein einmal erschüttertes Vertrauen wiederherzustellen und damit die Basis allen menschlichen Miteinanders zu retten. Dieses Geschehen des Variants hat eine entscheidende psychologische Funktion für das Verständnis des Dramas: Daß Evchen selbst so gründlich dem Mißtrauen verfällt und verfallen muß, befähigt sie erst, Ruprechts Mißtrauen gegen sie zu verstehen.
Ruprecht ist ein schlichter Mensch von bäuerlichem Realismus, der gar nicht anders konnte als auf das von Eve geäußerte Verlangen nach unbedingtem Vertrauen zu antworten (V. 1176): „Was ich mit Händen greife, glaub ich gern“. Nun wird Eve im Variant selbst durch eine Krise des Vertrauens geführt, mit nicht minder triftiger Veranlassung als Ruprecht. Und wie sie Ruprecht zugerufen hat (V. 1164.): „Pfui, Ruprecht, pfui, o schäme dich, daß du / Mir nicht in meiner Tat vertrauen kannst“, so sagt nun Walter zu ihr (V. 2340): „Sieh da! So arm dein Busen an Vertrauen?“ Dieser Vorwurf ist im selben, nicht eben hohen Grade begründet wie derjenige Eves gegenüber Ruprecht. Wesentlich aber ist, daß sie, indem sie selbst in Ruprechts innere Lage gerät, Verständnis für sein Verhalten gewinnt. Ja, wie Ruprecht Eve, so muß Eve Walter um Verzeihung bitten: „O lieber, guter, edler Herr, verzeiht mir“ (V. 2372). Sie hat selbst erlebt, daß das Festhalten am Vertrauen in einer undurchsichtigen Welt oft kaum zu leisten ist, daß es Bedingungen unterliegt und deshalb ihre radikale Forderung nach unbedingtem Vertrauen ins Unmögliche ging. Genau besehen, kommt dieses Unmögliche schon in der bis ins „Jenseits“ reichenden Vertrauensforderung mit der Naivität und zugleich Komik unerfahrener Jugend zum Ausdruck, wenn sie zu Ruprecht sagt (V. 1171 – 1174): „Du hättest denken sollen: Ev ist brav, / Es wird sich alles ihr zum Ruhme lösen, / Und ists im Leben nicht, so ist es jenseits, / Und wenn wir auferstehn ist auch ein Tag“. Wäre dies ihr Anspruch noch am Schluß, so käme keine Versöhnung aus fröhlichem und leichtem Herzen zustande, und das Ende des Lustspiels wäre belastet. Erst die eigene Vertrauenskrise als Gegengewicht zu derjenigen Ruprechts bringt sie in einen höheren Stand menschlicher Erkenntnis. Und diese erst erlaubt ihr die Wiederherstellung der Harmonie mit Ruprecht aus vollem Herzen. So endet die ursprüngliche Fassung des Zerbrochnen Krugs in einer Reifung durch Selbsterkenntnis, und diese Selbsterkenntnis vollendet das Lustspiel, indem sie zu einer Quelle menschlichen Verstehens wird und die Liebe rettet.
Die Erkenntnis der Wahrheit, auf die das ganze analytische Spiel angelegt ist, stuft sich demnach dreifach. Erstens wird aufgedeckt, wer in Wahrheit den Krug zerbrochen hat. Zweitens entdeckt die durch Adam um die menschliche Möglichkeit des Vertrauens gebrachte Eve, daß Walter ihr, wie sie wörtlich sagt, „Wahrheit“ gibt, und damit findet sie zur menschlichen Fähigkeit des Vertrauens zurück. Drittens erkennt sie aber durch ihr eigenes lange dauerndes Mißtrauen gegenüber Walter in eben diesem Mißtrauen eine menschliche Schwäche, die sie Ruprecht verzeihen kann und die ihr schließlich eine neue und sogar tiefer reichende Verbindung zu ihm erlaubt. Kleist hat deshalb die neue Liebeserklärung Eves an Ruprecht unmittelbar nach der Erkenntnis der „Wahrheit“ plaziert, die sie von Walter erhält. Zu Beginn des Variants noch hatte Eve Ruprechts Bitte um Vergebung zurückgewiesen (V. 1913, 1919): „Geh, laß mich sein […] Du hörst. Ich will nichts von dir wissen“. Nun aber wendet sie sich Ruprecht herzlich und versöhnt zu.
Damit läßt sich abschließend auch die Frage beantworten, warum Kleist den Variant noch als Anhang zur Buchausgabe von 1811 abdrucken ließ. Der Variant enthält die psychologisch genau begründete Möglichkeit zur Versöhnung des Liebespaars, während der spätere kurze Schluß diesen Begründungsgang nicht enthält. Zwar ist der spätere Schluß aus den schon erörterten dramaturgischen Gründen erheblich besser, aber nur der frühere, in Gestalt des Variants vorliegende balanciert die Vertrauenskrise der Liebesleute, welche die Atmosphäre des Lustspiels bedroht, psychologisch aus.
Hat man sich mit dem Ergebnis zu resignieren, daß die dramaturgisch bessere Fassung die psychologisch unzureichende ist, die psychologisch überzeugende aber die dramaturgisch verfehlte? Viel eher ist aus dem genauen Verständnis der Funktion, welche der Variant hat, die praktische Folgerung für die Bühne zu ziehen, die dramaturgisch bessere endgültige Fassung sei so zu spielen, daß Eves unbedingte Vertrauensforderung an Ruprecht als nicht berechtigt erscheint. Die Zuschauer können des Übertriebenen in Eves Forderung nach absolutem Vertrauen durchaus innewerden, wenn die Darstellerin der Eve den Vertrauensanspruch wider alle Wahrscheinlichkeit und gar mit Jenseitsperspektive, bei aller rührenden Naivität, die sich darin ausdrückt, entschieden komisch spielt – so, daß die Überforderung Ruprechts zum Vorschein kommt. Dann können sich die Liebenden ohne die weiteren Umstände des Variants am Schluß wieder die Hände reichen.