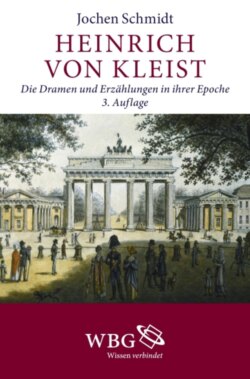Читать книгу Heinrich von Kleist - Jochen Schmidt - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Absage an die Militärlaufbahn
ОглавлениеKleists Jugend liegt wie manches in seiner Biographie2 weitgehend im Dunkel. Sein Vater starb im Jahre 1788, seine Mutter im Jahre 1793, so daß er bereits mit fünfzehn Jahren elternlos war. Nach dem mehrjährigen Besuch eines Berliner Erziehungsinstituts trat er 1792 in das in Potsdam stationierte Garderegiment ein. Bereits 1793 / 94 mußte er am Ersten Koalitionskrieg gegen Frankreich teilnehmen. Daran schlossen sich Garnisonsjahre in Potsdam an, in denen er seine besten Freunde gewann; aber sonst war diese Zeit, trotz mancher Studien, die er treiben konnte, öde und eintönig. Der Widerwille Kleists gegen den Militärberuf wuchs, er versuchte aus der vorgezeichneten Laufbahn auszubrechen.3 Angesichts der Familientradition bedurfte es dazu erheblichen Mutes, und außerdem war die materielle Zukunft ganz ungesichert. Aber Kleist tat den Schritt mit Entschlossenheit, um der Kaserne und dem Exerzierplatz zu entkommen. An seinen ehemaligen Lehrer Martini schrieb er am 18. und 19. März 1799:
Die größten Wunder militairischer Disciplin […] wurden der Gegenstand meiner herzlichsten Verachtung; die Offiziere hielt ich für so viele Exerciermeister, die Soldaten für so viele Sclaven, und wenn das ganze Regiment seine Künste machte, schien es mir als ein lebendiges Monument der Tyrannei. Dazu kam noch, daß ich den übeln Eindruck, den meine Lage auf meinen Charakter machte, lebhaft zu fühlen anfing. Ich war oft gezwungen, zu strafen, wo ich gern verziehen hätte, oder verzieh, wo ich hätte strafen sollen; und in beiden Fällen hielt ich mich selbst für strafbar. In solchen Augenblicken mußte natürlich der Wunsch in mir entstehen, einen Stand zu verlassen, in welchem ich von zwei durchaus entgegengesetzten Prinzipien unaufhörlich gemartert wurde, immer zweifelhaft war, ob ich als Mensch oder als Offizier handeln mußte; denn die Pflichten Beider zu vereinen, halte ich bei dem jetzigen Zustande der Armeen für unmöglich.4
Diese Entgegensetzung von humanen und militärischen Pflichten läßt das Humanitätsdenken der Aufklärung erkennen. Die Absage an das preußische Militär als das „lebendige Monument der Tyrannei“ erinnert an Lessings Wort, Preußen sei das „sklavischste Land von Europa“ (an Nicolai, 25. August 1769), und an sein Drama Minna von Barnhelm, in dem Major von Tellheim begründet, warum er den Militärdienst quittiert.
Allerdings sollte man den großen Brief an Christian Ernst Martini nicht naiv lesen. Kleist verfolgte mit seinen Briefen oft eine bestimmte Absicht, manchmal inszenierte er sogar ein phantasiereiches Rollenspiel. Ein amüsantes Beispiel für solche Selbstinszenierungen gibt der Brief vom 1. Mai 1802 an seine Schwester Ulrike. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich in der Schweiz, am Thuner See, am Fuße der Schweizer Zentral-Alpen und glaubte offensichtlich, der im märkischen Sand zurückgebliebenen Schwester mit einer Schweizer Geschichte aufwarten zu müssen. Zuerst erzählt er von einem „Mädeli“, und dann beginnt er auszumalen: „Sonntags zieht sie ihre schöne Schwyzertracht an, ein Geschenk von mir, wir schiffen uns über [über den Thuner See], sie geht in die Kirche nach Thun, ich besteige das Schreckhorn, u nach der Andacht kehren wir beide zurück“.5 Über das Schreckhorn aber, das Kleist während des Gottesdienstes bestiegen haben will, liest man im Konversationslexikon: „Kleines und großes Schreckhorn, zwei Gipfel des Finsteraarhornstocks im Kanton Bern, 3497 und 4080 m“. Auch der erwähnte Brief an Christian Ernst Martini vom 18. und 19. März 1799, der als eines der wichtigsten Zeugnisse des jungen Kleist gilt, ist nicht ohne weiteres als bare Münze zu nehmen. Die Absage an das Militär ist zwar ernstgemeint, die vorgebrachte Begründung mit ihrem auffälligen Humanitätspathos aber wohl weniger. Kleist schreibt ausführlich über seine Neigung zu den Wissenschaften, zu Physik und Mathematik vor allem; sogar dem Griechischen und dem Lateinischen will er sich widmen. Der Brief richtet sich an seinen alten Lehrer, von dem er Fürsprache bei den auf die Familientradition bedachten Verwandten erhofft. Kleist gibt einen Grund an, von dem er weiß, daß er bei dem Lehrer ‚ankommt‘: seine angebliche Neigung zu den Wissenschaften. Was der Brief außerdem enthält, ist die populäre Aufklärungsphilosophie über Tugend, Glück und Humanität. Die vorgeschützte Neigung zu den Wissenschaften hielt nicht lange, denn Kleist bewegte anderes. Zuerst aber ging er von April 1799 bis August 1800 zum Studium in seine Heimatstadt Frankfurt an der Oder. Da er sieben Jahre beim Militär verloren hatte, war er schon wesentlich älter als seine Kommilitonen. Sein eigentliches Studienfach war die Jurisprudenz, daneben widmete er sich auch der Mathematik, Physik und Philosophie; Latein verstand sich bei alledem von selbst. In dieser Zeit lernte er Wilhelmine von Zenge kennen, die Tochter des Frankfurter Regimentskommandanten, mit der er sich Anfang 1800 verlobte. Dieser Beziehung, die man nur unter Vorbehalt als Liebesbeziehung bezeichnen kann, entsprangen die schlimmsten Liebesbriefe der deutschen Literatur.6
Daß es mit der Liebe zu den Wissenschaften, die Kleist als Begründung für den Abschied vom Militär im Brief an den Lehrer Martini angegeben hatte, von Anfang an nicht zum Besten bestellt war, verrät bereits ein Brief, den er am 12. November 1799 an seine Schwester Ulrike schrieb:
Wenn man sich so lange mit ernsthaften abstrakten Dingen beschäftigt hat, wobei der Geist zwar seine Nahrung findet, aber das arme Herz leer ausgehen muß, dann ist es eine wahre Freude, sich einmal ganz seinen Ergießungen zu überlassen; ja es ist selbst nöthig, daß man es zuweilen in’s Leben zurückrufe. Bei dem ewigen Beweisen u Folgern verlernt das Herz fast zu fühlen; und doch wohnt das Glück nur im Herzen, nur im Gefühl, nicht im Kopfe, nicht im Verstande. Das Glück kann nicht, wie ein mathematischer Lehrsatz bewiesen werden, es muß empfunden werden, wenn es da sein soll. Daher ist es wohl gut, es zuweilen durch den Genuß sinnlicher Freuden von neuem zu beleben; u man müßte wenigstens täglich ein gutes Gedicht lesen, ein schönes Gemälde sehen, ein sanftes Lied hören – oder ein herzliches Wort mit einem Freunde reden, um auch den schönern, ich mögte sagen den menschlicheren Theil unseres Wesens zu bilden.7
Aufhorchen läßt hier, daß vor allem die Dichtung, die Kunst als Vermittlerin von Glückserfahrungen genannt wird – im Gegensatz zur Wissenschaft. Und daß Kleist von den „Ergießungen“ des „Herzens“ spricht, denen man sich einmal „ganz überlassen“ möchte, dürfte auf das literarische Gründungsmanifest der Frühromantik hindeuten: auf die von Wackenroder und Tieck im Jahre 1797 veröffentlichten Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders, die auch Spuren in seinem erzählerischen Werk hinterlassen haben. Mit großer Wahrscheinlichkeit kann man annehmen, daß Kleist bereits um 1800 nach Freiräumen suchte, in denen er sein Herzensbedürfnis nach Dichtung und Kunst stillen konnte; aber die Sorge um eine Existenz-Grundlage blieb. Bereits im Frühsommer 1800 siedelte er nach Berlin über, um eine Anstellung bei Hofe zu erhalten. Doch auch in der preußischen Metropole fand er nicht, was er suchte. Man stellte ihm einen Posten in der sogenannten ‚Technischen Deputation‘ in Aussicht, zu deren Aufgaben auch die Industrie-Spionage gehörte. Daß Kleist zur Probe sofort einen Spionage-Auftrag erhielt, dafür spricht ein Brief vom 25. November 1800 an seine Schwester Ulrike:
Bei mir ist es inndessen doch schon so gut, wie gewiß, bestimmt, daß ich diese Laufbahn nicht verfolge. Wenn ich aber dieses Amt ausschlage, so giebt es für mich kein besseres, wenigstens kein praktisches. Die Reise war das einzige, was mich reizen konnte, solange ich davon noch nicht genau unterrichtet war. Aber es kommt dabei hauptsächlich auf List und Verschmitztheit an, u darauf verstehe ich mich schlecht. Die Inhaber ausländischer Fabriken führen keinen Kenner in das Innere ihrer Werkstatt. Das einzige Mittel also, doch hinein zu kommen, ist Schmeichelei, Heuchelei, kurz Betrug – Ja, man hat mich in dieser Kunst zu betrügen schon unterrichtet – nein, mein liebes Ulrikchen, das ist nichts für mich.8
Kleists Situation spitzte sich zu: Nach der Absage an den Militärberuf stellte er auch das zivile Amt als Grundlage seiner materiellen Existenz in Frage. Daß er nun überhaupt jedes Amt ablehnte und somit den Gedanken an eine bürgerliche Existenz aufgeben wollte, dafür dürften zwei Gründe entscheidend gewesen sein. Der eine Grund ist in seiner dichterischen Neigung zu sehen, der andere in gesellschaftlichen Erfahrungen und auch in seiner Weigerung, sich den Verhältnissen anzupassen. Am 25. November 1800 schreibt er an die Schwester Ulrike, seine mit Abstand wichtigste Briefpartnerin und engste Vertraute:
Ich fühle mich nämlich mehr als jemals abgeneigt, ein Amt zu nehmen. Vor meiner Reise war das anders – jetzt hat sich die Sphäre für meinen Geist u für mein Herz ganz unendlich erweitert – das mußt du mir glauben, liebes Mädchen […] Als ich diesmal in Potsdam war, waren zwar die Prinzen, besonders der jüngere, sehr freundlich gegen mich, aber der König war es nicht – u wenn er meiner nicht bedarf, so bedarf ich seiner noch weit weniger. Denn mir mögte es nicht schwer werden, einen andern König zu finden, ihm aber, sich andere Unterthanen aufzusuchen.
Am Hofe theilt man die Menschen ein, wie ehemals die Chemiker die Metalle, nämlich in solche, die sich dehnen u strecken lassen, und in solche, die dies nicht thun – Die ersten, werden dann fleißig mit dem Hammer der Willkühr geklopft, die andern aber, wie die Halbmetalle, als unbrauchbar verworfen.9
Dieses Gleichnis von den Metallen, von denen sich die einen strecken und bearbeiten lassen, die anderen nicht, wobei Kleist keinen Zweifel daran läßt, daß er sich selbst nur mit den letzteren vergleichen will, ist eine vollkommene Definition der Nicht-Anpassung. Kleist wollte sich den gesellschaftlichen Verhältnissen nicht fügen und fühlte sich von früh an ganz entschieden als Außenseiter. Das ist für viele seiner Dichtungen von grundlegender Bedeutung: Immer wieder umkreisen sie den Konflikt des einzelnen mit der Gesellschaft, in die er sich nicht zu integrieren vermag. Charakteristischerweise hat Kleist eine Vorliebe für Gestalten, die sich entweder selbst isolieren oder von der Gesellschaft in die Rolle von Außenseitern gedrängt werden. Und immer wieder analysiert er die gesellschaftlichen Gründe dafür und gibt eine Antwort im Sinne Rousseaus.
Zum Zeichen, daß er sich keiner Konvention zu beugen und das Wertesystem der höheren Gesellschaft zu ignorieren gedachte, wollte er sogar seinen Adelstitel ablegen, und über Jahre hinweg unterschrieb er seine Briefe nicht mehr mit dem Adelsprädikat „von“, sondern schlicht als „Heinrich Kleist“. Aber das ist ebenso wie die Weigerung, ein Amt zu übernehmen, nur die Oberfläche einer viel tiefer reichenden persönlichen Abneigung, sich in den gesellschaftlichen Umgang einzufügen. Kleist litt in der Wirklichkeit gerade unter dem Rollenspiel, das er später in seiner Dichtung so meisterlich gestaltete. Das wohl wichtigste Zeugnis hierfür ist der lange Brief, den er am 5. Februar 1801 an die Schwester schrieb. Darin heißt es:
Ach, liebe Ulrike, ich passe mich nicht unter die Menschen, es ist eine traurige Wahrheit, aber eine Wahrheit; u wenn ich den Grund ohne Umschweif angeben soll, so ist es dieser: sie gefallen mir nicht. Ich weiß wohl, daß es bei dem Menschen, wie bei dem Spiegel, eigentlich auf die eigne Beschaffenheit beider ankommt, wie die äußern Gegenstände darauf einwirken sollen; u mancher würde aufhören über die Verderbtheit der Sitten zu schelten, wenn ihm der Gedanke einfiele, ob nicht vielleicht bloß der Spiegel, in welchen das Bild der Welt fällt, schief u schmutzig ist. Indessen wenn ich mich in Gesellschaften nicht wohl befinde, so geschieht dies weniger, weil Andere, als vielmehr weil ich mich selbst nicht zeige, wie ich es wünsche. Die Nothwendigkeit, eine Rolle zu spielen, und ein innerer Widerwillen dagegen machen mir jede Gesellschaft lästig, u froh kann ich nur in meiner eignen Gesellschaft sein, weil ich da ganz wahr sein darf. Das darf man unter Menschen nicht sein, u keiner ist es – Ach, es giebt eine traurige Klarheit, mit welcher die Natur viele Menschen, die an dem Dinge nur die Oberfläche sehen, zu ihrem Glücke verschont hat. Sie nennt mir zu jeder Miene den Gedanken, zu jedem Worte den Sinn, zu jeder Handlung den Grund – sie zeigt mir Alles, was mich umgiebt, u mich selbst in seiner ganzen armseeligen Blöße u dem Herzen ekelt zuletzt vor dieser Nacktheit – – Dazu kommt bei mir eine unerklärliche Verlegenheit, die unüberwindlich ist, weil sie wahrscheinlich eine ganz physische Ursache hat. Mit der größten Mühe nur kann ich sie so verstecken, daß sie nicht auffällt – o wie schmerzhaft ist es, in dem Äußern ganz stark u frei zu sein, indessen man im Innern ganz schwach ist, wie ein Kind, ganz gelähmt, als wären uns alle Glieder gebunden, wenn man sich nie zeigen kann, wie man wohl mögte, nie frei handeln kann, u selbst das Große versäumen muß, weil man vorausempfindet, daß man nicht standhalten wird, indem man von jedem äußern Eindrucke abhangt u das albernste Mädchen oder der elendeste Schuft von élégant uns durch die matteste persifflage vernichten kann. – Das Alles verstehst Du vielleicht nicht, liebe Ulrike, es ist wieder kein Gegenstand für die Mittheilung, u der Andere müßte das Alles aus sich selbst kennen, um es zu verstehen.10