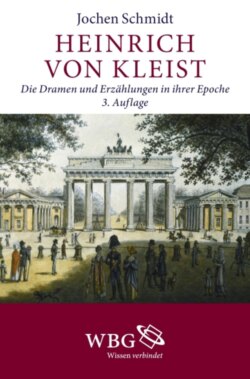Читать книгу Heinrich von Kleist - Jochen Schmidt - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Inszenierung der ‚Kant-Krise‘: Abwendung von den Wissenschaften und Entscheidung für das „schriftstellerische Fach“
Оглавление„mir flüstert eine Ahndung zu,
daß mir mein Untergang bevorsteht –“
(Kleist an seine Braut, 9. April 1801)11
Die sogenannte Kant-Krise markiert die Schwelle zum dichterischen Schaffen und gehört zu den in der Forschung oft diskutierten Problemen. In dem berühmten Brief an seine Braut vom 22. März 1801 widerruft Kleist sein Interesse an den Wissenschaften, das er erst zwei Jahre zuvor dem Lehrer Christian Ernst Martini als Grund für die Aufgabe der militärischen Laufbahn angegeben hatte; er begründet diese Absage mit dem Hinweis auf Kants philosophische Erkenntniskritik. Durch sie habe er einsehen müssen, daß er sich nicht mehr der wissenschaftlichen Arbeit widmen könne, denn eine sinnvolle wissenschaftliche Arbeit setze die Möglichkeit voraus, sichere Erkenntnis zu gewinnen und damit Wahrheit zu erlangen.
Oft sind in der Kleistforschung die Formulierungen des Briefes über die erschütternde Wirkung der sogenannten Kant-Krise wiederholt worden, man glaubte in ihm ein Zeugnis dafür zu besitzen, wie fundamental die Beschäftigung mit Philosophie das Leben verändern könne. Eine Folge dieser Lesart war es, daß man Kleists Kant-Lektüre genau und umfassend untersuchte.12 Dieser Aufwand war indes nur begrenzt sinnvoll, denn Kleists Briefe lassen erkennen, daß er sich schon Monate vor der sogenannten Kant-Krise von den Wissenschaften abwandte, und keineswegs, weil er grundsätzlich an den Möglichkeiten sicherer Erkenntnis zweifelte, sondern weil die Beschäftigung mit den Wissenschaften ihren Reiz für ihn verloren hatte. Als Veranlassung seiner bevorstehenden Reise nach Paris meldet er seiner Braut: „Es war im Grunde nichts, als ein innerlicher Ekel vor aller wissenschaftlichen Arbeit“.13 Überdruß ist für die Abkehr von der Wissenschaft maßgebend. Nicht Wissenschaft als Erkenntnisproblem, sondern Wissenschaft als Beschäftigung und als Lebensform veranlaßte Kleist zu seiner radikalen Absage. Wenn er sich dennoch auf Kant bezieht, so versucht er damit seinen aus ganz anderen Motiven gefaßten Entschluß durch Berufung auf eine anerkannte Autorität zu legitimieren. Wenn aber die angeblich durch Kant gewonnene theoretische Einsicht nicht der wahre Grund für Kleists neue Lebenswendung ist, dann kann man auch nicht mehr von einer Kant-Krise sprechen. Es handelt sich wieder einmal um eine bloße Inszenierung, wie schon in der phantastischen Geschichte von der Ersteigung des Schreckhorns und in dem Brief an den Lehrer Martini.
Bereits im Brief vom 5. Februar 1801 an Ulrike heißt es: „Selbst die Säule, an welcher ich mich sonst in dem Strudel des Lebens hielt, wankt – – Ich meine, die Liebe zu den Wissenschaften. […] Wissen kann unmöglich das Höchste sein […]“: „Mir ist es unmöglich, mich wie ein Maulwurf in ein Loch zu graben u Alles Andere zu vergessen“ (200). Ein ähnliches Bild verwendet Kleist im Hinblick auf die drohende Verbeamtung: „Indessen sehe ich doch immer von Tage zu Tage mehr ein, daß ich ganz unfähig bin, ein Amt zu führen. […] Diese Menschen sitzen sämmtlich wie die Raupe auf einem Blatte, jeder glaubt seines sei das Beßte, u um den Baum bekümmern sie sich nicht“ (197f.). Schon Monate vorher äußert sich Kleist wiederholt voller Abneigung zu der bevorstehenden Verbeamtung. Nichts von Erkenntniszweifel, nichts von philosophischen Erwägungen, die der Kantbrief dann als die angeblich entscheidenden darzustellen versucht, sondern eine existentielle Unmöglichkeit, sich mit dem Los des beschränkten Spezialisten und der entsprechenden Lebensform abzufinden.
Das eigentliche Motiv für die einschneidende Entscheidung gegen Amt und Wissenschaft, wobei man „Wissenschaft“ hier nur als die Aneignung der für die Ausübung eines praktischen Berufs erforderlichen Grundkenntnisse zu verstehen hat, ist demnach die Abneigung gegen einengende und fixierende Spezialisierungszwänge. Die sogenannte „Wissenschaft“14 – das Erlernen der theoretischen Voraussetzungen für die berufliche Praxis – erscheint lediglich als Unterfunktion des Amtes und deshalb auch nur unter dem Aspekt unerwünschter Beschränkung. Die früher immer wieder zum höchsten Ziel der Wissenschaft erklärte „Wahrheit“ wird im selben Brief vom 5. Februar 1801, sechs Wochen vor der sogenannten Kantkrise, gerade nicht in den Bedingungen der Möglichkeit zu ihrer Erkenntnis, nicht transzendentalphilosophisch angezweifelt, vielmehr bezeichnenderweise als Ziel und pragmatisch vollständig abgewertet: „Aber auch selbst dann“, schreibt Kleist, „wenn bloß [!] Wahrheit mein Ziel [!] wäre, – ach, es ist so traurig, weiter nichts, als gelehrt zu sein“ (200). Daraus geht hervor, wie der zu Unrecht berühmt gewordene Zentralsatz der angeblichen Kant-Krise zu bewerten ist: „Mein einziges, mein höchstes Ziel [!] ist gesunken, und ich habe nun keines mehr – Seit diese Überzeugung, nämlich, daß hienieden keine Wahrheit zu finden ist, vor meine Seele trat, habe ich nicht wieder ein Buch angerührt“.15 Wenn schon vorher davon die Rede ist, daß es ja „bloß“ um Wahrheit gehe und diese ihm an sich schon als wenig erstrebenswertes „Ziel“ erscheine, dann ist es ganz unglaubwürdig, daß Kleist nun von der „Wahrheit“ als seinem bisher angeblich „höchsten Ziel“ spricht. Die schon gefallene Entscheidung erhält nachträglich eine philosophische Scheinlegitimation. Das zeugt durchaus von innerer Konsequenz, denn wenn die Liebe zu den „Wissenschaften“ und zur „Wahrheit“ kein ernstzunehmender, sondern nur ein vorgeschobener Grund für den Abschied von der militärischen Laufbahn war, dann mußte diese Fassade über kurz oder lang einstürzen – auch ohne die angebliche Kant-Krise. Sie ist ebenso eine inszenierte Scheinkrise wie es sich früher um eine inszenierte Scheinliebe zu den „Wissenschaften“ und zur „Wahrheit“ handelte. Kleist wollte Dichter werden, wagte es aber noch nicht offen zu sagen, denn das galt in Preußen nicht als ehrenhaft. Verächtlich sagte der königliche Flügeladjutant von Köckeritz später zu ihm, er sei ja einer, der „Verschen mache“.16
Kleist selbst war sich der inneren und äußeren Schwellensituation des Jahres 1801 bewußt. Zug um Zug hatte er die gesellschaftlichen Zwänge abgeschüttelt, um sich als Dichter frei entfalten zu können. Unmißverständlich geht das aus einem Brief an Wilhelmine von Zenge vom 13. November 1800 hervor. Den Tenor bilden Aussagen wie: „Ich will kein Amt nehmen“, „ich passe mich für kein Amt“, „ich darf kein Amt wählen“ (150 ff.). Die Entscheidung, eine gesicherte Existenz aufzugeben und auf eine gemeinsame Zukunft mit seiner Braut zu verzichten, der er diesen Brief schreibt, könnte nicht radikaler sein:
„[…] das Herkommen will, daß wir ein Haus bilden sollen u unsere Geburt, daß wir mit Anstand leben sollen – o über die unglückseeligen Vorurtheile! Wie viele Menschen genießen mit Wenigem, vielleicht mit einem paar hundert Thalern das Glück der Liebe – u wir sollten es entbehren, weil wir von Adel sind? Da dachte ich, weg mit allen Vorurtheilen, weg mit dem Adel, weg mit dem Stande – gute Menschen wollen wir sein u uns mit der Freude begnügen, die die Natur uns schenkt. Lieben wollen wir uns, u bilden u dazu gehört nicht viel Geld – aber“, so fährt er dann doch etwas bedenklich fort, „aber doch etwas, doch etwas – u ist das, was wir haben, wohl hinreichend? Ja, das ist eben die große Frage“.17
Kleist will dem Brief zufolge diese Frage lösen, indem er sich auf das Schreiben verlegt. Es stehe ihm für die Zukunft das ganze schriftstellerische Fach offen, behauptet er. „Darin fühle ich, daß ich sehr gern arbeiten würde“ (ebd.). Ein paar Seiten später wird er noch deutlicher. Nun spricht er schon nicht mehr vom „schriftstellerischen Fach“, sondern entschieden vom Dichtertum, und nicht mehr nur um das bißchen Geld geht es nun, sondern um Ehre und Ruhm. „Lächle nicht“, schreibt er der Braut, „u bemühe Dich nur ja, alle Vorurtheile zu bekämpfen. Ich bin sehr fest entschlossen, den ganzen Adel von mir abzuwerfen. Viele Männer haben geringfügig angefangen u königlich ihre Laufbahn beschlossen. Shakespeare war ein Pferdejunge u jetzt ist er die Bewunderung der Nachwelt. Wenn Dir auch die eine Art von Ehre entgeht, so wird Dir doch vielleicht einst eine andere zu Theil werden, die höher ist – Wilhelmine, warte zehen Jahre u Du wirst mich nicht ohne Stolz umarmen“.18
Schon ein halbes Jahr vor der sogenannten Kant-Krise also war Kleist entschlossen, Dichter zu werden, die Berufung auf „Wissenschaft“ und „Bildung“ hat nur noch Deck- und Tarnfunktion. Obwohl der eben zitierte Brief mit einem Bekenntnis zu den „Wissenschaften“, ja zu den „geliebten Wissenschaften“ beginnt, ist in seinem weiteren Verlauf nicht mehr von ihnen die Rede, sondern vom Schriftstellerberuf und dem Wunsch, ein bedeutender Dichter wie Shakespeare zu werden. Auch die Liebesbindung, wenn es überhaupt eine war, beginnt er nun abzuschütteln. Nachdem er der Braut mitgeteilt hat, daß er sich mit ihr zunächst in eine bescheidene, ja arme Existenz zurückziehen möchte, um dort in Abgeschiedenheit seine schriftstellerische Laufbahn zu begründen, fährt er fort, immer noch im selben Brief vom 13. November 1800: „Ist das Alles nicht ausführbar, so bleibt uns, bis zum Tode, Eins gewiß, nämlich meine Liebe Dir, u Deine Liebe mir. Ich wenigstens gebe nie einem andern Mädchen meine Hand, als Dir“ (156). Mit einer Liebesversicherung und dem Versprechen, sich nie einem anderen Mädchen zu verbinden, fängt er an, sich aus der bestehenden Bindung zu lösen! Die letzte Konsequenz aus diesem Streben nach Unabhängigkeit ist der im Kantbrief vom 22. März 1801 geäußerte Wunsch: „Liebe Wilhelmine, laß mich reisen“ (206).
Die dichterische Produktion setzt in dem Augenblick ein, in dem er sich auf „Reisen“ begibt: Die Schritt für Schritt vorangetriebene Lösung aus allen Fixierungen ist eine elementare Bedingung seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Kleists Dichtung selbst ist eine Dichtung der experimentellen Offenheit, in ihr gibt es keine Sicherheit, weder die Sicherheit einer anerkannten Gesellschaftsordnung, noch die innere Heimat einer fraglos akzeptierten Religion; noch weniger die Sicherheit gültiger Traditionen, und schon gar nicht die Sicherheit einer ihrer selbst gewissen Subjektivität, einer existentialistischen Gefühlssicherheit, wie die ältere Kleistforschung immer wieder behauptete.