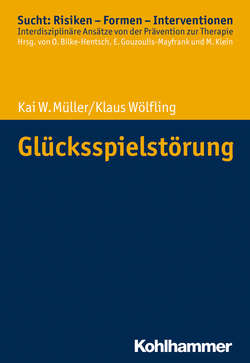Читать книгу Glücksspielstörung - Kai W. Müller - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Befunde aus Längsschnittstudien und Katamneseerhebungen
ОглавлениеAnhand epidemiologischer Erhebungen lässt sich zwar die Prävalenz einer Glücksspielstörung in der Bevölkerung abschätzen, jedoch erlauben sie nicht, Aussagen über deren zeitliche Stabilität zu treffen. Es ist aus verschiedenen Gründen wichtig, über diese Stabilität Bescheid zu wissen. Wäre die Glücksspielstörung ein flüchtiges Phänomen, das nach kurzer Zeit vollständig remittiert, würde dies die Frage aufwerfen, ob es überhaupt notwendig ist, aufwändige Psychotherapieforschung zu betreiben, das Hilfesystem auszubauen oder ehrgeizige Präventionskonzepte zu installieren. Neben diesem eher grundsätzlichen Aspekt liefern Informationen über typische oder atypische Symptomverläufe Anhaltspunkte, um Faktoren zu erkennen, die eine Symptomatik exazerbieren lassen oder eben abmildern.
Prospektive Studien (Längsschnittstudien), die ein und dieselbe Personengruppe über einen längeren Zeitraum untersuchen, sind demnach notwendig, um Symptomverläufe abzubilden. Auch zur Bestimmung von Kausalbeziehungen, also etwa der Bestimmung von Risikofaktoren für eine Glücksspielstörung, sind diese Ansätze geeignet. Man wird nachvollziehen können, dass im Vergleich zu Querschnittserhebungen, die lediglich einen einzigen Messzeitpunkt beinhalten, solche Längsschnittstudien mit ungleich mehr Aufwand verbunden sind. Damit erklärt sich, warum es deutlich mehr Querschnitts- als Längsschnittstudien gibt. Nichtsdestotrotz existieren sie und ihre Befunde sollen kurz dargestellt werden.
Längsschnittstudien an Jugendlichen konnten verschiedentlich belegen, dass eine lebensgeschichtlich frühe Nutzung von Glücksspielen einen guten Prädiktor für die Fortführung des Spielverhaltens in späteren Lebensjahren darstellt. Gleichzeitig sagt die regelmäßige Glücksspielteilnahme eine spätere Verschlechterung der Schulleistungen voraus (Vitaro et al. 2018). Damit existiert ein Hinweis darauf, dass lebensgeschichtlich früh eingeübte Nutzungsgewohnheiten zu einer Verinnerlichung und Verfestigung des Verhaltens führen. Unterstützt wird dies durch retrospektive Befragungen an Patienten; auch hier zeigt sich, dass die Mehrheit der Patienten bereits im Jugendalter Kontakt mit Glücksspielen hatte (Meyer und Bachmann 2017; Müller et al. 2017). Das Risiko für eine spätere Glücksspielproblematik erhöht sich zudem, wenn Jugendliche nicht nur ein, sondern viele verschiedene Glücksspiele nutzen (Dowling et al. 2017).
Auch konnte gezeigt werden, dass ungünstige sozioökonomische Rahmenbedingungen (Bildungsgrad der Eltern, finanzielle Situation der Familie, Broken-Home Situation), Substanzgebrauch sowie Impulsivität im Jugendalter die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten und die Fortführung der Glücksspielteilnahme steigern. Vitaro et al. (2018) wiesen nach, dass höhere Impulsivität im Alter von 12 Jahren die Fortführung des Glücksspielens im Alter von 14 und 16 vorhersagte. In der Metanalyse von Dowling et al. (2017) erwies sich, dass in hoher Impulsivität im jungen Erwachsenenalter ein ausgeprägter Risikofaktor für eine spätere Glücksspielstörung zu sehen ist.
Aufschlussreich sind auch Befunde zum Auftreten weiterer psychischer Probleme vorbestehender Glücksspielproblematik. Anhand einer prospektiven Erhebung an Jugendlichen und jungen Erwachsenen konnten Afifi et al. (2016) zeigen, dass problematisches Glücksspielen die Auftretenshäufigkeit für weitere Störungen bei den Heranwachsenden begünstigte. Eine Glücksspielproblematik im Lebensalter zwischen 18 und 20 Jahren stellte in der Analyse einen kausalen Risikofaktor für das Neuauftreten einer Substanzabhängigkeit und depressiver Störungen im Alter zwischen 23 und 25 Jahren dar.