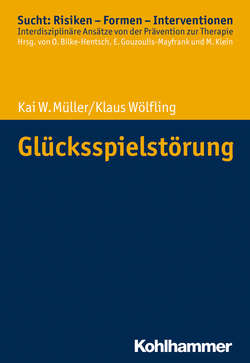Читать книгу Glücksspielstörung - Kai W. Müller - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3.1 Zwischen Leidensdruck und Hilfesuche – das Paradoxon fehlender Inanspruchnahme von Hilfen
ОглавлениеAllein in Deutschland beläuft sich der Anteil an Menschen, die von der Glücksspielstörung betroffen sind auf fast 1 %. Weitere 3 %, so die Schätzungen, weisen ein zumindest problematisches Nutzungsverhalten auf; d. h., die Teilnahme am Glücksspiel verläuft zumindest phasenweise unkontrolliert und führt zu negativen Konsequenzen (Meyer et al. 2011). Wir wissen ferner, dass Patienten mit einer Glücksspielstörung eine deutliche psychopathologische Symptombelastung und eine verminderte Lebensqualität mitbringen. Depressive Symptome, Stressbelastung, finanzielle Sorgen und der Druck, das Verhalten vor anderen Menschen geheim halten zu müssen, stellen eine nicht unerhebliche zusätzliche Belastung dar.
Zugleich zeichnen die Daten der Inanspruchnahme von Hilfen dieser Patientengruppe ein Bild, das nachdenklich stimmt. Internationale Daten beziffern den Anteil jener, die sich aktiv um externe therapeutische Hilfe bemühen auf 3 % dieser Betroffenen (Volberg 1999). Für Deutschland beläuft sich dieser Anteil laut einer Erhebung von Bischof et al. (2012), die auf der PAGE-Studie beruhte (Meyer et al. 2011), auf etwa 20 %. Lediglich 9,5 % hatten einen weiterführenden Kontakt zum Hilfesystem.
In Kapitel 2 haben wir zudem gesehen, dass auch Jugendliche betroffen sind, womöglich bald sogar noch mehr als früher, bedenkt man die rasante Verbreitung internetbasierter Glücksspiele. In der kindes- und jugendpsychiatrischen Versorgung ist das Phänomen Glücksspielstörung allerdings nahezu unbekannt.
Wie ist diese Lücke, die zwischen Betroffenenzahlen und Inanspruchnahmeraten klafft, zu erklären? Warum suchen offensichtlich belastete Personen keine Hilfe? Eine empirisch gestützte Antwort auf diese Frage existiert nicht. Theoretisch erklärbar ist dieses Paradoxon darüber, dass Betroffene möglicherweise durchaus in Behandlung sind, nur eben nicht wegen des Glücksspielens, sondern wegen damit verbundener psychischer Probleme. In Kapitel 6 werden wir sehen, dass gerade Substanzabhängigkeiten sowie affektive Störungen häufige komorbide Erkrankungen der Glücksspielstörung sind. Möglicherweise also finden Betroffene durchaus therapeutische Hilfe, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Eine Anschlussfrage wäre, in wie weit in anderen Behandlungssettings überhaupt ein Thema wie Glücksspiel Beachtung findet?