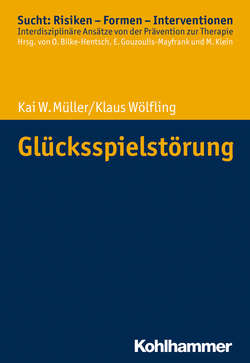Читать книгу Glücksspielstörung - Kai W. Müller - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.4 Versorgungsstrukturen in Deutschland
ОглавлениеIn Deutschland empfehlen die Spitzenverbände der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger, dass Patientinnen und Patienten mit einer Glücksspielstörung zur Behandlung in Einrichtungen für Abhängigkeitserkrankungen oder zu psychosomatischen Rehabilitationskliniken zugewiesen werden. Darüber hinaus existiert ein breit gefächertes Netz an psychosozialen Beratungsstellen, ebenso wie verschiedene Selbsthilfegruppen, wie etwa Gamblers Anonymous.
Ob eine Behandlung im ambulanten oder stationären Setting erfolgt, hängt vom Schweregrad der Störung, komorbiden Störungen sowie den verfügbaren psychosozialen Ressourcen der Betroffenen ab. Natürlich spielt zusätzlich die Fähigkeit des Patienten, eine Abstinenz einzuleiten, eine Rolle bei der Wahl des Behandlungssettings. Unabhängig davon sprechen auch eine negative Erwerbsprognose bzw. anhaltende Arbeitslosigkeit für eine stationäre Behandlung. Was die Wirksamkeit anbetrifft, so lässt sich sagen, dass bei passender Indikation, sowohl die ambulante als auch die stationäre Maßnahme recht gute Effekte aufweisen (Ladouceur et al. 1998).
Die Beantragung einer stationären oder ambulanten Behandlung erfolgt in der Regel über die Deutsche Rentenversicherung. Hierzu ist neben Angaben durch den oder die Betroffene eine Einschätzung zur medizinischen Notwendigkeit einer Rehabilitation durch den behandelnden Hausarzt sowie ein Sozialbericht einzureichen.
Im Rahmen der stationären Behandlung, welche in der Regel durch die Deutsche Rentenversicherung getragen wird, erfolgt eine Zuteilung Betroffener entweder in suchtspezifische oder psychosomatische Rehabilitationseinrichtungen. Abhängig von einer auf eine Ausarbeitung von Petry und Jahrreiss (1999) zurückgehende Kategorisierung Betroffener, ist eine stationäre Behandlung in einer Einrichtung für Abhängigkeitserkrankungen mit zusätzlichem glücksspielspezifischen Schwerpunkt vor allem dann indiziert, wenn zusätzlich eine Substanzabhängigkeit vorliegt (sog. Gruppe A). Dasselbe wird für Patienten der Gruppe B empfohlen. Gruppe B beinhaltet Patienten, die zusätzlich die Merkmale einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung aufweisen. Eine psychosomatische Versorgung soll insbesondere für Betroffene mit »depressiv-neurotischer Belastung« (Gruppe C) oder einer komorbiden Störung, die für sich genommen eine psychosomatische Behandlung rechtfertigt (Gruppe D), zielführend sein. Diese Einteilung folgt einer speziell in Deutschland geltenden Systematik und – betrachtet man die Angelegenheit rein empirisch – ist ungeklärt, ob durch diese Zuteilung etwas für die Rehabilitation Betroffener gewonnen ist. Empirische Evaluationen zu dieser Zuteilungssystematik fehlen. In Kapitel 7 wird jedoch gezeigt, dass es durchaus alternative Einteilungsmöglichkeiten gibt.
Nach einer absolvierten stationären Rehabilitation besteht die Möglichkeit, die erzielten Behandlungserfolge über die Teilnahme an einer ambulanten Nachsorgemaßnahme zu festigen. Bislang fehlen zwar systematische Untersuchungen dazu, ob bzw. in wie fern eine ambulante Nachsorge zu einer signifikanten Besserung der Prognose führt, auf rein theoretischer Ebene ist eine solche Maßnahme aber zu empfehlen. Betroffene erleben die Zeit während der stationären Behandlung oftmals »wie in einer Blase«. Reize und Stressoren des regulären Alltags, die unter Umständen einen Suchtbezug aufweisen, treten in diesem geschützten Kontext selbstredend nicht auf. Nach der Entlassung hingegen sieht sich der Patient erneut mit ihnen konfrontiert, was die Gefahr eines Rückfalls erhöhen kann. Dieser Dynamik lässt sich mit einer Anbindung an eine ambulante Nachsorge entgegenwirken (für Details vgl. Meyer und Bachmann 2017).