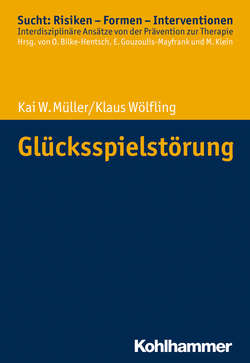Читать книгу Glücksspielstörung - Kai W. Müller - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3 Entwicklungsdynamiken einer Glücksspielstörung
ОглавлениеSuchterkrankungen – und hierbei ist es unerheblich, ob stoffgebunden oder nicht – entwickeln sich in aller Regel nicht schlagartig, sondern vor dem Hintergrund bestimmter Prädispositionen (individuelle Vulnerabilität) und über einen längeren Zeitraum. Zwischen dem Erstkontakt mit der psychotropen Substanz bzw. dem kritischen Produkt (z. B. Geldspielautomaten) und der Manifestation von Symptomen eines abhängigen Verhaltens vergeht also Zeit.
In dem von Robinson und Berridge (2008) formulierten Wanting-Liking-Learning Modell, welches auch in einer für Verhaltenssüchte angepassten Version vorliegt (Grüsser und Thalemann 2006; Müller und Wölfling 2017), wird der Prozess der Suchtentwicklung als Phasenmodell aufgegriffen ( Abb. 3.1).
Abb. 3.1: Das Wanting-Liking-Learning Modell bei der Glücksspielstörung
Der Grundgedanke des Modells liegt darin, dass die Glücksspielnutzung zunächst im Sinne einer positiven Verstärkung zum Erleben positiver Effekte führt, wodurch – unter bestimmten Voraussetzungen, die in Kapitel 7 näher ausgeführt werden – eine erste Verstetigung des Verhaltens erfolgt. Häufig berichten Patienten von einem als überwältigend erinnerten Erfolgserlebnis aus der Anfangsphase des Konsums. Ein solches Ereignis kann ein überraschend hoher Geldgewinn sein oder auch das Erleben einer starken Erregung während der Spielteilnahme, die der Betroffene in dieser Form zuvor noch nicht erlebt hatte.
Gleichzeitig wirken Mechanismen der klassischen Konditionierung. Vormals neutrale Reize (z. B. die Monitore in einem Wettbüro, der Klang von Geldspielautomaten etc.) werden mit positiven Reizen (z. B. Geldgewinn) gekoppelt und erhalten somit einen eigenen belohnungsanzeigenden Wert, der sich später verhaltenssteuernd auswirkt. Derartige Konditionierungen können sehr individuell ausfallen und sollten im Rahmen der Therapie einzeln herausgearbeitet werden.
Im weiteren Verlauf ist typischerweise eine Intensivierung der Glücksspielteilnahme zu beobachten; die Dosissteigerung kann sich hinsichtlich der Spielfrequenz sowie -dauer und der getätigten Einsätze kennzeichnen. Die vormalige Motivation der Teilnahme, durch die Nutzung positive Effekte zu erleben, wird sukzessiv von einem Druck, das Verhalten ausüben zu müssen, abgelöst. Dieser Konsumdruck, auch als Craving bezeichnet, ergibt sich nicht zuletzt vor dem Hintergrund der inzwischen durch die Konditionierungsprozesse erlernten Reaktionen auf bestimmte auslösende Reize.
Die intensivierte Glücksspielnutzung gerät zunehmend außer Kontrolle, was neuropsychologisch dadurch gekennzeichnet ist, dass präfrontale Hirnregionen weniger Kontrolle ausüben und stattdessen eher belohnungsabhängige Strukturen, wie das limbische System spezifisch aktiviert werden und damit verhaltensinitiierend wirken. Damit verbunden sind typische negative Konsequenzen, Geldverluste, aber auch der erlebte Druck, das Verhalten vor Mitmenschen verheimlichen zu müssen, dysphorische Affekte und psychovegetative Symptome (Schlafstörungen, Konzentrationsdefizite etc.) sowie ein abnehmendes Leistungsniveau. Die Glücksspielteilnahme erhält so immer mehr die Funktion, diese negativen Konsequenzen und die damit verbundene Stressbelastung zu reduzieren, wodurch sich ein Teufelskreis ergibt.