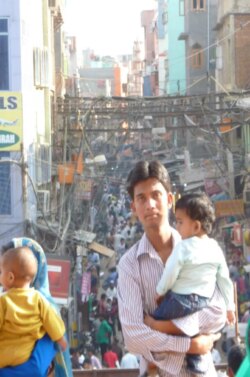Читать книгу Antinatalismus - Karim Akerma - Страница 148
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Casanova, Giacomo Girolamo (1725–1798) als Neganthropiker und Utopiker
ОглавлениеVorbemerkung: inwieweit die nachstehend von den Dialogpartnern A und B vorgebrachten Argumente über das menschliche Leben teils oder ganz dem Autor als dessen eigene Auffassungen zuzurechnen sind, muss wohl offen bleiben. Alles hier zugunsten des Suizids Gesagte stimmt jedenfalls mit Casanovas „Abhandlung über den Selbstmord“ (1769) überein.
Der 1. Dialog wird von A mit einem Seneca-Zitat (aus Ad Marciam de consolatione. XXII, 3) eröffnet, das unser unerbetenes Geborenwerden als Zumutung eines an sich unzumutbaren Lebens verurteilt, das niemand in Vorauskenntnis des ihn Erwartenden akzeptiert hätte:
„Nichts ist so trügerisch wie das Menschenleben, nichts so hinterhältig: keiner, beim Herkules, hätte es angenommen, wenn es nicht Ahnungslosen gegeben würde. Wenn es daher das größte Glück ist, nicht geboren zu werden ...“{38}
Der Geburts-Urbetrug besteht demnach in der elterlichen Ausnutzung der unvermeidlichen Ahnungslosigkeit jedes neuen Menschen. Es fällt aber auch hier wieder – sowohl bei Seneca wie bei Casanova– auf, wie diese elterliche Verantwortung als Tabu verdrängt bleibt. Seneca lässt an dieser Stelle erneut die antike Klage „Besser nie geboren!“ ertönen, was anlässlich eines Trostbriefes zum Tod eines Sohnes besonders merkwürdig anmuten muss: denn ohne die Mutter als Mit-Erzeugerin hätte da kein Kind leben und sterben können und müssen. Wie fast immer, wird eine Rückwendung auf die Letzt-Verursacher ihres Lebenselends und Todes von den Klagenden – die ja zeitlebens „Kinder“ irgendwelcher Eltern bleiben – streng vermieden! Dass Seneca der Marcia ihre todes- und verlustursächliche Mutterschaft „vorgeworfen“ hätte, ist völlig undenkbar.
Beide, Seneca und Casanova, lassen übrigens die alte humanontologische Figur einer Präexistenz der ins Leben Gebrachten erkennen: sonst bestünde keinerlei mögliche Gelegenheit zur Information und einer daraus erwachsenden Daseinsentscheidung, wie sie viel später S. Butler (Seinsunwilligkeit vor dem Schleier gebürtlichen Nichtwissens) entfalten wird. Denn Casanovas Dialogpartner B erklärt unumwunden:
„... ich schließe mich ihm [Seneca] an. Nimmt man die Existenz der Seele in Ruhe an, kann man sich unmöglich vorstellen, wie sie in Kenntnis all dessen, was dem Menschen in diesem Leben gemeinhin widerfährt, und aller Leiden, die er zu gewärtigen hat, einwilligen sollte, in einen Körper einzutreten.“ (Casanova, Über den Selbstmord und die Philosophen, ebd.)
A folgert daraus, dass der Suizid jedem mit dem Leben Unzufriedenen freizustellen sei: „ ... das Leben insgesamt ein Leiden ist, wahrhaftig ein Unglück; und ich stelle fest, dass der denkende, vernünftige Mensch, der mit ihm nicht zufrieden ist, aus ihm scheiden müsste und nicht mehr glauben dürfte, er begehe damit eine unrechte Tat.“ (A.a.O., S. 96)
Die Metapher vom „Geschenk“ des Lebens wird als unsinnig verworfen: Ein gütiger Gott wäre als Geber dieses Übels „böswillig“ (ebd.). Auch die Eltern haben bei Casanova keinen Anspruch auf Kindesdank. Die Elternrolle wird als prinzipiell egoistisch motiviert verurteilt: Der Sohn erhalte sein Leben vom Vater, „steht aber nicht in seiner Schuld, denn weder bekam er es von ihm anvertraut, noch wurden durch einen wechselseitigen Vertrag die Bedingungen festgelegt, unter denen er es ihm gab. Er steht auch nicht in seiner Schuld, weil der Vater bei der Zeugung etwa gedacht hätte, er vollziehe diesen Akt eher seinem Sohn zuliebe, als um sich selbst eine Wohltat zu erweisen, ob er damals nun ein natürliches Verlangen stillen wollte oder auch daran dachte, für einen Erben zu sorgen, um seinen Besitz dem eigenen Fleisch und Blut zu erhalten oder um seinen eigenen Wunsch nach Vermehrung zu befriedigen. Aus all dem darf man den Schluss ziehen, dass, wenn es denn eine Verpflichtung zwischen Vater und Sohn gibt, sie eher der Vater gegenüber dem Sohn besitzt als der Sohn gegenüber dem Vater.“ (A.a.O., S. 112) Casanova erkennt klar die von Kant (Natalschuldumkehr) behandelte Elternschuld des Geburtsdiktats, die keinerlei Verpflichtung des Kindes zur Folge haben könne.
Später entfaltet Casanova seine Sicht der Conditio in/humana und entwirft in Andeutungen eine Utopie wesentlich besseren Daseins. Hier seine Mängelliste in Auswahl:
Stürme, Blitze, Vulkane, unfruchtbare Böden, Insekten, schwacher Körper und Geist, Krankheiten , Blindheit, Taubheit, Lahmheit, Tod, Vergesslichkeit, „Blödigkeit des Kindesalters“, Hass, Zorn, Geiz u.a. (a.a.O., S. 126f.) Bei alledem hätte die Natur (der Zufall) auch ein ideales Leben hervorbringen können, so wie es möglicherweise auf anderen Planeten (ETI) existiere. (Vgl. ebd.)
Und dann will ausgerechnet Casanova die Sexualität als zu leidensträchtig abschaffen und die Fortpflanzung im selben Zug: Der Mensch (gemeint ist hier der Mann) „hätte so beschaffen sein können, dass er keiner Frau bedurft hätte, um sich fortzupflanzen, oder jene Neigung der Natur zu befriedigen, die uns das andere Geschlecht anbeten lässt, woraus soviel Leid erwächst; und wenn es angemessen gewesen wäre, uns eine Gefährtin zu geben, so hätte sie doch (128) ohne weiteres mit hundert körperlichen und geistigen Vorzügen ausgestattet sein können, die sie zum Gegenstand immerwährenden Genusses gemacht hätten und nicht zu dem, was unsere andere Hälfte ist, Quelle nahezu all unseres Ungemachs. Der immergleiche, sich auf verschiedene Weisen selbst erneuernde Mensch hätte stets jung bleiben können und es nicht nötig gehabt, Kinder zu zeugen und aufzuziehen, heutzutage das ärgste Unglück der Eltern, die beschwerlichste Sorge ihres kurzen Lebens.“ (S. 127f)
Hierbei sind gewiss die vielen (und früher häufig ungewollten) Schwangerschaften zu veranschlagen. Vielleicht hat dieser auch die Männer schwer beeinträchtigende Umstand die verblüffende nativistische Misogynie mit hervorgerufen, wie sie – in ganz anderem historischen Kontext, aber doch erstaunlich ähnlich –bei Euripides anklingt (Euripides-Theorem).
Casanova führt überzeugend als weiteren Naturmangel den als Genuss unerlebbaren Schlaf an:
„Der Schlaf hätte für uns in denselben Stunden, in denen wir in ihn versunken sind, als Wohltat spürbar sein können, während wir seine Süßigkeit nur empfinden, wenn wir einschlafen, was in einem flüchtigen Moment geschieht; wenn wir aber aufwachen, so empfinden wir eine Wohltat, die sogleich entflieht und der Vergänglichkeit angehört. Kurz und gut, der Mensch hätte so beschaffen sein können, dass er niemals hätte Wünsche haben müssen, die er nicht auf der Stelle hätte befriedigen können, und dass er nach seinem Willen auch neue Wünsche hätte hervorbringen können.“ (A.a.O., S. 128)
Schließlich behauptet Dialogpartner A., dass sich die Menschen über ihre Lebenszufriedenheit betrögen (Positivitätsdrall):
„Sie lieben es (das Leben, G.K.) aus einem Naturtrieb heraus; sie lieben es, weil sie sich verpflichtet fühlen, es zu lieben, weil sie sich selbst lieben oder weil sie für die Zeit nach ihrem Tod Schlimmeres befürchten oder weil sie soviel Aufhebens um jene Genüsse machen, die sie sich von Zeit zu Zeit verschaffen, um gegen jene Leiden des Körpers und des Geistes, die sie stets ertragen müssen, unempfindlich zu werden; sie bringen es so weit, sie vor sich selbst zu verbergen.“ (S. 132)
Wie ist nun Casanovas komplexer Kommentar zur Conditio in/humana zu bewerten? Bei aller scharfen Neganthropik und trotz Mä-phynai-Klage sowie den von ihm aufgebotenen Formen wird er nicht zum Antinatalisten. Doch erhellt aus seinem radikalen utopischen Gattungs-Gegenentwurf unmissverständlich, dass er sich eine ganz andere (wenn auch völlig unrealisierbare) Menschheit - ohne Kindererzeugung! - erträumte, wenngleich er allein den schwachen Trost gewähren konnte, jedem mit dem gewohnt leidensträchtigen Leben Unzufriedenen den selbstgewählten „Ausstieg“ freizustellen.