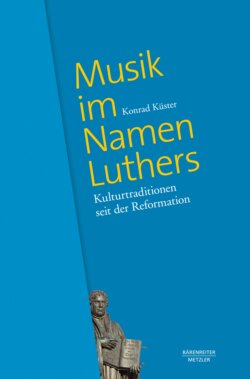Читать книгу Musik im Namen Luthers - Konrad Küster - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Figuralmusik, das dänische Luthertum und Georg Rhau
ОглавлениеWie aber konnte im Umfeld Luthers noch mehr gottesdienstliche Musik ermöglicht werden, also vor allem auch mehrstimmige? Eine klare Antwort darauf lässt sich nur schwer geben: weil alle liturgischen Abläufe so offen formuliert wurden. Folglich mag es scheinen, als ob in ihnen die mehrstimmige Musik noch gleichgültiger war als der äußere Rahmen. Doch dies ist nur die eine Seite der Medaille. Denn wenn ein Chor am Gottesdienst mitwirkte, war in den Teilen, die ihm zufielen, prinzipiell auch Figuralmusik möglich. Dass deren genaues Ausmaß von den Kirchenordnungen nicht geregelt wird, mag sich daraus erklären, dass Figuralmusik nur an relativ wenigen großen Orten möglich war, an denen mit den Gottesdienstrichtlinien ohnehin souverän umgegangen werden konnte.
Das Angebot solcher Musik war groß. Seit den späten 1520er-Jahren stiegen die Produktionszahlen der Notendrucke nahezu sprunghaft an, nicht zuletzt auf dem Sektor von kirchenmusikalischen Sammelbänden (mit Motetten von verschiedenen Meistern).31 Und die gottesdienstliche Musiknachfrage spiegelt sich auch in den Chorbibliotheken lutherischer Schulen des 16. Jahrhunderts. Wie aber ließen sich diese Repertoires in Gottesdiensten nutzen? Keinesfalls konnte Musik nur wegen ästhetischer Werte in den Gottesdienst importiert werden; vor allem musste sie sich in die zeitgenössische Liturgie einpassen. Und »Gottesdienst« war nicht nur die Messe; die frühen Lutheraner gaben auch das traditionelle Stundengebet nicht preis, dessen Ordnung sich in der Titelformulierung des Leipziger Gesangbuches von 1530 spiegelt: Enchiridion geistlicher gesenge und Psalmen fur die leien [= Laien] ... Sampt der Vesper, Metten, Complet und Messe. Auch Vesper, Mette und Komplet bestanden demnach fort.
Mehrstimmige Bearbeitungen ganzer Psalmen hatten ihren Platz in der Vesper, und zwar stets mehrere in klassischen Koppelungen. Mozarts beide Vesperae (KV 321 und 339) und Monteverdis Marienvesper sind in ihren Texten für zwei unterschiedliche, liturgisch klar definierte Anlässe zusammengesetzt, und entsprechend nennt das Leipziger Gesangbuch von 1530 fünf lutherische Vesperpsalmen (110–114).32 All diesen Konzepten gemeinsam ist ihr neutestamentlicher Abschluss mit dem Magnificat. Solche liturgischen Zuordnungen wurden zweifellos beachtet; die Freiheit, typische Vesperpsalmen auch einmal als Mess-Introitus zu gebrauchen, hatte also Grenzen. Und ebenso wenig, wie Lieder »frei« in den Gottesdienstablauf eingefügt wurden, konnte ein Chorleiter »frei« mehrstimmige Musik zur gottesdienstlichen Aufführung auswählen.
Im Hinblick auf »lutherische« mehrstimmige Musik ist selbstverständlich am interessantesten, wie Luther selbst sie in der Messe erlebt haben mag. Dass Kunstmusik eine Rolle für Luther (der sich über sie äußerte) und seinen Kreis spielte (allen voran für seinen Weggefährten Johann Walter), steht außer Frage; doch welche mehrstimmige Kirchenmusik im Wittenberg Luthers erklang, ist nicht dokumentiert. Um dennoch ein Bild gewinnen zu können, müssten zwei Fragen möglichst präzise beantwortet werden. Die erste: Weil die Wittenberger Liturgie im Detail so wenig autoritativ (oder auch: griffig) wirkt, müsste man, um die Informationslücken zu schließen, an einem anderen Ort Regeln finden, die im Kern den Wittenberger Angaben nahestehen und diese obendrein konkretisieren; dann sähe man klarer, was auch in Wittenberg möglich war. Welche örtliche Liturgie aber könnte dies sein? Und die andere: Wo gibt es ein musikalisches Repertoire, das unmittelbar auf diese Liturgie abgestimmt ist? Die Liturgie ist das Übergeordnete; erst in Verbindung mit ihr lässt sich bestimmen, welche Musik zu ihr passte.33
Relativ weitgehend gelingt dies in Eisenach. Grundlage können hier Musculus’ detaillierte liturgische Aufzeichnungen sein; außerdem ist das Eisenacher Kantorenbuch der 1540er-Jahre erhalten geblieben, das ein umfangreiches Musikrepertoire gerade für die Messfeier wiedergibt und sich mit Musculus’ Angaben verbinden lässt.34
Doch der Eisenacher Gottesdienst wich, wie beschrieben, in einer Reihe von Details von der Wittenberger Praxis ab, auch in solchen, deren Folgen tief in die Musikpraxis hineinragen und erst aus dem Kantorenbuch hervorgehen. Also kommt man Luthers Erleben damit nicht genügend nahe. Wollte man einen solchen Gottesdienst gar rekonstruieren, scheiterte das Vorhaben ohnehin an den Orgelanteilen; denn Musik von der Art, die Musculus beschreibt, ist nicht überliefert. Das zeigt, wie hoch die Anforderungen sind, die für Klärungen erfüllt sein müssten. Diese günstigeren Bedingungen aber herrschten im frühen dänischen Luthertum. Dass sie sich in einem anderen Sprachraum ergeben, ist für die Figuralmusik belanglos, denn sie war ohnehin in der Regel lateinisch. Und so ist weit auszuholen, ehe die aus verschiedenen Richtungen stammenden Informationen zu einem Figuralmusik-Bild zusammengefügt werden können. Zunächst also: Warum gerade Dänemark?
Das Königreich gehörte zu den frühesten Sympathisanten der lutherischen Reformation; eine Art Vorreiterrolle hatte, schon vor Luthers Thesenanschlag, ein kritischer Reformkatholik inne, Poul Helgesen. 1517 hatte er sich eigenständig zu Missbräuchen geäußert, die sich aus seiner Sicht in der Papstkirche ergeben hatten. 1520 ließ sich König Christian II. durch seinen sächsischen Schwager Friedrich den Weisen einen lutherischen Prediger aus Wittenberg schicken; beim Wormser Reichstag von 1521, bei dem Luther den Widerruf seiner Positionen verweigerte, war Christian durch einen Gesandten vertreten. In Worms hieß es ferner, Luther solle eine Theologieprofessur in Kopenhagen übernehmen; dass es nicht dazu kam, wird zuallererst mit der Lebensgefahr zusammengehangen haben, die für Luther aus dem Verhängen der Reichsacht resultierte35 und so gelangte Luther stattdessen auf die Wartburg.
In Dänemark entluden sich anschließend Spannungen, die sich seit Längerem zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen des Ostseeraums angestaut hatten, in einen veritablen Bürgerkrieg (1534–1536), der weitaus komplexer war als die mitteleuropäischen Bauernaufstände: Drei legitime Aspiranten der Königswürde kämpften um die Macht, und je einer wurde unterstützt vom katholischen Adel, dem lutherischen Adel und den Bauern. Am Ende setzte sich der lutherische Christian III. durch; die radikale Beseitigung der bisherigen Kirchenmacht gehörte zu den Maßnahmen, die er anschließend ergriff, um das Land neu zu ordnen. So erklärte Christian III. 1536 das Luthertum zur Staatsreligion; Dänemark war damit der erste dezidiert lutherische Staat überhaupt.
Die Bestimmung einer lutherischen Staatsreligion mag wie eine normale Konsequenz daraus wirken, dass ein Territorium eine lutherische Kirchenordnung erhielt. Eine solche verhinderte aber nicht, dass ältere Glaubenselemente fortgeführt wurden. In Dänemark war also ein völlig neues religiös-politisches Werkzeug entstanden, und so folgten andere Länder dem dänischen Beispiel (allen voran 1539 Sachsen).
Die dänische Kirchenordnung, die in der Folge erarbeitet wurde, ist bis in Details den jüngsten Entwicklungen des Landes verpflichtet. Denn hier nun führte kein Weg daran vorbei, bis hinunter zu den Abläufen des Gottesdienstes klar zu definieren, was als »zur Staatsreligion gehörig« gelten konnte und was nicht; für Beliebigkeit war in der angespannten Situation kein Platz. So entstand in Dänemark auch in Fragen der Gottesdienstordnung etwas Einzigartiges: Strikt an lutherische Ideen gebunden (deren Verwirklichung ja Ziel der politischen Maßnahme war), wurden Festlegungen getroffen, die man andernorts nicht in dieser Klarheit antrifft. Und so ist der erste Kreis schnell geschlossen: Im Dänemark der späten 1530er-Jahre trifft man auf genau die gesuchte Konkretisierung der frühen lutherischen Regeln.
In ihrer Bedeutung ragten diese Festlegungen weit über die dänischen Grenzen hinaus; sie beeinflussten auf Jahrzehnte auch den Norden des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Ohnehin gehörte diesem der Südteil Schleswig-Holsteins (= Holstein) an, das aber unter dänischer Regierung stand, und viele der regionalen Kirchenordnungen stammten aus der Feder Johannes Bugenhagens (der auch die dänische begutachtete). So entstand mithilfe des dänischen Vorbilds ein gemeinsamer lutherischer Aktionsraum, und die Folgen daraus blieben für lange Zeit erkennbar: Weil dieses Regelwerk von so klaren Festlegungen ausging, ergaben sich Fortentwicklungen langsamer als in anderen Gegenden: In »Luthers Norden« hatten die Wittenberger Ur-Komponenten eine größere Bestandskraft als in Wittenberg selbst.
Die Messfeier als solche wurde in Dänemark nicht angetastet; bis heute heißt der dänische Sonntagsgottesdienst »højmesse«: hohe Messe. Getreu den Traditionen und den Diskussionen der 1530er-Jahre teilte sie sich in zwei unterschiedlich behandelte Teile, je einen vor und nach der Predigt.36 Vor der Predigt blieb nahezu alles beim Alten; gegenüber der Wittenberger Praxis wurde lediglich die Anzahl der Kyrie-Teile auf grundsätzlich drei beschränkt (die längere Wittenberger Festtagsform war also ausgeschlossen), und zwischen den Lesungen gab es ursprünglich noch das Maximum an Gesängen: Graduale, Alleluja und Sequenz in unmittelbarer Folge.
Für die Gottesdienstteile nach der Predigt jedoch wurde der Gebrauch alter Messbücher verboten; sie mussten sichtbar geschlossen und vom Altar weggebracht werden, weil jede Erinnerung an eine vorreformatorische Opferfeier ausgelöscht werden sollte – im Sinne der zeitgenössischen Abendmahlsdiskussionen. Das betraf die Musik ganz direkt: Wenn die Messbücher zugeklappt wurden, war der Zugang zu Offertorium und Communio versperrt. In den Kirchenordnungen aus Wittenberg waren diese Teile einfach nicht mehr erwähnt worden; die Begründung dafür wird im Dänemark der 1530er-Jahre gegeben.
So wurde die Messfeier geteilt: in einen traditionellen Teil bis zur Predigt und einen neuen nach dieser. Und zugleich wurde mit standardisierten örtlichen Unterschieden gearbeitet, denn die Messe brauchte nicht an allen Orten gleich gefeiert zu werden: Es gab Regeln für Zentren, an denen eine Lateinschule bestand; für kleinere Orte galten andere. Nur in den letzteren fand der Gottesdienst im Wesentlichen in der Volkssprache statt; in den größeren Städten hatte das Lateinische weitaus mehr Gewicht. Sogar das Credo war dort als lateinischer Gesang zugelassen. Die Orte mit großen Schulen wurden also als Zentren des Lateinischen hervorgehoben; und in den zugehörigen Kirchen lässt sich am ehesten mit Figuralmusik rechnen, selbstverständlich auf Latein.
Die liturgische Praxis Dänemarks unterschied sich von derjenigen in Wittenberg somit im Kyrie (aber nur an Festtagen) und in der Behandlung des Credo. Dass dies trotzdem nicht schwer wiegt, zeigt der Vergleich mit Eisenach: Dort war man Luthers Kyrie-Einschränkungen nicht gefolgt, und die alte Gruppe aus Graduale, Alleluja und Sequenz war anscheinend grundsätzlich reduziert worden.37 Wer also eine Vorstellung von einer potenziellen Wittenberger Figuralmusik gewinnen möchte, kann sich am ehesten an den dänischen Regeln orientieren, für Lesungen und Gebete die entsprechenden deutschen Texte einsetzen und ein mehrstimmiges Credo gegen Luthers Lied austauschen.
Und so ist der Blick frei auf ein zweites Feld, das umfassend dargestellt werden muss: die Musikdrucke von Georg Rhau (1488–1548). Rhau war schon früh Sympathisant der Ideen Luthers gewesen und büßte deshalb 1520 die Stelle des Leipziger Thomaskantors ein, die er erst 1518, gleich nach seinem Studium in Wittenberg, erhalten hatte. Eine anfänglich steile Karriere wurde folglich schon in ihren Anfängen gekappt. Rhau fand eine Basis für sein individuelles Fortkommen ab 1523 in Wittenberg, wo er in engsten Kontakt zu den Reformatoren trat; seit 1525 war er einer ihrer Drucker.38 Die erste von zahlreichen Predigtsammlungen Luthers (über den Lobgesang des Zacharias) erschien schon im ersten Jahr. Die Loci communes, Philipp Melanchthons »fürnemeste [= wichtigste] Artickel Christlicher lehre«, folgten 1530 ebenso wie Rhaus zweiteiliges Musiklehrbuch zum Choral- und Figuralgesang, das wohl noch aus seiner Leipziger Zeit stammte; die Druckausgabe zum Augsburgischen Bekenntnis, im selben Jahr verabschiedet, verließ seine Offizin 1531. Auch weitere musikalische Schriften gab er heraus, so schon 1528 die Musica Instrumentalis deudsch von Martin Agricola, zehn Jahre später den Libellus de compositione cantus von Johannes Galliculus, einem Freund offensichtlich aus der Leipziger Zeit. Und parallel dazu, im Jahr 1538, ging Rhau auch zum reinen Notendruck über. Seine Planungen hierfür müssen von vornherein weit über den Tag hinausgereicht haben; im Rückblick erscheint das Resultat wie ein programmatisches Vorhaben, denn am Ende stand ein kirchenmusikalisches Angebot für alle Anliegen des Luthertums zur Verfügung.
Den Anfang machten zwei unterschiedliche Sammelbände. Der eine enthält ein weites Spektrum von Gesängen für die Karwoche, darunter Vertonungen der Texte aus den Klageliedern Jeremiae (für die Vespergottesdienste), Choralpassionen und eine Messe für Karfreitag. Im anderen finden sich verschiedenartige geistliche Gesänge – Psalmen, Hohelied-Kompositionen, Vertonungen von Geschichten des Alten Testaments (etwa zum Streit zwischen David und Goliath) und der Evangelien, aber auch ein Ave Maria. Daraufhin schärfte Rhau seinen Arbeitsansatz. Als 1539 die Festgesänge für Ostern und Himmelfahrt erschienen, beschränkte er sich ausschließlich auf die Liturgie der Messfeier. Weiterhin aber greifen Ordinarium und Proprium ineinander. Das ist dann beim dritten Band für die Messfeiern nicht mehr der Fall: Die Officia Natalia von 1545 enthalten für die Wochen nach Weihnachten nur noch die Propriumsgesänge. Dies kaum ohne Grund: Denn in den Jahren dazwischen waren auch Gesänge für die Stundengebete erschienen (seit 1540), ebenso eine Sammlung allein mit Ordinariumszyklen (1541). Zwei Bände der noch späteren Produktion sind dann ausdrücklich auf Schulpraxis ausgerichtet: das schon ältere, nun aber von Rhau übernommene Wittembergisch deudsch Geistlich Gesangbüchlein von Johann Walter, in dessen berühmtem Vorwort Luther den Wert von Liedern für die Pädagogik hervorhebt, und die Neuen deutschen geistlichen Gesänge für die gemeinen Schulen, dessen Schul-Orientierung schon im Titel steht (beide von 1544).
Früheste lutherische Figuralmusik · Durch Georg Rhau in Druck gegeben, ist das Repertoire von der Tradition des Spätmittelalters geprägt. Oben der Binnen-Versus zu Conrad Reins Oster-Introitus »Resurrexi et adhuc tecum sum«, unten ein Kyrie von Adam Rener. Beide Stücke sind sogar wesentlich von gregorianischen Melodien geprägt, die der Diskant in großen Notenwerten vorträgt.
Georg Rhau, Officia paschalia, 1539, Discantus. Letterndruck: Die Notenlinien sind, den Lettern entsprechend, unterbrochen.
Die Werke, die Rhau zusammentrug, sind teils zeitgenössisch; gerade die Bände mit Propriumsgesängen enthalten jedoch Musik von Komponisten, die spätestens in den 1520er-Jahren gestorben waren. Vielleicht griff Rhau hier auf Musik zurück, mit der er in seiner Zeit als Leipziger Thomaskantor gearbeitet hatte; jedenfalls spiegeln seine Editionen ein Musikverständnis, das nicht von der Reformation selbst geprägt worden, sondern dieser vorausgegangen war und sie bestenfalls begleitet hatte.39 Unweigerlich ging von diesem so programmatisch wirkenden Repertoire jedoch eine normative Kraft aus, die alle Stilunterschiede vergessen machte. Zudem ließ er sein Vorhaben von gleichsam höchster Stelle autorisieren. Die Vorrede der Symphoniae jucundae von 1538 schrieb Luther, die der gleichzeitigen Passionssammlung Melanchthon; in gleicher Weise trat Bugenhagen als geistiger Pate für eine Responsoriensammlung von Balthasar Resinarius ein, die 1543 erschien.
Die dänische Konkretisierung der Wittenberger Liturgie und die Produktion Rhaus lassen sich ideal verknüpfen: für die Zeit um 1550/60, und zwar an der Domkirche von Ribe, dem Zentrum des schon aus der Wikingerzeit stammenden Bistums an der dänischen Nordseeküste, mitsamt der zugehörigen Kathedralschule.40 Ein Musikinventar der 1580er-Jahre listet dort rückblickend die nachreformatorischen Notenanschaffungen auf – so präzise, dass sich die meisten von ihnen bibliographisch identifizieren lassen. Besondere Bedeutung erlangte der musikverantwortliche Rektor der späten 1550er-Jahre, Hans Thomissøn; er rundete den Bestand ab, der schon von seinen Vorgängern angelegt worden war, und ordnete ihn. Für die Propriumsgesänge der Weihnachts- und Osterzeit standen ihm die einschlägigen Sammeldrucke Rhaus zur Verfügung; er ließ sie miteinander zusammenbinden, sodass seine Schüler immer nur die Stimmbücher dieser Sammlung mit in die Messe zu nehmen brauchten. Ähnlich ließ Thomissøn zwei Bände mit Gesängen vereinigen, die er offenbar in der Vesper nutzte: Rhaus Ausgabe der Resinarius-Responsorien und eine Nürnberger Motettensammlung. Ferner benutzte er Rhaus Druck mit mehrstimmigen Bearbeitungen derjenigen lateinischen Hymnen, die in der lutherischen Praxis anerkannt und 1542 in Druck gelangt waren. Vor allem für den schulischen Gebrauch lagen schließlich eine Ausgabe von Walters Wittembergisch deudsch Geistlich Gesangbüchlein und eine weitere Motettensammlung vor.
Im Zentrum stand also ein Notenangebot, das Rhau seit seiner Zeit als Thomaskantor gesammelt hatte; es muss zugleich auf seinen Heimatort Wittenberg abgestimmt gewesen sein. In Ribe konnte man es, ohne lange zu überlegen, in die dänische Liturgie einfügen, die so eng von Wittenberg abhängig war. Sonderformen musste es nur an den beiden erwähnten Stellen geben, zunächst im Kyrie. Weil in Dänemark sogar an großen Festen (die naturgemäß am ehesten »anfällig« für Figuralmusik waren) jede Wiederholung der Anrufungen untersagt war, kaufte Thomissøn im Jahr 1558 kurzerhand einen Band Messkompositionen, in denen sich dieses Problem nicht stellte: eben erschienene Werke von Jacobus Clemens non Papa, deren Kyrie-Sätze nicht an liturgische Melodien gebunden sind. Dieselbe Sammlung half ihm, auch das andere Problem zu überbrücken, im Credo: Denn weil dieses in Wittenberg als Gemeindelied gesungen wurde, hatte Rhau hierfür keine Musik bereitgestellt. Bei Clemens non Papa war auch für diese Position der dänischen Liturgie passende Musik vorhanden. Insofern erweist sich das Riber Repertoire auch in einer anderen Hinsicht als ideale frühlutherische Quelle: Es enthielt nur genau so viel Musik, wie unbedingt notwendig war. Es wurde also keine weitreichende Sammlung angelegt, die nicht mehr erkennen ließe, wie die liturgischen Zuordnungen erfolgten. Um den Grundzustand lutherischer Figuralmusik innerhalb der Wittenberger Vorstellungen zu erkennen, ist die Riber Situation also Gold wert.
Schließlich aber war in Ribe auch die Psalmodia von Lucas Lossius in Gebrauch, die 1553 als lutherisches Graduale in Nürnberg herausgekommen war: mit allen gregorianischen Gesängen, die in der lutherischen Gottesdienstpraxis eine Rolle spielen konnten. Lossius, seit 1533 Lehrer an der Lüneburger Johannisschule, hatte den Band den beiden Söhnen des dänischen Königs Christian III. gewidmet, und Melanchthon hatte eine Vorrede verfasst. Wie eng die lutherischen Kulturräume zusammenhingen, wird also eindrücklich unter Beweis gestellt: zwischen Nürnberg, Wittenberg, Lüneburg und Kopenhagen.