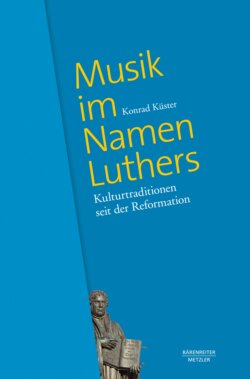Читать книгу Musik im Namen Luthers - Konrad Küster - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Stellung Luthers
ОглавлениеDie geschilderten Bedingungen sind grundlegend, um zu verstehen, wie die Reformatoren auf die kirchliche Musik ihrer Zeit reagierten. Das beginnt bei der Stellung Josquins im Kulturleben: Ganze Volksscharen im Einflussbereich des Papsttums haben seine Musik erlebt. Dass Luther – universitär gebildet – auch den Namen dessen kannte, der als Komponist hinter ihr stand, resultiert nicht zuletzt aus der Präsenz Josquins in den schriftlich geführten Diskursen der Zeit. Doch da Luther auch Einzelkompositionen erwähnt haben soll, als er Josquin als »der Noten Meister« bezeichnete,4 belegt dies eine tiefer gehende Kenntnis. Und offensichtlich konnte er diese Musik auch stilgeschichtlich bewerten. Das deutet sich in seinen »Tischreden« an: Zwar ist es nicht leicht, diese nicht einmal stenogrammartigen Mitschriebe immer auf veritable Gedankengänge zurückzuführen; doch einmal scheint er sich über den klangorientierten Stil Josquins geäußert zu haben, um ihn – als ebenso ungezwungen wie das Evangelium – von der Musik Heinrich Fincks (gestorben 1527) abzugrenzen. In ihrer strengeren Kontrapunktik und ihren aggressiveren Dissonanzen werde zu sehr das Gesetzmäßige erkennbar.5 Dennoch lässt sich Luthers Musikverständnis nicht umfassend charakterisieren: Seine auf Musik bezogenen Äußerungen stammen aus unterschiedlichen Zeiten, reagieren auf unterschiedliche äußere Bedingungen und müssen (oder gar: können) daher nicht zu einem geschlossenen Bild führen.6
Ferner: Luther hatte unverkennbar ein Bewusstsein für die neuen Medien seiner Zeit. Das zeigt sich im Großen wie im Kleinen: in der Übersetzung der Bibel und deren Verbreitung, ebenso in den Kleinschriften, mit denen er sich zu drängenden Fragen der Zeit äußerte, oder in seinen wissenschaftlich-theologischen Publikationen. Dazu gehört auch, was Luther und seine Mitstreiter auf dem Liedsektor leisteten: Denn populäre Musik mit nichtlateinischen, volkssprachigen Texten in überschaubaren, kleinen Formen war nun einmal etwas, an dem sich die Musikdrucker damals abarbeiteten. In diesen Kontext gehört auch »Ein neues Lied wir heben an«, der balladenartige Liedbericht über zwei reformatorische Glaubensmärtyrer in Brüssel – dessen Textanfang nur genau dieses Lied einleitet, nicht aber auf eine neue Liedkultur verweist.
Auch die Einstellung der Reformatoren zur Wirkung kirchlicher Musik wird nach dem Betrachteten verständlich. Wenn Ulrich Zwingli und Jean Calvin Orgelmusik und die überkommene Form der Mehrstimmigkeit infrage stellten oder gar ablehnten, lässt sich dies auf den liturgischen Nutzen dieser Musik beziehen: Wer Glaube aus der Bibel herleitet, konnte durchaus ein belastetes Verhältnis zu einer kirchlichen Musik haben, deren Text in den Tiefen des architektonischen Raumes verloren geht – oder analog dazu (was die Orgel betrifft) gar keinen Text hat. Dieses Denken kann auch Luther nicht fremd gewesen sein. Doch weder er noch sein engerer Umkreis sahen hier drängenden Handlungsbedarf (vgl. 2. Kapitel).
Viel eher regte Luther an, genau die Gesänge beizubehalten, die jenen akustischen Eindruck des Kirchenraumes damals prägten. In seiner frühen Schrift Vonn ordenung gottis dienst yn der gemeyne schreibt er 1523: »Das gesenge yn den sontags messen und vesper laß man bleyben, den sie sind fast gutt, unnd aus der schrift gezogen.«7 Auch ihm ging es um den Text; solange dieser aus der Bibel stammte, hatte er mit den überkommenen liturgischen Gesängen keine Probleme. Vielen von ihnen liegen Psalmausschnitte zugrunde. Und dies setzt sich in manchen seiner Lieder fort: »Ein feste Burg« und »Aus tiefer Not« sind Psalmlieder, also direkt »biblisch«; dieses Prädikat können »Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort« oder »Ein neues Lied wir heben an« nicht für sich beanspruchen.
Dass Kirchgänger von den alten liturgischen Gesängen nur deren musikalische Aspekte erleben konnten, hat Luthers Denken offensichtlich nicht beeinflusst. Viel wichtiger waren ihm die Interpreten dieser in Musik gefassten Texte: die Schüler. Er ging offensichtlich davon aus, dass Lernende, die ihren Platz im Bildungssystem finden mussten, Glaubenstexte besser verinnerlichten, wenn diese sich mit Musik verbanden: Deshalb verfolgte er die Absicht, mit Liedern »das heylige Evangelion […] ynn schwanck [= in Schwang] zu bringen«, und zwar mit vierstimmigen Sätzen, sodass der Schuljugend »das guete mit lust, wie den jungen gebührt, eyngienge«.8 Die Texte brauchten nicht unbedingt ins Deutsche übersetzt zu sein; denn von der weltweit geübten Bildungssprache Latein wollte Luther die Gläubigen nicht abgrenzen. Deshalb zieht sich durch die frühe liturgische Praxis des Luthertums wie ein roter Faden der Hinweis, dass Städte mit größeren Lateinschulen Sonderregelungen hinsichtlich der Gottesdienstgestaltungen hätten; stets geht es dabei um das Lateinische, und mit ihm öffneten sich auch Räume für mehrstimmige Musik. Wie sich dies – auch im Unterschied zur vorreformatorischen Zeit – gestaltete, ist ebenfalls näher zu betrachten.