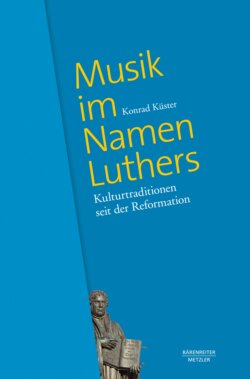Читать книгу Musik im Namen Luthers - Konrad Küster - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wolfgang Musculus in Eisenach und Wittenberg, 1536
ОглавлениеAll die Offenheit, die in den Äußerungen zwischen 1523 und 1533 offensichtlich mit Absicht liegt, musste dennoch für den sonntäglichen »Ernstfall« konkretisiert werden. Dafür, wie Menschen im direkten Umkreis Luthers den Gottesdienst wirklich erlebten, gibt es ein aufschlussreiches Dokument; es verdankt sein Entstehen einem Umstand, der einem modernen Verbrauchertest ähnelt. »Prüfer« war Wolfgang Musculus, der 1536 (drei Jahre nach Publikation der zitierten Kirchenordnung) aus seiner Heimat, der Reichsstadt Augsburg, nach Wittenberg entsandt wurde, um dort an den Beratungen zur »Wittenberger Konkordie« teilzunehmen. Deren Zweck war die Beilegung einer Unsicherheit in einer elementaren Frage des Glaubenslebens: Ist Christus beim Abendmahl real anwesend, oder ist dieses nur ein Gedächtnismahl? Musculus reiste zunächst an den ursprünglich vorgesehenen Tagungsort Eisenach; Luther jedoch war erkrankt, sodass die Teilnehmer sich in Wittenberg trafen. An beiden Orten protokollierte Musculus für seine Augsburger Auftraggeber, was er im Gottesdienst erlebte; anscheinend wollte er so viel Orientierung wie möglich nach Hause mitnehmen.24
Als »Prüfer« ist Musculus ideal für die Nachwelt. Denn als Abgesandter einer oberdeutschen Reichsstadt kannte er auch die andersartigen gottesdienstlichen Formen, die die Reformation im Südwesten Deutschlands bis hin zur Schweiz hervorgebracht hatte. Sie waren entstanden, weil die örtlichen Reformatoren zuvor als Prediger Aufmerksamkeit erregt hatten, außerhalb der Messe; ihre Predigtfeiern wurden in jenen Städten zum gottesdienstlichen Normalfall erklärt. Und weil diese Predigten von Gesängen der Gläubigen eingerahmt worden waren, sah die liturgische Praxis dort fortan völlig anders aus.25 Wohl auch wegen dieser liturgischen Unterschiede ist Musculus’ Bericht sehr detailliert, und wenn er an den Reisestationen notiert, die Liturgie folge dem päpstlichen Ritus (»…more papistico«), bezieht sich dies auf eine Reformation, in der die Messe abgeschafft worden war. In Eisenach erlebte er den Gottesdienst am Sonntag Cantate mit, in Wittenberg dann zwei Wochen später am Sonntag Exaudi.
Der Eisenacher Gottesdienst begann mit einem traditionellen Introitus, gesungen vom Schulmeister und dem Schülerchor. Tatsächlich handelte es sich um den »päpstlichen« Gesang, von dem dieser Sonntag seinen Namen hat: um »Cantate Domino«, den Beginn des 96. Psalms. Offensichtlich wurde also keine der für Wittenberg entwickelten Formen praktiziert. Dann war das Kyrie erreicht, das nach Musculus’ Beobachtung irgendwie abwechselnd mit der Orgel gesungen wurde; wer die Sänger waren, berichtet er nicht. Was es mit diesem Gesang auf sich hatte, erschließt sich nur indirekt, doch jedenfalls zeigt sich: Auch das Kyrie wurde anders als in Wittenberg behandelt.
Dort war für normale Sonntage das Urkonzept abgeschafft worden: Jeder der drei Teilsätze (»Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison«) war einst dreimal nacheinander gesungen worden. Luther aber wollte dieses »neunmalige Kyrie« nur noch an Festtagen zulassen und empfahl stattdessen, jeden Satz nur einmal zu singen. Hätte man sich in Eisenach dies zu eigen gemacht, wäre an einem normalen Sonntag ein »Abwechseln« zwischen Sängern und Orgel nicht möglich gewesen: Entweder wären die beiden Kyrie-Sätze gesungen und das zentrale »Christe eleison« von der Orgel gespielt worden; dann hätte man diese Anrufung nie eigens gehört.26 Noch unwahrscheinlicher ist der umgekehrte Fall: Die Orgel hätte beide »Kyrie«-Anrufungen gespielt, der Chor nur für das »Christe eleison« Text benutzt. Also müssen die drei Teilsätze je dreimal vorgekommen sein. Wie dann eine Orgelmitwirkung funktionierte, zeigen Manuskripte der Jahrzehnte um 1500:27 Im einleitenden Kyrie wird ein einzelner gesungener Vortrag von zwei Orgelanteilen eingerahmt; in umgekehrter Anordnung folgen die drei Durchgänge des »Christe«. Darüber hinaus enthalten jene Quellen noch ein »Kyrie ultimum« für Orgel. Diese Abfolge ist einleuchtend: Wenn die Orgel beginnt, ist für die Sänger-Fortsetzung die Intonation gesichert.
Wie in der Messe üblich, folgte in Eisenach das Gloria: intoniert vom Pfarrer, sofort fortgesetzt von Chor und Orgel, vermutlich wiederum im Wechsel; zwar äußert sich Musculus nicht dazu, doch es gab in Eisenach sogar Vokalmusik, die eigens auf diese Aufführungsform ausgerichtet war (vgl. 5. Kapitel). Damit war das erste Kollektengebet erreicht, das der Pfarrer ebenso sang wie die anschließende Epistellesung. Das nächste Element des traditionellen Messablaufs wäre nun die Gruppe aus Graduale, Alleluja und Sequenz gewesen; nur die Letztere kam vor. Musculus zufolge spielte zuerst die Orgel; dann trug der Chor die erste Strophe der Ostersequenz »Victimae paschali laudes« vor, und »das Volk« antwortete mit »Christ ist erstanden«. Weitere Angaben macht er nicht, wohl weil ihm der Ablauf selbstverständlich war; also wechselten die lateinischen Strophen und die der mittelalterlichen Leise so ab, wie dies auch nach der Wittenberger Kirchenordnung intendiert war. Dennoch wünschte sich die Nachwelt von Musculus mehr Klarheit: Fiel der Orgel nach der Einleitung nochmals ein Anteil an der Sequenz zu? Und welche der beiden Varianten, deutsche Texte in die lateinische Sequenz einzubringen, wurde gewählt: Wurde immer nur (wie traditionell üblich) die erste Leisen-Strophe gesungen – oder jeweils genau die Liedstrophe, die sich auf die vorausgegangene lateinische bezog?
Wieder im Sprechgesang trug der Pfarrer das Evangelium vor; danach spielte erneut die Orgel, und »ecclesia« sang »Wir glauben all an einen Gott«, also nach Wittenberger Praxis auch hier die ganze Gemeinde. Die Abfolge ist wiederum eindeutig: Erst spielte die Orgel, dann sang die Gemeinde das Lied; eine Orgelbegleitung war nicht vorgesehen. Predigt, Abendmahlsvorbereitung und -austeilung folgten; nach den Einsetzungsworten spielte erst die Orgel, und während die Gemeinde zum Abendmahl ging, sang der Chor »Agnus Dei«. Diesem folgte ein gesungenes Schlussgebet, der Segen, und, vom Chor gesungen, das deutsche »Da pacem«: »Verleih uns Frieden gnädiglich«. Wäre daran die Gemeinde beteiligt gewesen, hätte Musculus mitgesungen und dies protokolliert.
Somit handelte es sich nicht völlig um eine »Wittenberger« Messe; der Eisenacher Gottesdienst ging auch von lokalen Sondertraditionen aus, die sich in zahlreichen Details noch klarer fassen lassen (vgl. 5. Kapitel).28 Schön zu sehen ist, wann die Orgel spielte, erkennbar aber auch, dass kein veritables Gemeindelied vorkam, sondern nur die üblichen, »wiederkehrenden« Gesänge.
Zwei Wochen später, in Wittenberg, bot sich Musculus ein nur geringfügig anderes Bild, das aber erneut die minimal älteren »Vorschriften« relativiert. Ausdrücklich schreibt Musculus, dass die Orgel den Vortrag von Introitus und Kyrie eröffnete und am Gloria mitwirkte; dieses wurde vom Liturg eröffnet. In der Kollekte nach dem Gloria ergab sich laut Musculus ein Wechselgesang zwischen Pfarrer (»Der Herr sei mit euch«) und Chor (»und mit deinem Geist«); nicht einmal diese Antwort übernahm also die Gemeinde. Kollekte und Epistellesung wurden gesungen, aber beide mit lateinischem Text, und vor dem folgenden Lied, das der Chor vortrug, spielte erneut die Orgel. Zwischen den Lesungen gab es keine Sequenz (weil sie zwischen Himmelfahrt und Pfingsten nicht vorkommt), aber auch keines der in den alten Vorschriften vorgesehenen Lieder: weder »Mitten wir im Leben sind« noch »Nun bitten wir den heiligen Geist« oder »Nun freut euch, lieben Christen gmein«, sondern »Gott der Vater wohn uns bei«.29 Diese Offenheit der Liedwahl mag die Verpflichtung des Schulmeisters spiegeln, nicht immer dieselben Lieder singen zu lassen,30 wieder aber bezogen auf einen Gesang der Schüler. Diese übernahmen – sonderbarerweise – anschließend auch das Glaubenslied zwischen Evangelium und Predigt. Oder hat Musculus hier nicht richtig aufgepasst?
Nach der Predigt sang der Chor auf Latein die Friedensbitte »Da pacem, Domine« (die in Eisenach, deutsch gesungen, den Gottesdienst beschloss). Und als Gesänge, die während der Austeilung des Abendmahls vorgetragen wurden, protokolliert Musculus neben dem lateinischen Agnus Dei die Lieder »Jesus christus etc. Gott sey gelobet etc.«, also exakt die drei Gesänge, die auch laut Wittenberger Kirchenordnung die ersten Präferenzen waren; wer die Gesänge sang, sagt Musculus nicht, doch angesichts des Lateinischen im Agnus Dei kommt auch hier nur der Chor in Betracht. Einen Schlussgesang gab es nicht; nach dem gesungenen Segen des Pfarrers endete die Messfeier.
Auch mit Musculus’ doppeltem Praxistest also verfestigt sich das Bild. Die Rolle der Musik in der lutherischen Messe leitet sich aus deren spätmittelalterlichem Vorgänger her und wurde nur punktuell anders gestaltet (Credo-Lied, Musik im Umkreis des Abendmahls). Ein veritables »Gemeindelied« ist nicht in Sicht. Besonders wertvoll sind Musculus’ Hinweise auf Anteile der Orgel, die in den zitierten Schlüsselschriften nirgends erwähnt sind; stets spricht er von Solospiel.