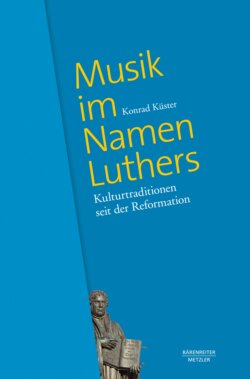Читать книгу Musik im Namen Luthers - Konrad Küster - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Sängerkönig
ОглавлениеVor allem die Herrscher traf der Auftrag, dass alle Gläubigen schon auf Erden Gottes Lob auf bestmögliche Weise zu singen hätten: Ihre Ensembles konnten (und mussten) dabei musikalisch mehr leisten als andere Sterbliche. Für sie kam noch eine Komponente hinzu: König David. Dass er Musiker war, stand ohnehin außer Zweifel. Dass die Geschichten, die von ihm erzählt werden, keinerlei Vorbehalte gegenüber Instrumenten zeigen und diese im Psalter detailliert erwähnt werden, machte ihn für das Luthertum zur idealen Identifikationsfigur darin, auch auf dem Gebrauch der Instrumente zu beharren. Zudem30 spielte er für Saul auf der Harfe, wenn über diesen »der böse Geist« kam; das unterstrich die positive Wirkung der Musik. Doch David war noch mehr. Mit seiner Steinschleuder besiegte er Goliath; dies machte ihn zum Verteidiger eines rechten Glaubens. Und er war König. Also mussten sich Herrscher an dem kompletten Davids-Konzept messen lassen. Neben der Verteidigung nach außen mussten sie auch innerer Feinde gewärtig sein – wie David, der von seinem Vorgänger Saul und von seinem Sohn Absalom verfolgt wurde. Zugleich lassen die Bußpsalmen David als demütig erscheinen: ein weiterer Auftrag an Herrscher. All dieses wird in den einschlägigen »Fürstenspiegeln« der Zeit herausgearbeitet, und zwar überkonfessionell; und es gehörte mit der Musik (zumindest deren Förderung) untrennbar zusammen.
Schon Walter fordert von Herrschern zumindest ein umfassendes Mäzenatentum für Musik:
Wenn David itzund leben solt
Weil Gottes zusag ist erfült,
Er würd die Music hocher [= höher] ehrn
Kein gelt nicht sparn[,] die kunst zu mehrn,
David solt ein exempel sein
Der Herrn und Fursten liecht und schein,
Das sie zu dieser heilgen kunst
Ihr leblang hetten lieb und gunst.31
Die beiden Seiten, der Ewigkeits- und der Davids-Bezug, kamen zusammen in dem Gedicht, das Schütz zum Tod Heinrich Posthumus Reuß’ dichtete.32 Dieser habe nach den Zerstörungen des Krieges für den Wiederaufbau von Schulen und Kirchen gesorgt und dann »wie David selbst auch […] Zung und Hand, / Durch gantz kunstreichen Schall, erhoben und gewandt / Zu Gottes Ehr und Preiß.« Heinrich also ist dem Davids-Auftrag gerecht geworden und hat die musikalischen Anforderungen der Ewigkeitsauffassung konkret erfüllt.
Eine besondere Note im Umgang mit David ergab sich für den niederländischen Calvinismus, der eine eigene Orgelleidenschaft entwickelte (vgl. 4. Kapitel). David als Stifter des Psalters bot Calvinisten ohnehin einen Bezugspunkt; Calvin sah nicht zuletzt in allen Anfechtungen, die er als Reformator durchlebte, eine innere Verwandtschaft zu dem Psalmisten.33 Dieser ist daraufhin, ausgestattet mit der Harfe als Attribut, in unzähligen calvinistischen Kirchen an Orgeln, die zur Förderung des Psalmengesangs dienten, abgebildet worden. Lutheraner teilten dieses Bildkonzept, waren aber nicht an das dominante Bildmotiv des Harfenspielers gebunden: Auch der Kampf gegen Goliath wird an Orgeln wiedergegeben – letztlich vertraten ja nur die Rechtgläubigen auch ein Kirchenmusikkonzept, das die Instrumente einschloss. Doch findet sich dieses Motiv wiederum auch im reformierten Kontext: Auf den Türen, mit denen seit 1591 die Orgel in Uphusen bei Emden verschlossen wurde, sah man, wenn sie geöffnet waren, den Triumphzug des kleinen David, der das abgeschlagene Haupt Goliaths vor sich her trägt.34
So stand David vielen Gläubigen vor Augen – in nahezu allen Regionen. Psalmen hatten ohnehin eine Schlüsselbedeutung für den Gottesdienst: Ausschnitte aus ihnen bildeten ein Rückgrat des gregorianischen Chorals; ganze Texte lebten in den Vespergottesdiensten auch des Luthertums weiter. Als Lieder gefasst, treten die »Psalmen« (als Nachdichtungen tatsächlicher Psalmtexte) bisweilen direkt in das Dreierkonzept ein, das der Apostel Paulus in den beiden für die Musik so wichtigen Bibelzitaten umreißt: »Redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern«. Psalmen lassen sich als Lieder nachdichten, Lobgesänge entsprechen den Hymnen der gregorianischen Praxis, und »geistliche Lieder« sind für das außerkirchliche Singen gedacht. Nach dieser Dreiergliederung ist der Liedbestand ausdrücklich im Konstanzer Gesangbuch von 1540 angeordnet; doch auch Luther sah diese Gliederung, nach der – ganz konkret – die Liedfolge des von ihm mitbetreuten »Babst’schen Gesangbuches« von 1545 eingerichtet ist.35 David war allgegenwärtig.