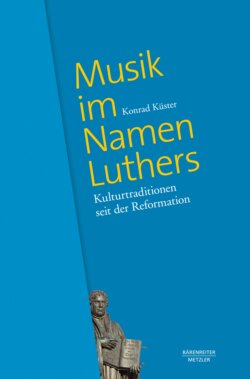Читать книгу Musik im Namen Luthers - Konrad Küster - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Musikprofis – Musikamateure Kantoren und Organisten, Lateinschüler und Adjuvanten Director musices und Stadtpfeifer
ОглавлениеDie nachhaltige Sicherung der neuen Glaubensgrundsätze wuchs den Schulen zu. Kloster- und Kathedralschulen gingen in kommunale oder territoriale Trägerschaft über, und bis hinunter in kleinste Gemeinden reichte das Schulwesen. Es wurde mit den Gemeindekirchen verknüpft; dies prägte das Unterrichtsleben der folgenden Jahrhunderte – und ebenso die Musik.
Wie dies funktionierte, lässt sich von der Situation in Leipzig aus beschreiben. Bach als Thomaskantor war nicht an einer Kirche angestellt, sondern an der Thomasschule. Trägerin war die Stadt. Diese hatte aber noch eine andere bedeutende Schule zu verwalten: die Nikolaischule, die der anderen Hauptkirche angeschlossen war. Beide Kirchen trennt ein Fußweg von 500 Metern. Da eine innerstädtische Konkurrenz nicht sinnvoll erschien, hatten die Stadtväter eine Strukturentscheidung getroffen: An der Thomasschule war ein musikalisches Profil gebildet worden, an der Nikolaischule ein wissenschaftliches. Das heißt: Selbstverständlich hatte auch die Thomasschule ihren nichtmusikalischen, wissenschaftlichen Zweig; umgekehrt gab es auch im Kollegium der Nikolaischule einen Kantor. Das, was dieser tat, blieb jeweils weit hinter dem Wirken seines Nachbar-Kollegen zurück, entsprach aber dem Berufsprofil vieler zeitgenössischer Kleinstadt-Kantoren. Eine größere musikalische Entfaltung war nicht nötig, denn die Profilbildung an der Thomasschule hatte gerade zum Zweck, den Kantor der Nikolaischule zu entlasten. Dies war eine Grundlage dafür, dass Bach mit dem Titel »Director musices« unterschreiben konnte: als Musikdirektor der Stadt. Er sorgte dafür, dass in beiden Hauptkirchen musiziert wurde; das beste und das zweitbeste Sängerensemble sangen in ihnen im umschichtigen Wechsel, weitere Schüler in den Nebenkirchen der Stadt.
Ein erstes Modell dazu, wie die beiden Hauptkirchen von nur einer Schule aus mit Figuralmusik versorgt werden konnten, hatte Sethus Calvisius entwickelt, Thomaskantor der Zeit zwischen 1594 und 1615.1 Seine strukturellen Umgestaltungen gaben dem Thomaskantor zugleich die Funktion eines städtischen Musikexperten: Er konnte in übergeordneten musikalischen Fragen um Rat gefragt werden, auch im Orgelbau. Und dem Amt wuchs die Dienstaufsicht über das Kollegium der Stadtpfeifer zu, die zugleich zu einem integralen Teil des Musikensembles wurden. Doch in beidem liegt kein Automatismus. Warum ein Kantor befragt wird (und nicht ein Organist), wenn es um Orgelbau geht, ist eigens zu betrachten; wie aber stand es um die Stadtpfeifer?
Viele Orte hielten sich einen Musikanten, der auf einem durchdringenden Blasinstrument zu repräsentativen Zwecken Signale spielen konnte, bisweilen auch, von einem Turm über die Dächer der Stadt hinweg, Liedmelodien. Die Professionalität, die für dieses Signalblasen erforderlich war, war hoch; aber da die Signale nicht häufig genug gebraucht wurden, lag die Honorierung weit unterhalb dessen, was zum Leben notwendig war. Und so wurde der Job des Musikanten mit weiteren Komponenten ausstaffiert, die die kommunale Kasse nicht belasteten: Dem Musikanten wurde ein Musizierprivileg für alle erdenklichen privaten Anlässe der Einwohnerschaft gegeben. Niemand durfte für Tanzmusik einen anderen Instrumentalisten engagieren als den Inhaber des Privilegs, das für einen klar abgegrenzten Bereich galt, eine Stadt oder auch ein größeres Landgebiet. Diese Musiker lebten in vielen Orten also davon, für jeden Auftritt bei ihrer Kundschaft fixe Gebührensätze erheben zu können, wie zunftangehörige Handwerker. Nicht selten kam es zu Konflikten mit den Musikanten des stehenden Militärs; diese hatten in Friedenszeiten kaum etwas zu tun und suchten Nebeneinkünfte – womit dann die territorialen Militär- und die kommunalen Verwaltungsstrukturen miteinander in Konflikt gerieten.2 Unsicher waren die Einkünfte allemal, denn die Bereitschaft der Bevölkerung, in Musik zu investieren, war konjunkturabhängig. Und waren Lustbarkeiten verboten, weil das Land nach einem Todesfall in der Fürstenfamilie in kollektive Trauer verfallen war, konnte dies für Musikanten existenzbedrohend werden.
Die Vielfalt ihrer denkbaren Aufgaben bestimmte zugleich das Instrumentarium. Typisch war das Spiel auf dem Zink, einem Blasinstrument mit kleinem Trompetenmundstück und Grifflöchern, aus Holz gearbeitet und mit Leder umwickelt; es konnte ähnliche Klänge hervorbringen wie eine (weich klingende) Barocktrompete, wurde häufig als höchstes Instrument des Posaunenchors eingesetzt und konnte auch bei Kälte und Nässe Verwendung finden. Und wer das kleine Trompetenmundstück des Zinks zur Ton-Erzeugung benutzen kann, konnte sich auch auf eine ausgewachsene Trompete einstellen; die Griffloch-Technik des Zinks wiederum ähnelt derjenigen aller Holzblasinstrumente. Daneben wurden Violinen und andere Streichinstrumente benötigt, mindestens für Tanzmusik; sie waren aber nicht geeignet, um bei Wind und Wetter im Freien gespielt zu werden. Kurz: Wer Stadtpfeifer sein wollte, musste viele Instrumente beherrschen; je mehr, desto besser. Spezialisierung war nur ausnahmsweise möglich: In einigen norddeutschen Städten entsprossen den Ratsmusikkollegien Geiger, die die internationale Violinkunst entscheidend voranbrachten, darunter Musiker wie Dietrich Becker (Hamburg), Nicolaus Bleyer und sein Schüler Nathanael Schnittelbach (beide in Lübeck). Eine Ausnahme war auch Gottfried Reiche, ein Trompetenvirtuose, der im Leipzig der Bach-Zeit die Stadtpfeifer anführte, Musik für sein Instrument drucken und sich mit diesem porträtieren ließ.
Kirchenmusik, die mit den Strukturen der Stadtmusiker verknüpft war, wurde selbst von deren Universalismus geprägt. In der Mehrchörigkeit der Zeit um 1600 konnte ein so vielfältig einsetzbarer Stadtmusiker in jede der komponierten Stimmen eintreten; aus der Lage der Stimme resultierte dann, zu welchem Instrument er griff. Und in späteren Zeiten konnte der Musikant von einem Satz zum nächsten das Instrument wechseln; kommen in einer Bach-Kantate einmal zwei Blockflöten vor, an einer anderen Stelle zwei Oboen, hilft die Vorstellung weiter, dass hier nur zwei Spieler gefragt waren, nicht also zweimal zwei »Spezialisten«.
Wie in Leipzig gab es in größeren Städten (oder auch: in größeren Landgebieten) statt nur eines Musikanten ein umfangreicheres Musikantenteam. Dessen Mitglieder bildeten eine zunftmäßig organisierte Gruppe, wie im Handwerk mit Gesellen und Lehrlingen. Handwerker wirkten häufig in derselben Straße; das galt auch für die Stadtmusiker. In Erfurt wohnten sie am Junkersand (auch die frühen Mitglieder der Familie Bach, die sich in den dortigen Stadtpfeifer-Strukturen profilierten); und in Leipzig hieß sogar bis ins 19. Jahrhundert eine Straße ausdrücklich »Stadtpfeifergässchen« (die heutige Magazingasse im Süden des Stadtzentrums). Aufgaben der Leipziger Stadtpfeifer lassen sich bis heute am Alten Rathaus ablesen: Gespielt wurde auf einer Empore im Ratssaal (dem »Musikantenstuhl«) und auf einem Balkon am Rathausturm; beide sind erhalten geblieben.
Die Leipziger Stadtpfeiferei, 1479 eingerichtet, erklärte sich 1587 zur Innung und hatte damit eigentlich den gleichen Status wie andere Zünfte. Doch die Stadt zahlte ihren Stadtpfeifern ein Grundgehalt und hatte sich damit über die eigentlichen Zunftstrukturen gesetzt. Die Stadtmusiker waren also quasi als städtische Teilzeitbeamte in eine Behördenhierarchie eingebunden, und in ihr wurde der städtische Director musices, einst »nur« Kantor der einen Schule, zum Dienstvorgesetzten der Musikanten.
Der ingeniöse Sonderfall wurde kopiert: von Thomas Selle. 1599 geboren, hatte er selbst die Thomasschule besucht, und zwar in ihrem »Musikprofil«; sein Kantor war anscheinend zuerst Sethus Calvisius gewesen, dann Johann Hermann Schein. 1641 wurde er in Hamburg zum Kantor am Johanneum gewählt, dem akademischen Gymnasium der Stadt. Dieses war 1529 von Bugenhagen als zentrale Lateinschule eingerichtet und im säkularisierten Johanniskloster untergebracht worden; an keiner der vier Hauptkirchen entstand also auf Kosten der anderen ein schulisches Zentrum. Erst Selle jedoch entwickelte einen Plan, wie diese vier Kirchen vom Musizieren der Sänger, die am Johanneum ihre Schulausbildung absolvierten, gleichmäßig profitieren konnten,3 und er hatte zugleich die Aufsicht über die »Ratsmusikanten«.4
Selles Übertragung des Leipziger Modells auf Hamburg hatte eine Schwachstelle. Eine Stadt mit vier Hauptkirchen konnte allein durch ein Alternieren des Ensembles nicht adäquat versorgt werden. Die Probleme zeigten sich jeweils an den Hochfesten Weihnachten, Ostern und Pfingsten, die über drei Tage hinweg gefeiert wurden: Drei Kirchen konnten jeweils in Folge von dem Musikensemble besucht werden, eine vierte musste leer ausgehen. Doch konnten die Organisten in die Bresche springen; das Fest litt also nicht, wenn der Kantor die anderen Kirchen besuchte. Allerdings machten diese Organisten andere Musik als der Kantor: nicht zusammen mit Schülern, und sie spielten auch nicht nur solistische Orgelmusik. Wie also funktionierte ihr »Ersatz«?
Die Musizierbereiche des Kantors und des Organisten waren baulich voneinander getrennt, und an manchen Orten ist dies bis heute erkennbar geblieben: Oft gab es, wie im Eisenacher Gesangbuch von 1763 sogar eigens bezeichnet, zwei direkt übereinander angeordnete Emporen, oben die der Orgel als »Music Chor«, darunter die der Schüler. Wollte ein Kantor auf dem »Sing und Schüler-Chor« den Gesang instrumental stützen lassen, benötigte er ein Orgelpositiv, denn zu »der« Orgel gab es keinen Sichtkontakt. Und neben dieser gab es nur enge Durchgänge, in denen die Schüler nicht genügend Platz gefunden hätten. Wollte der Organist gemeinsam mit anderen musizieren, bestimmte das Raumangebot also Besetzung und Stil; er konnte Einzelinterpreten um sich gruppieren, kaum mehr als zwei Musiker, die dann seine Professionalität teilen mussten: in virtuoser Generalbassmusik.
Orgelempore und Schülerempore · Diese Aufteilung war in vielen Kirchen anzutreffen: In der idealisierten Wiedergabe der Architektur der Eisenacher Georgenkirche wird die Orgelempore als »Music Chor« bezeichnet (links und rechts des Spieltisches), die darunterliegende Empore als »Sing und Schüler-Chor«. Beide Musizierbereiche sind also voneinander getrennt. Ganz unten sind in den Bänken einige Gottesdienstbesucher dargestellt.
Eisenachisches Neurevidirtes und beständiges Gesangbuch, 1763, Ausschnitt aus dem Titelkupfer.
Kein Leipziger Hauptkirchen-Organist konnte sich im 17. und 18. Jahrhundert derart neben dem Musikdirektor profilieren. Dies war auch nicht nötig, denn beide Kirchen waren durch das Alternieren der Ensembles lückenlos versorgt. Doch zeigt sich zugleich ein struktureller Unterschied: Ein Organist in Hamburg blieb nicht so weit im Hintergrund wie ein Leipziger Kollege. Die musikalischen Funktionen waren also im Luthertum nicht einheitlich definiert – trotz einer gemeinsamen Grundlage.