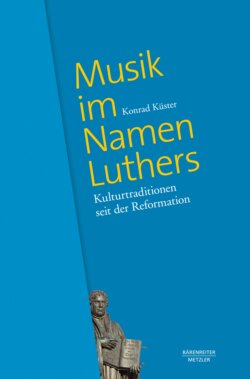Читать книгу Musik im Namen Luthers - Konrad Küster - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kirchenmusik mit Erwachsenen?
ОглавлениеHatten junge (männliche) Lutheraner die Klassenstufe des Kantors absolviert, waren für sie die lateinischen Floskeln der Bildungs- und Verwaltungssprache keine Fremdwörter mehr. Was aber stellten sie als Erwachsene mit den parallel dazu gewonnenen musikalischen Erfahrungen an? Diese Frage verbindet sich mit den musikalischen Dimensionen der Rechtfertigungslehre: Wer dem ewigen Engelskonzert beitreten wolle, müsse musikalisch lebenslang sein Bestes geben; Glaube praktiziere man nicht dadurch, dass man sonntags nur einfach zur Kirche gehe und sich gerade einmal die Predigt des Pfarrers anhöre. Oder, wie Joseph Pipping 1653 es in Altenbruch ausdrückte: »Die aber, welche die Music und geistliche Lieder verachten, wie die jenigen thun, welche (NB) so gar späte zur Kirchen kommen, oder sich sonsten schämen den Mund auffzuthun, die Stimme zu erheben, und mitzusingen, die setzen sich selbsten in grosse Gefahr.«20 Wer also aus Musik-Unlust »gar späte« kommt, war für die Predigt noch immer rechtzeitig in der Kirche – nach der ersten Gottesdienststunde mit ihren dominanten musikalischen Elementen. Doch das war nicht »gelebter Glaube«: Ein »Allein durch das Wort« zählte nicht. Also führte auch für Erwachsene am bestmöglichen, aktiven Musizieren kein Weg vorbei, und so stellt sich die Frage nach den Mitwirkungsmöglichkeiten. Ihre Beantwortung ist vertrackt – nicht zuletzt deshalb, weil nur an relativ wenigen Orten zu diesem Musizieren Dokumente greifbar sind.
Eine erste Information liefert Michael Altenburg, der 1620 als Pfarrer in Tröchtelborn (damals zum kurmainzischen Erfurt gehörig) Kompositionen herausbrachte und im Vorwort zu seinem Ersten Teil neuer lieblicher und zierlicher Intraden schrieb:
Daß aber die liebe Musik sehr hoch gestiegen bezeugt nicht allein die Betrachtung der Fürtrefflichen und herrlichen Compositionum, sondern auch der Oerter, da die Musik in Schwange gehet. […] Ist doch bald kein Dörflein, bevorrauß [= besonders] in Thüringen darinnen Musica[,] beydes Vocalis und Instrumentalis […] den Oertern nach sollte floriren und wohlbestellet sein. Hat man ja kein Orgelwerk, so ist doch die Vocalis Musica zum wenigsten mit ein 5 oder 6 Geigen orniert [= geschmückt] und geziert, welches man vorzeiten kaum in den Stätten hat haben können.21
Dies gilt als Schlüssel zur Kultur der Thüringer »Adjuvanten«: der »Helfer« in der Kirchenmusik. Vielerorts waren sie vereinsmäßig organisiert, und die Adjuvantenchöre besaßen umfangreiche Musiksammlungen – besonders bekannt sind Sammlungen im gleichfalls erfurtischen Dorf Udestedt sowie in Großfahner, Vogelsdorf, Molsdorf und Thörey in der näheren Umgebung oder in Gräfenroda am Thüringer Wald.
Analog dazu gab es in Sachsen »Kantoreigesellschaften«; sie zu verstehen ist schon aus terminologischen Gründen schwer. »Kantorei! Dieses Wort hat romantischen Klang«, schwärmte im Jahr 1940 Arno Werner.22 Kirchenmusiker in Bitterfeld, der über Jahrzehnte hinweg und in einem großen Radius um seine Heimatstadt herum Quellenbestände erschloss; schon 1902 hatte er eine große Studie zu den sächsischen Kantoreigesellschaften veröffentlicht, die nach wie vor musikhistorische Arbeitsgrundlage ist. Doch der Begriff »Kantorei« ist unscharf; für das frühere 20. Jahrhundert mag er insgesamt auf Traditionen einer Laienchor-Bewegung verwiesen haben (so, wie kirchliche Chöre den Namen »Kantorei« tragen können), ohne dabei einzuschließen, dass auch Profi-Ensembles so hießen – allen voran die 1548 gegründete Gruppierung, auf die die Sächsische Staatskapelle Dresden ihre Geschichte zurückführt. Von »Hofkantoreien« setzen diese Kantoreigesellschaften sich ab, und ebenso überlappen sie nur bedingt mit den Sängergruppen der Schulen, denen ein Kantor voranstand (und die daher ebenfalls als »Kantoreien« erscheinen können). So muss man sich von dem – für Werner so wichtigen – Begriff lösen: Es ist wichtiger, der Sache selbst auf den Grund zu gehen.
Schon für die Zeit vor der Reformation konnte Werner nachweisen, dass sich in sächsischen Städten Laiengruppen zur Mitwirkung an der liturgischen Musik trafen; dies ergab sich im Rahmen der Kalandsbruderschaften, einer mittelalterlichen Vereinsform des Bürgertums, die stets geistlicher Aufsicht unterstand. In ihnen wurde zwischen musikalischen und nichtmusikalischen Mitgliedern unterschieden; die ersteren engagierten sich im Gottesdienst. Diese historische Tiefenperspektive der Kantoreigesellschaften zeigt sich besonders in Staßfurt und Delitzsch (1439 und 1440), weniger deutlich in Chemnitz oder Döbeln.
Wie sich diese Kulturform historisch entwickelte, lässt sich zahlenmäßig darstellen: an den 126 Kantoreigesellschaften des alten Sachsen, die Werner erfasste.23 In der ersten Zeit nach der Reformation entstanden nur sehr wenige (1539 in Wahrenbrück, 1540 in Oschatz und nun in Delitzsch auch ausdrücklich); ein Aufschwung ergab sich dann seit den 1570er-Jahren. Auf diese Weise war bis 1590 ein erstes Viertel dieser Verbünde entstanden (29). Dann beschleunigte sich das Tempo zunächst: Bis in die 1630er-Jahre hinein kam mehr als das zweite Viertel hinzu (33). Die große Zeit der Kantoreigesellschaften brach erst nach dem Abklingen des Dreißigjährigen Krieges an: mit 49 Neugründungen seit der Mitte der 1640er-Jahre.24
Das lässt sich übersichtlich interpretieren. Erst im zu Ende gehenden 16. Jahrhundert konnte das generationenüberspannende Bildungssystem »greifen«: Zunächst mussten die Schulstrukturen entstehen; dann mussten die ersten Lateinschul-Absolventen erwachsen werden, im städtischen Bürgertum ankommen und sich organisieren. Zudem ist aus landespolitischen Gründen für Sachsen die Zeit um 1590 eine gliedernde Grenze (vgl. 5. Kapitel). Ein Erbe dieses neuen Denkens war Martin Rinckart, Dichter von »Nun danket alle Gott«, der während seiner Wirkungszeit in Eilenburg (ab 1617) wesentlichen Anteil am Aufbau einer Kantoreigesellschaft hatte; Impulse hierzu mag er von Calvisius bezogen haben, unter dem er als Thomaner gesungen hatte.25 Und während in der Folgezeit in der sächsischen Kirchenmusik die Instrumente heimisch wurden, um die zuvor theologisch so heftig gestritten worden war, konnte dies erst nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges auch zu einer bürgerlichen Kirchenmusik-Normalität werden. Dies alles sieht in Thüringen ähnlich aus: So wurde der Adjuvantenchor in Udestedt (1663 neu formiert) mit seinen imposanten Musikbeständen zu einem typischen Vertreter dieser Musikpraxis, ebenso rund 20 Kilometer westlich derjenige in Großfahner.26
Lange Zeit glaubte man, es habe solche Adjuvantenchöre oder semiprofessionelle Kantoreien außerhalb des historischen Gebietes von Thüringen und Sachsen kaum gegeben.27 Grund dafür ist jedoch eher, dass man sich in anderen Regionen nicht auf die Suche gemacht hatte. Schon 1901 wusste man von einer »musikalische Gilde« in Friedland im östlichen Mecklenburg.28 Vergleichbare Strukturen gab es in Bösenrode am Südostharz, das ab 1715 zum Kurfürstentum Hannover gehörte.29 Schließlich gab es Adjuvanten auch im Nordsee-Einzugsbereich, allerdings nicht mit einer vereinsmäßigen Struktur, sondern auf individueller Basis.30
Dem entspricht, dass die norddeutschen (und dänischen) Kalandsordnungen der Zeit vor der Reformation zwar den üblichen Gottesdienstbesuch erwähnen, nicht aber eine sängerische Mitwirkung der Mitglieder; anscheinend gab es hier also keine vorreformatorische Tradition darin, sich vereinsmäßig an der Kirchenmusik zu beteiligen. Das aber wirft Fragen auf: Waren dann an den Orten, deren Kirchenmusik ohne Kalandsbrüder gestaltet wurde, schon von vornherein so viele kirchliche Gesangskräfte vorhanden, dass eine Laien-Verstärkung nicht notwendig schien? Für die Corpus-Christi-Bruderschaft, die in Mohrkirch südöstlich von Flensburg bestand, ist nicht von musikalischen Verpflichtungen die Rede (1510) – also nur weil es am Ort ein Antoniterkloster gab und die Mönche allein für den Gesang einstehen konnten? Dem Marien-Kaland in Stintebüll hingegen, einem 1634 im Meer versunkenen Ort der Insel Nordstrand, stand kein Kloster zur Seite, und auch hier werden in den Kalandsregeln keine Gesangsaufgaben erwähnt; Musik gab es hingegen durchaus, sogar eine Orgel, deren Spieler in jener Zeit kein Amateurmusiker gewesen sein kann.31 Waren also die Adjuvantentraditionen auch vom örtlichen Reichtum abhängig?
Und die Fragen lassen sich fortsetzen. Klar ist, dass eine Adjuvantentätigkeit Musikausbildung voraussetzte; hatten die Aktiven also sämtlich in der Lateinschule mindestens die typische Tertia eines Kantors absolviert? In den Friedländer Regeln von 1600 scheint sich dies zu bestätigen: »Soll auch niemand dazu verstattet werden, er verstehe denn ein Wörtlein Latein und kenne die Noten..32 Wenn dies überall so galt: Dann handelte es sich bei den Adjuvanten durchweg um Angehörige der höheren bürgerlichen Schichten in Stadt und Land, also um selbstständige Handwerker, Kaufleute und Hofbesitzer. Folglich kann es ein Adjuvantenwesen in fast allen lutherischen Regionen gegeben haben – abgesehen von solchen mit Leibeigenschaft und mit Kirchen mächtiger Patronatsherren, die die (auch kulturellen) Geschicke ihres Gebietes selbst in die Hand nahmen.
Wie aber stand es um größere Städte? In Friedland bildeten »Bürgermeister, Ratsherren, Richter, Prediger, Schulkollegen und Musiker von Fach« das aktive Personal der Gilde.33 Wie also muss man sich die Mitwirkung entsprechend hochgestellter Personen etwa im Leipziger Musikleben vorstellen? Es mutet sonderbar an, dass Familienangehörige der umschichtig regierenden Bürgermeister, die in den Hauptkirchen eigene Logen hatten, in Bachs Musikensemble mitgewirkt haben könnten – doch warum: wohl nur deshalb, weil die Nachwelt die Stadtobrigkeit von der Kirchenmusik abgrenzt und kaum für möglich hält, dass deren Mitglieder sich beim (solistischen) Musizieren exponierten. Wirkte also der Leipziger Bürgermeister und Ratsherr Christoph Pincker, Schütz’ Schwiegersohn, in der Kirchenmusik mit? Und 1619 erhielt der Thomaskantor Johann Hermann Schein Geld für ein Essen mit Musikern, die nicht (wie die Stadtpfeifer) im Sold der Stadt standen – als Dank für die Mitwirkung zu den Festmusiken an Ostern und Pfingsten.34 Wurden hier allein Studenten versorgt – die für Bach eine Stütze der Kirchenmusik waren?35
Doch eine städtische Adjuvantenkultur war keinesfalls standardisiert. Aus Malchin in Mecklenburg, gerade einmal 50 Kilometer westlich von Friedland, zog im Jahr 1707 der Kantor Christian Friedrich Linde weg, um sich um das Kantorat an der ambitionierten Lateinschule in Stade zu bewerben; er begründete dies damit, dass in Malchin seine »angeschafften Jahrgänge«, also Noten mit Kirchenmusik durchs ganze Jahr, »in Ermangelung der Adjuvanten gleichsahm begraben« lagen.36 Es mag also nur ein paar Aktive gegeben haben, demnach weniger als in Friedland. Und unter den Orten, an denen Arno Werner die sächsische Kantoreitradition festmacht, ist kaum eine der zentralen Städte, also weder Leipzig und Dresden noch Zwickau, Freiberg und Meißen – nur Chemnitz macht eine Ausnahme. Eine Erklärung dieser Unterschiede ist nicht in Sicht.
Die notwendigen Bildungsvoraussetzungen waren auch in den Marschlandschaften an der Nordsee mit ihrer weitgehenden verwaltungsrechtlichen Eigenständigkeit gegeben. Zu den Adjuvanten des Lehrers, der 1653 in Altenbruch zu Grabe getragen wurde,37 gehörten drei Hofbesitzer, die auch die Geschicke des Ortes lenkten; einer von ihnen war ein Kornhändler, der in Helmstedt Jura studiert hatte. Und dass diese Adjuvantenmusik tatsächlich einen Bezug zur Eschatologie hatte, erfährt man in Oldenswort (Eiderstedt).38 wo 1652 beim Begräbnis des Gastwirts Christian Lorentz, »weilln Er vorhin bey seinem Leben, in der Kirchen mit Musiciren so vocaliter alß Instrumentaliter auffgewartet«, auf den obligatorischen Gebührensatz für das Läuten der Totenglocke verzichtet wurde. Damit wurde er Kirchenbediensteten gleichgestellt; ein Honorar hat er zu Lebzeiten nie erhalten. Sein Musizieren war also beispielhaft; es wies wiederum direkt in den Himmel. Doch er stand mit ihm nicht allein; die Kirche besaß die bis zu achtstimmigen Festgesänge von Hieronymus Praetorius, hatte also genügend Personal, um Werke dieses Umfangs in den Gottesdienst hineinzutragen. Wer seine Musizierpartner waren, sagen die örtlichen Quellen nicht.
So steht die Erforschung des Phänomens nach wie vor am Anfang. Mit einer gewissen Distanz zur Kantoreien-Begeisterung Arno Werners öffnet sich hier ein Blick auf die Glaubenspraxis der lutherischen Normalbevölkerung, abgesetzt von den großen akademisch-theologischen Diskursen der Zeit. Die Vorstellung, dass diese Menschen im Gottesdienst weiterhin bestenfalls interessierte Zuhörer waren wie in der frühlutherischen Messe, greift zu kurz; die Verantwortung des Einzelnen, das eigene Schicksal zu gestalten, setzte mehr Aktivität voraus. Diese begann mit der Glaubensübung zu Hause: Man brauchte keine pietistischen Konventikel, um sich auch außerhalb der Kirche mit Glaubensfragen zu beschäftigen; und ein Blick auf das Gesangbuch als etwas, das Gemeindeglieder nur im Gottesdienst benutzten, blendet aus, dass aus genau diesen Büchern zu Hause gesungen (und in ihnen gelesen) werden konnte. Schließlich berührt die Adjuvanten-Thematik auch das private geistliche Musizieren – und dort zugleich die Rolle der weiblichen Gläubigen: Eines der Bücher mit Gedichten von Johann Rist (in Vertonungen durch Johann Schop und Michael Jacobi) trägt den Titel Frommer und Gottseliger Christen Alltägliche Haußmusik (1654) und zeigt als Titelkupfer genau dieses: Vater, Mutter, Tochter und zwei Söhne beim instrumental-vokalen Musizieren. Auf diesem Grund entwickelte sich auch die Adjuvantenkultur, deren soziale, geographische und religiöse Differenzierung bislang nicht in einem konsistenten Bild zu fassen ist.
Häusliche Kammermusik · Eine ganze Familie ist beim Musizieren vereint. Auch Gesänge geistlichen Inhalts hatten hier einen Platz – wie in diesem Band die Musik von Johann Schop und Michael Jacobi.
Titelkupfer zu Johann Rist, Frommer und Gottseliger Christen Alltägliche Haußmusik (so der Titel im Bandinneren), 1654.