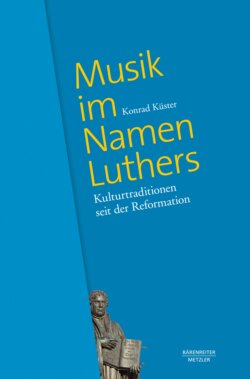Читать книгу Musik im Namen Luthers - Konrad Küster - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Musik in der Wittenberger Messe
ОглавлениеUm die Mitte der 1520er-Jahre, knapp zehn Jahre nach dem Thesenanschlag und kurz nach Luthers Rückkehr von der Wartburg nach Wittenberg, rückte die Gestaltung der äußeren Glaubensformen in den Fokus der Reformatoren, und mit dem Gottesdienst war dann unweigerlich auch die Musik berührt. Wie aber stellten Luther und die frühesten »Lutherischen« sich deren Rolle vor? Welche Mitglieder des kirchlichen Personals sollten Aufgaben übernehmen, und welche Beiträge sollten sie leisten? Der Umgang mit diesen Fragen ist doppelt schwierig. Denn die beiden Erwartungen der Nachwelt, in Luthers Gottesdienst seien Gemeindelieder und die deutsche Sprache zur Basis des Handelns geworden, lenken die Blicke offenkundig in eine falsche Richtung; die Einsicht, sie seien vielleicht revisionsbedürftig, hat sich über Generationen hinweg nicht durchgesetzt. Schon 1896 schrieb der Theologe Julius Smend über diese lutherische Frühzeit:
Wenn man die ungeheure Bedeutung des deutschen Liedes für die Reformation erwägt, wird man erstaunt sein, von dessen Klängen in unsern Gottesdienstordnungen verhältnismäßig so wenig zu vernehmen. […] Der Weg zum evangelischen Kirchenliede ist fast nirgend in der Richtung betreten worden, daß man an Stelle des hergebrachten, vorschriftsmäßigen Klerikalgesanges sofort die frischen Töne volkstümlicher Glaubensäußerung gehört hätte.9
Offensichtlich hatte man das Bild Luthers als Stifter des Gemeindegesangs, das sich aber mit der historischen Situation nicht vereinbaren lässt, allzu lieb gewonnen.
Diese ist – zugegebenermaßen – schwer zu durchdringen, denn »das« Gottesdienstkonzept, das Luther und sein Kreis entwickelten, ist alles andere als eindeutig. Sicher: Es musste für unterschiedlichste Gottesdienstbedingungen passend sein, für den dörflichen Rahmen ebenso wie für einen städtischen, obendrein auch für den akademischen wie in Wittenberg. Und an jedem Ort gab es im Vorfeld eine eigene Gottesdiensttradition. Obendrein bleiben viele prinzipielle Fragen offen, und sogar in Wittenberg selbst ist das Bild nicht kohärent.10
Einige fundamentale Schriften Luthers und seines Kreises geben erste Einblicke, wie die gesungenen Anteile eines glaubensfördernden Gottesdienstes gesehen wurden. 1526 gab Luther die Deutsche Messe und Ordnung Gotesdiensts, zu Wittenberg, fürgenomen11 in Druck, eine Muster-Agenda, die die Leser durch die einzelnen Etappen des Gottesdiensts führt. Diese Schrift lässt sich flankieren mit zwei frühen Nürnberger Drucken: Im selben Jahr erschien Das Teutsch gesang so in der Meß gesungen wirdt; schon 1524 war das Enchiridion oder hand büchlein geystlicher gesenge und Psalmen herausgekommen.12 Diese Schriften können einen Rahmen für erste Klärungen abstecken – für die in jedem Fall grundlegend ist, nicht automatisch »lutherisches Lied« mit »gottesdienstlichem Gemeindelied« gleichzusetzen.
Zunächst ist der Untertitel des Enchiridion (wörtlich griechisch für »Handbuch«) zu betrachten: Es sei »eynem yeglichen Christen fast nützlich bey sich zu haben, in steter übung und trachtung«. Ein Buch also primär für den individuellen Gebrauch? Ganz unten auf der Titelseite findet sich hingegen der Hinweis: »Mit disen und der gleichen Geseng solt man billich [= auf angemessene Weise] die iungen iugendt aufferziehen.« So verbindet sich mit diesem Werk erneut ein pädagogisches Anliegen – wie mit dem Teutsch gesang des Folgejahrs, dessen zitierter Titel mit ». zu Nutz und Gut den jungen kindern Gedruckt« fortgeführt wird.
Das Bild, das sich aus diesen Schriften ermitteln lässt, ist uneinheitlich und lückenhaft. Für die Reformatoren war dies aber kein Problem; denn der Gottesdienst folge ohnehin »menschlicher satzung«13 und sei insofern in seinen äußeren Formen nicht entscheidend. Alles Regelwerk laufe letztlich auf Gewohnheit und Langeweile hinaus.14 Und so folgt im Schlussteil des Teutsch gesang, nachdem scheinbar einen Muster-Ablauf entwickelt worden ist, gleich ein Rückzieher:
Zu letzt sagen wir, das mans brauchen mag wie man wil, es ist hie kain gesetz, sondern yederman frey, allain das es geschehe gott zu lob und ehr, auch zur besserung der gantzen gemain [= Gemeinde], dann [= denn] es sol und muß in der versamlung nichts gelehrt, gebet[et] und gepredigt werden, es verstehe es dann yederman, und sprech Amen, wie Paulus lernt.
In der Deutschen Messe formuliert Luther abschließend seine Sicht etwas konkreter:15
Diejenigen, so auß fürwitz unnd lust neuer dinge gern zu gaffen [= zuschauen], sollen sollichs [= des Gottesdienstes] gar balde müde und überdrüssig werden, wie sie bißher auch in dem lateinischen Gottesdienst gethan haben, da [= als] man in den kirchen teglich gesungen und gelesen hat und dennoch die kirchen wüst und ledig [= leer] blieben seind und schon bereit auch im teütschen thun.
Und so fährt er mit einer Begründung seines pädagogischen Fundamentalansatzes fort:
Darumb ists das beste das solcher Gotsdienst, auff die jugent gestellet werde, und auff die ainfeltigen [= Einfältigen], so zuefals [= zufällig] herzukommen. Es will doch bey den andern, weder gesetz noch ordnung, noch vermahnen, noch treyben helffen, die laß man fahren.
Folglich ist ihm die Einführung junger Menschen in ein aktives Glaubensleben das Primäre; sekundär ist, mit welchen äußeren Formen das geschieht. Doch diese Lösung war zu einfach – nicht nur für die wissbegierige Nachwelt, sondern schon für die Zeitgenossen. Denn wer sich in einer so sensiblen Situation, wie die Reformationszeit es war, mit gedruckten Äußerungen zu Wort meldet und das Dargestellte dennoch für nicht verbindlich erklärt, braucht sich nicht zu wundern, wenn dem Umschriebenen mehr Gewicht zugemessen wird als den nicht benannten Alternativen – allen Freiheitsbeteuerungen zum Trotz. Worauf zielen diese Leitlinien also ab?
Wie die Buchtitel es besagen, war der sonntägliche Gottesdienst nach wie vor eine »Messe«. Mittelalterlicher Praxis folgend, setzte sie sich aus zwei ineinander verschränkten textlich-musikalischen Teilrepertoires zusammen. Eines von ihnen ist das »Ordinarium«: die »gewöhnlichen« Textanteile, die in jeder Messfeier vorkommen, also beginnend mit »Kyrie eleison« und endend beim Agnus Dei. Diese Messteile streuen sich ebenso über den gesamten Gottesdienst wie die Stücke, die der anderen Gruppe zugehören: das »Proprium«, das »Eigentümliche« jedes Gottesdienstes, das also auf dessen Stellung im Kirchenjahr ähnlich Bezug nimmt wie die wechselnden Schriftlesungen. Von den Gesängen des alten Propriums beibehalten werden der Introitus (zu Beginn des Gottesdienstes, vor dem Kyrie) und mindestens einer der Gesänge, die traditionell zwischen den Lesungen stehen (Graduale, Alleluja, Sequenz).
Dass auch im zweiten Teil des Gottesdienstes Propriumsgesänge üblich waren (Offertorium und Communio im Umkreis der Abendmahlsfeier), greift Luther hingegen nicht auf.
Also wurde für jeden Propriumstext hinterfragt, welche Funktion er im Gottesdienst übernehmen kann. Ebenso verfuhren die Akteure mit den Ordinariumsteilen und wiesen sie sogar unterschiedlichen gottesdienstlichen Akteuren zu; am zyklischen Zusammenhang waren sie nicht interessiert. Schon Kyrie und Gloria, wenngleich in der Messfeier traditionell nacheinander erklingend, werden den frühesten Regelungen zufolge voneinander getrennt behandelt. In der Deutschen Messe wird ohnehin nur das Kyrie erwähnt, im Teutsch gesang erscheinen beide als Beiträge des Pfarrers. Weitere Einblicke liefert die Wittenberger Kirchenordnung von 1533: Ihr zufolge ist das Gloria nur ein Festtags-, nicht also ein gewöhnlicher Sonntagsgesang.16 Das Credo fällt der Gemeinde zu: als Lied »Wir glauben all an einen Gott«. Für das Sanctus stellt Luther 1523 ebenfalls ein Lied bereit (»Jesaja dem Propheten das geschah«), doch wurde es in Wittenberg offensichtlich nicht gesungen; das Agnus Dei schließlich, mit seinen an das »Lamm Gottes« gerichteten Bitten »erbarme dich unser« und »gib uns deinen Frieden«, erschien als idealer Begleitgesang des Abendmahls.
Aus alten Propriumsteilen und dem so differenziert gewichteten Ordinarium stellten Luther und seine Mitstreiter also Umrisse eines Messablaufs zusammen. Wie wenig Konkretes dabei entstand (im Wechselspiel aus vorgeschlagenen Möglichkeiten und dem Sich-Nicht-Festlegen), lässt sich exemplarisch am Beginn zeigen, dem Introitus, für den sich in jeder Schrift ein anderer Gestaltungsansatz findet.
Eine besonders traditionelle Variante scheint die zu sein, die Luther in der Deutschen Messe entwickelt: »Wir«, so schreibt er, singen »ainen teutschen psalmen«. Gemeint ist kein Lied, denn er fährt fort: »in primo tono auf die weyse wie folget.« Daraufhin findet sich ein langes Notenbeispiel, aus dem hervorgeht, dass hier der gesamte 34. Psalm auf Deutsch gesungen werden soll: »Ich will den Herren loben allezeit, mein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. […]« Dies ist aber keine traditionelle Gottesdienst-Eröffnung: Weder die Melodie noch der Text hat etwas mit einem gregorianischen Introitus zu tun. Vielmehr regt Luther an, den Psalmtext auf eine der typischen Melodien für das »Psalmodieren« zu singen: diejenige im »ersten Ton«, also dem dorischen Modus.
Anstelle des »teutschen psalmen« schlägt Luther als Alternative »ain gaystlich lied« vor. Hierfür aber gibt er kein Beispiel. Dass es ein Gemeindelied war, ist kaum denkbar, denn Luthers Formulierung heißt im Ganzen: »Zum anfang aber singen Wir ain gaystlich lied, oder ainen teutschen psalmen in primo tono, auff die weyse wie folget.« Für beide Varianten ist der Akteur also derselbe: »Wir«. Das Psalmodieren hat eine Gemeinde damals keinesfalls beherrscht, weder textlich noch musikalisch. Luthers Formulierung kann aber auch nicht bedeuten, dass die Gemeinde entweder (aktiv) ein Lied sang oder (passiv) einen Psalmvortrag erlebte, denn dann hätte Luther zwischen »der Priester« und »die gantze kirche« unterschieden – so, wie er es im Folgenden tut. Also ist dieser Gottesdienstanfang aus der Tradition der Messfeier heraus zu verstehen: Ihr zufolge sang zu Beginn die Choralschola (auch wenn an dieser Stelle kein schlichtes Psalmodieren vorgesehen war). Für Luther bestand demnach kein Zweifel, dass irgendeine Sängerformation in Altarnähe den Gottesdienst eröffne. »Zum anfang aber singen Wir …« heißt demnach: »In unseren Wittenberger Gottesdiensten steht am Anfang …« Dieses »Wir« wird immer wieder verwendet; auf die »gantze Kirche« verweist es nie.
In Das Teutsch gesang wird das Thema aus einer anderen Richtung betrachtet. Als Eingangsgesang wird ebenfalls »ein Psalm« vorgeschlagen, aber in Nachdichtung als Strophenlied: »Aus tiefer Not schrei ich zu dir«, Luthers Bearbeitung des 130. Psalms. Die pädagogische Bestimmung des Buches trifft sich also mit der Tradition der Messfeier: Der Schulmeister sollte das Lied anstimmen und seine Schüler so unterrichten, dass sie mitsingen konnten – wiederum in der Nachfolge einer Choralschola. An ein solches Lied wird Luther auch für die Ersatzkonstruktion der Deutschen Messe gedacht haben.
Präziser wird dann 1533 die Wittenberger Kirchenordnung. Hier heißt es: »Vor allem in der Messen soll man erstlich singen das deutsch Benedictus Sacharie mit seiner kurzen antiphon«: Gemeint ist der Lobgesang des Zacharias aus Lukas 1 (der als Wechselgesang »Gesegnet sei Gott, der Herr von Israel« das Zwickauer Gesangbuch von 1525 eröffnet17). Erst danach ist der Introitus an der Reihe, »zu zeiten lateinisch, zu zeiten deutsch, welches soll sein ein deutscher psalm.« Also ging es hier entweder um einen unveränderten Psalmtext (wie in der Deutschen Messe) oder um eine Nachdichtung (wie in Das Teutsch gesang), nicht aber um ein beliebiges Kirchenlied; ausdrücklich wird dem Schulmeister in einem eigenen Abschnitt aufgegeben, er solle nur Gesänge gebrauchen, »so rein aus der heiligen schrift genomen sein«.18
Was also nimmt der »geneigte Leser« aus diesen Informationen mit? Teils setzt sich fort, dass Luther 1523 an den Gesängen der alten Messe festzuhalten empfahl. Keines der erkennbaren Konzepte rückt von der Tradition eines Introitus ab; Psalmtexte stehen im Zentrum, und die Gemeinde hört nur zu. Andernteils wurde kein absoluter Regelungsbedarf gesehen; Gottesdienst mag zwar Ausdruck des Glaubens sein, ist aber kein Selbstzweck. Welche Texte und Melodien verwendet werden, ist insofern nicht ausschlaggebend.
Bis hin zur Predigt wird die lutherische Messfeier weitgehend von jenen mittelalterlichen Traditionen geprägt: von dem Abwechseln einer Sängergruppe, die die Ordinariums- und Propriumsteile in den Gottesdienst einbringt, mit den Beiträgen des Priesters, der sämtliche Lesungen und Gebete ebenfalls singt. Für dessen Sprechgesang stellt Luther in der Deutschen Messe ein melodisches Baukastensystem bereit; je nach Satzzeichen und Sinneinheiten soll der Textvortrag einen plausiblen Bogen umschreiben. Noch mehr Melodieelemente entwickelt er für das Evangelium; denn in dessen Texten sollen die Erzählebene, die Wortbeiträge Jesu und die Kommentare anderer Personen musikalisch voneinander unterschieden werden. Das Gesamtresultat daraus überrascht, denn »gesprochenes Wort« kam auf diese Weise im Gottesdienst nur an einer einzigen Stelle vor: in der Predigt. In ihrem Sprachklang wurde sie also viel stärker als in späterer Zeit aus dem übrigen Gottesdienst herausgehoben: als etwas Einmaliges, Unmittelbares.
Doch wie man die Dinge auch dreht und wendet, an keiner Stelle kommt ein vielfältiger »lutherischer Liedgesang der Gemeinde« zum Vorschein. Luther verfolgte offensichtlich fundamental andere Ziele. Bisweilen werden Lieder als Ersatz für die alten lateinischen Propriumsgesänge vorgeschlagen, dann aber (wie im Introitus) einer Sängergruppe zugewiesen. Und wenn die Gemeinde dennoch Anteile am Singen hat, dann sehen diese anders aus als in späteren Zeiten.
Gesungene Lesung · Luthers Melodien-Bausteine für die Lesung der Epistel, die er direkt aus der Messpraxis des Spätmittelalters übernommen hat. Man startet mit der Tonfolge des »Initiums«, schließt mit dem »Finale« und hat für die Binnengliederung weitere Formeln zur Verfügung, besonders auch für die Frage, »Questio«.
Martin Luther, Deutsche Messe, 1526.
Ein erstes Mal wirkt sie an der Sequenz mit, also an einem der Propriumsgesänge zwischen den beiden Lesungen. Sequenzen sind lateinische Strophendichtungen des Mittelalters, und laut den Wittenberger Bestimmungen von 153319 wurden drei von ihnen in die lutherische Messe übernommen, je eine für die Zeit zwischen Weihnachten und der Fastenzeit (»Grates nunc omnes«), zwischen Ostern und Christi Himmelfahrt (»Victimae paschali laudes«) sowie für Pfingsten (»Veni Sancte Spiritus«). Zwischen die lateinischen Strophen durften die »Laien« schon in vorreformatorischer Zeit Antwortgesänge einschieben. In lutherische Praxis übertragen, wurde also je nach Jahreszeit eines von drei traditionellen Sequenzliedern gesungen, in deren Texten das lateinische Original in freier Übersetzung wiedergegeben ist: in den Wochen nach Weihnachten »Gelobet seist du, Jesu Christ«, zwischen Ostern und Himmelfahrt »Christ ist erstanden«, zu Pfingsten »Nun bitten wir den heiligen Geist«. Alle drei gehören einer eigenen Liedgattung an: Jede Strophe schließt mit dem Ruf »Kyrieleis« (»Herr, erbarme dich«); ihm verdankt diese Liedgruppe den Namen »Leis« oder »Leise«.
Ein zweites Mal singen durfte die Gemeinde dann nach der gesungenen Evangelienlesung, an der Stelle des traditionellen Credo. Die ausführlichste Darstellung für dessen Gestaltung findet sich erneut in der Wittenberger Kirchenordnung: Der Priester singt als Einleitung »Credo in unum Deum« lateinisch, daraufhin setzen die Schüler mit dem Text »Patrem omnipotentem …« fort und singen »alsdan mit dem volk wir gleuben alle an einen gott«. Dies ließ sich abkürzen: Dann stimmte der Schulmeister nach der Evangelienlesung gleich das Lied an, und Schüler und Gemeinde traten hinzu.
Das Bild setzt sich nach der Predigt fort. Das Vaterunser wird gesungen (laut Deutscher Messe trägt der Pfarrer hingegen eine erklärende Paraphrase vor). Für die Einsetzungsworte zum Abendmahl ist Priestergesang wiederum unbedingte Vorschrift. Und während der Austeilung von Brot und Wein werden erneut Lieder gesungen – von wem, lässt sich zumindest anhand der Wittenberger Kirchenordnung klären:20
Weil [= dieweil, während] das volk communicirt, singt man sanctus; agnus dei; Jesus Christus unser heiland; gott sei gelobt; das deutsch confitebor tibi; pange lingua lateinisch und dergleichen, auch deutsche gesenge vom feste etc. bis die communion aus ist.
Oder anders: Das Volk ist mit dem Abendmahl (»Kommunion«) beschäftigt und soll sich auf dessen geistliche Bedeutung konzentrieren; für ein Singen ist dabei kein Platz. Lieder und andere Gesänge (vor allem, wenn sie einen lateinischen Text haben) trugen demnach andere vor, also erneut die Schüler (für die noch sehr viel später Sonderregeln galten, wie sie trotzdem am Abendmahl teilnehmen könnten21). Kommentarlos entfällt nach der Predigt das vorreformatorische Offertorium, und nur im Teutsch gesang wird auf den einstigen Abschluss des Propriums ausdrücklich Bezug genommen, die Communio (und zwar mit einem Lied: »Es woll uns Gott genädig sein«). Warum die lutherische Praxis gegenüber diesen alten Propriumsteilen auf Abstand geht, wird nicht erklärt; die zweite Hälfte der Messfeier jedenfalls erhielt ein neues, lutherisches Aussehen, indem die Musikanteile auf die Gesänge zum Abendmahl konzentriert werden. Dass sich hier die reformatorischen Debatten um die Bedeutung des Abendmahls auswirkten, liegt nahe und lässt sich – später – in anderem Zusammenhang bestätigen.
Nach dem Abendmahl folgt noch der deutsche Messgesang »Christe, du Lamm Gottes«, und zwar auch dann, wenn ein lateinisches Agnus Dei während der Austeilung gesungen wurde. Für die Bezeichnung der Ausführenden findet sich erneut das fatale »wir« oder »man«, das aber im Gesamtkontext nie für »das Volk« benutzt wird. Einem Dankgebet schließt sich der Segen an, und danach fällt der Gemeinde noch einmal eine aktive Rolle zu: Sie antwortet mit »Amen«.
So scheint es, dass die Gemeinde nur marginal am Gottesdienst beteiligt war. Das aber ist eine rückblickende Sicht; allzu leicht lässt sich unterschätzen, wie viel Gemeindeorientierung in volkssprachigen Lesungen, der Austeilung des Abendmahls in beiderlei Gestalt (mit Brot und Wein) und dem als Lied gesungenen Glaubensbekenntnis lag. Indem Luther dieses aus dem Messordinarium herauslöste und als gesungenes Credo zur Individualäußerung der Gläubigen erklärte, veränderte sich der Charakter des Gottesdienstes fundamental.
Ein Gemeindelied war bei alledem also nicht intendiert. Eine Neuerung war ja schon, dass das Volk überhaupt etwas singen durfte; 100 Jahre zuvor, beim Konstanzer Konzil (1414–1418), war dies noch ausdrücklich verboten worden,22 offenkundig weil der Gesang der Messfeier durch außergottesdienstliches Singen (wie bei Prozessionen) unter Druck geraten war. Die Leisen-Praxis als solche war hingegen nicht neu; Luther baute sie lediglich aus, indem er zu den ursprünglich einstrophigen Gesängen »Gelobet seist du, Jesu Christ« und »Nun bitten wir den Heiligen Geist« weitere Strophen hinzudichtete. Und das als Lied individualisierte Glaubensbekenntnis folgte einer eigenen theologischen Logik. Das Ziel eines prinzipiellen Liedersingens zeichnet sich also nicht einmal in Ansätzen ab. Wie also lässt sich stattdessen die Rolle der Gemeinde charakterisieren: Sie sang volkssprachige Liturgie-Anteile, die in jedem Gottesdienst vorkamen. Das gilt für das Glaubenslied ohnehin, ebenso auch für die Sequenz-Einlagen, die über mehrere Wochen hinweg gleich blieben. Wechselnde Lieder zu singen war Aufgabe der Schüler.
Es war also nicht abzusehen, ob und in welcher Richtung sich eine singende Gemeinde jemals auf Kosten professioneller Sänger emanzipieren würde; denn rein entwicklungsgeschichtlich betrachtet, mussten hierfür Teile des alten Propriums an die Gemeinde überwiesen werden. Viel eher also wurde die alte Messfeier nur insofern »reformiert«, als das nicht länger Gewünschte ausgeschieden wurde. Alles andere konnte bleiben, wie es war.
Missverständnisse hinsichtlich eines schon »lutherischen« Gemeindeliedes entstanden also vor allem durch Fehllesungen. Hinweise des 16. Jahrhunderts darauf, dass Schüler im Gottesdienst sangen, lassen sich nie so verstehen, dass damit ein ohnehin vorhandener Gesang der Gemeinde gestützt wurde; wo keine Gemeinde erwähnt ist, sondern nur die Schüler oder der Schulmeister, sangen allein diese. Sicher: Es lässt sich nicht ausschließen, dass auch normale Kirchgänger einmal in ein Lied einstimmten, wenn sie es kannten. Doch bis sich die Rollenverteilung umkehrte (sozusagen von einem Schülerlied zu einem Gemeindelied), dauerte es lang. Noch 1604 in Hamburg wird jenes Mitsingen Einzelner als bloße Option benannt: dass in vierstimmigen Schüler-Liedsätzen »den Discant auch ein jeder Christ ... gleich mit Musiciern« könne.23 Noch dabei war das Mitsingen kein Regelfall.