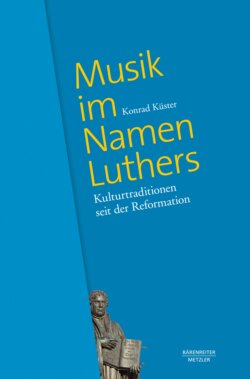Читать книгу Musik im Namen Luthers - Konrad Küster - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Orgelspiel in der Messe
ОглавлениеLaut Musculus’ Reisebericht gehörte in Eisenach das Solospiel der Orgel zur Normalität – auch an einem gewöhnlichen Sonntag. Noten, die einen Eindruck von diesen Klängen vermitteln könnten, liegen für genau die Stellen, die er benennt, nicht vor; aber auch sonst ist die Überlieferung extrem spärlich. Obendrein bricht noch ein weiteres Problem auf: Für manche Gottesdienstabschnitte, für die aus jener Zeit Orgelmusik vorliegt, gibt es auch mehrstimmige Vokalmusik. Handelte es sich also um eine Alternative: entweder Chor oder Orgel? Und wie klang Orgelmusik lutherischer Gottesdienste vor 1550?
Dass es keine »lutherische« Orgelmusik aus jener Zeit gibt, ist nicht unbedingt problematisch; denn auch die Ensemblemusik, die sich in Rhaus Drucken für die Messfeier findet, verweist eher auf die Tradition, aus der die Reformation selbst erwuchs. Eine Vorstellung, wie in derselben konfessionellen Ambivalenz Orgelmusik aussah, kann eine umfangreiche Sammlung geben: die Orgeltabulatur des Jan z Lublina (Johannes von Lublin). Er wirkte als (katholischer) Kanoniker in Kraśnik, 50 Kilometer südwestlich von Lublin, das im 16. Jahrhundert zum Zentrum der polnischen Adelsreformation wurde. Die datierten Eintragungen der Sammlung stammen aus den Jahren 1537 bis 1548, also aus einem Ambiente, das demjenigen der Sammlungen Rhaus zumindest äußerst ähnlich war.
Bei Johannes von Lublin finden sich Orgelbeiträge zu Teilen des Ordinariums, ferner ganz gezielt Musik zum Introitus und zur Sequenz. Das entspricht dem, was man aus deutschen lutherischen Quellen der Zeit erfährt. Musculus berichtet für Eisenach, dass dem gesungenen Introitus Orgelspiel vorausging, gleichsam als Verbindung aus Gottesdiensteröffnung und einer Intonation, die für die Sängergruppe die Tonhöhe sicherstellte. Das Resultat mag ähnlich gewesen sein wie die Introitusstücke aus Kraśnik. Sie richten sich auf dreizehn Feste des Kirchenjahrs aus; den Traditionen des mittelalterlichen Orgelspiels entsprechend, mögen dies die Tage gewesen sein, zu denen dort überhaupt die Orgel erklingen sollte. Denn Orgelmusik war eine Zierde der größten Feste.41
Das, was Johannes von Lublin im Hinblick auf die Sequenz erkennen lässt, ist ebenso teils der spätmittelalterlichen Praxis verpflichtet, teils der frühlutherischen verwandt, und zwar im Falle der achtstrophigen Ostersequenz »Victimae paschali laudes«. Für vier der Strophen enthält das Manuskript Musik, mit den lateinischen Textanfängen überschrieben: für jede mit ungerader Zahl nummerierte. Folglich wurden die geradzahligen Strophen (2, 4, 6 und 8) als gregorianischer Choral vorgetragen und jeweils von der Orgel vorbereitet. Auch dies findet sich in der lutherischen Sequenzpraxis; laut der Mecklenburgischen Kirchenordnung von 1535/40 fielen damals der Orgel in der Ostersequenz genau diese Strophen zu.42 Dort ist zudem haarklein beschrieben, was zwischen deren Beiträgen geschah: Nach der Orgelintonation sollte der Schulmeister jeweils zwei Strophen der Sequenz im originalen Latein vortragen, beginnend mit derjenigen, auf die sich der vorausgegangene Orgelbeitrag bezog; seinem Strophenpaar folgte dann die Gemeinde mit einer Einzelstrophe des deutschen Sequenzliedes, zu Ostern also »Christ ist erstanden«.
Während hier die mecklenburgische Praxis und die aus Kraśnik perfekt zusammenpassen, wirkt schon fraglicher, ob sich das Beobachtete auch auf Musculus’ Eisenacher Erlebnisse übertragen lässt: Dass zuerst die Orgel spielte, wirkt unproblematisch; doch dann wechselten Chor (lateinisch) und Gemeinde (deutsch) miteinander ab, beide angeleitet von dem für Musik verantwortlichen Lehrer. War also kein Platz für weitere Orgelanteile? Umgekehrt war in Mecklenburg der Schülergesang verzichtbar; dort sang allein der Schulmeister. Und indem er sogar die Strophen, die der Organist spielte, noch einmal vortrug, garantierte er, dass der komplette Text im Gottesdienst vorkam – trotz Orgel.
Wichtig ist diese Beobachtung auch im Hinblick auf die Musiksammlungen Rhaus. Denn dieser stellt für genau die Strophen der Ostersequenz eine mehrstimmige Version bereit, für die auch jene Orgelbeiträge in Betracht kamen. Wie sich Orgelmusik und Figuralmusik zueinander verhalten sollten, ist offensichtlich nirgends dokumentiert worden. Denkbar ist, dass sich beide Formen ausschlossen, ebenso aber, dass das Ensemble einen Teil der mecklenburgischen Schulmeister-Rolle übernahm. Dann hätte erst die Orgel eine Strophe gespielt, der Chor diese mit Text wiederholt. Anschließend wäre die jeweils nächste lateinische Strophe einstimmig vorgetragen worden – vom örtlichen »Schulmeister« (oder Rektor oder Kantor), vermutlich unter Beteiligung der zugehörigen Schülergruppe. Jeweils zum Schluss wäre die deutsche Liedstrophe der Gemeinde an der Reihe gewesen, zweifellos wiederum mit einer klanglichen Führung durch Schulmeister und Schüler.
Wiederum steht man also vor einer Nebelwand. Eines jedoch tritt aus ihr unzweifelhaft hervor: In einigen lutherischen Regionen war der Gottesdienst zwischen den beiden Lesungen musikalisch außerordentlich reich. Je mehr Sequenzstrophen in zwei Sprachen oder in unterschiedlichen Besetzungen vorgetragen wurden, desto ausladender wurde diese Konstruktion, und zwar in jedem Gottesdienst der relevanten Jahreszeit exakt gleich. Nur der Organist, der seine Musik zweifellos improvisierte, konnte in jedem Gottesdienst etwas anderes spielen. Leicht dehnte sich dieser Abschnitt also auf zehn Minuten Aufführungsdauer aus, anders als die übrigen, nur wenige Minuten dauernden liturgischen Gesänge. Und wenn (wie ursprünglich auch in Wittenberg vorgesehen) der Sequenz noch Graduale und Alleluja vorausgingen, ergab sich etwas sehr Attraktives: Denn diese beiden wechselten von einem Gottesdienst zum anderen, während die nachfolgende Sequenz jeweils über Wochen hinweg dieselbe blieb; Wechsel und Konstanz standen also nebeneinander. Dieses zentrale liturgische Segment kam dem Luthertum binnen weniger Jahrzehnte abhanden; sein Erbe an gleicher Stelle trat erst die Motette an, später die Kirchenkantate.
Die Tabulatur des Jan z Lublina enthält zudem Hymnen (wie sie auch im Lutherischen gesungen wurden) und weitere Sequenzen (auch für Feste, von denen das Luthertum abrückte, etwa den 6. November als Leonhardstag); doch für weitere Orgelanteile, die für Musculus’ Eisenacher Aufenthalt belegbar sind, fehlen auch in dieser Quelle Anhaltspunkte. Orgelmusik für ein (zumal lutherisches) Gloria ist erst deutlich später nachweisbar.43 Und zudem spielten der Eisenacher und der Wittenberger Organist irgendetwas jeweils vor den Liedern der Schüler. An welche Art Liedvorspiel lässt sich hier aber denken?
Der älteste erhaltene lutherische Orgelchoral · Von »P. R.«, dem als Paul Rußmann identifizierbaren Organisten der Hamburger Petrikirche (gestorben 1560), stammt diese Bearbeitung von »Allein zu dir, Herr Jesu Christ«. Die Musik ist in Tabulaturschrift aufgezeichnet: mit Tonbuchstaben, über denen die jeweiligen Notenwerte angegeben werden.
Fragment der Tabulatur aus Lüdingworth (Cuxhaven), um 1580.
Antworten sind für die frühe nachreformatorische Zeit an nur zwei Orten möglich, und nur in einem Fall lässt sich das Prädikat »lutherisch« ohne Bedenken verwenden: für »Allein tho di, Her Jesu Christ«, komponiert offensichtlich von Paul Rußmann, der bis zu seinem Tod 1560 Organist an St. Petri in Hamburg gewesen war.44 Um 1580 aufgezeichnet und in der Dorfkirche von Lüdingworth bei Cuxhaven als Fragment überliefert, sind die künstlerischen Grundzüge des Stückes immerhin klar erkennbar. Die Melodie steht im Vordergrund, mit typischen tastenmusikalischen Spielfiguren der Zeit angereichert; mit solchen werden auch die Zäsuren zwischen den einzelnen Liedzeilen überbrückt. Das andere Werk, für das eine »lutherische« Beziehung aber kaum angenommen werden kann, stammt erneut aus einer konfessionellen Umbruchsituation. In der Orgeltabulatur des Pforzheimer Mönchs Leonhard Kleber, die 1524 abgeschlossen wurde, ist eine Komposition mit »Kum hayliger gaist« überschrieben, die auf den (auch im frühen Luthertum präsenten) Pfingstgesang verweist. Doch dieses dreistimmige Werk, das im Ganzen weitere Bögen schlägt als die Hamburger Komposition, stammt vermutlich aus einem anderen Kontext. Das Lied wurde schon im 15. Jahrhundert als Antiphon zum Magnificat gesungen.45 also in der Vesper. Um ein Choralvorspiel handelt es sich kaum, sondern eher um eine solistische Liedstrophe. Insofern ist das Fragment von Rußmanns Choralbearbeitung vermutlich das einzige Stück, das der Eisenacher und Wittenberger Vorspielpraxis nahesteht: mit einem herben, attraktiven Klangeindruck.