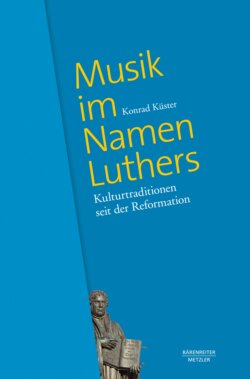Читать книгу Musik im Namen Luthers - Konrad Küster - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Musik und Ewigkeit
ОглавлениеDas Luthertum hatte jedoch noch ein anderes Eisen im Feuer: eine Argumentationslinie, die es von spätmittelalterlichen Humanisten geerbt hatte. Sie steht völlig isoliert neben den Diskussionen um die Adiaphora. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die »humanistische« Überlegung gab es, lange bevor die Adiaphora-Debatte ansetzte; es hätte eines eigenen Anstoßes bedurft, beide aneinander zu koppeln. So entwickelten sie sich getrennt voneinander weiter. Worum also ging es?
Essenziell für das Denken der Reformation ist die Rechtfertigungslehre. Die um sie kreisenden Fragen bildeten einen Kern im Streit um den Ablasshandel. Sicher: Es ging bei diesem auch um persönliche Bereicherung und um das Recht des Papstes, im abendländischen Christentum eine Sondersteuer zum Bau des Petersdoms zu erheben – womit der Konflikt mit den ebenso auf Repräsentation und Alleinstellungsmerkmale bedachten Fürsten vorprogrammiert war. Doch die eigentliche Begründung des kirchlichen Vorgehens erreichte jeden einzelnen Menschen in seinem Innersten: als Angst vor dem Jenseits, zunächst vor dem Fegefeuer als Zwischenstadium auf dem Weg zum Jüngsten Gericht, noch mehr und noch undifferenzierter vor der Hölle, die auf die völlig Missratenen am Ende und für alle Ewigkeit warte. Dies machte die Menschen verwundbar: mit ihrem individuellen schlechten Gewissen im Alltag und der Sorge, ob ein ethisch zweifelhaftes Handeln denn überhaupt zu sühnen sei. Die Aussicht, etwas vergleichsweise Preiswertes tun zu können, um die Folgen zu lindern, war zwar attraktiv; doch wer konnte sicher sein, dass die temporäre Gewissensentlastung in alle Ewigkeit fruchtete? Reichten die guten Werke des Diesseits aus? Wer also einmal angefangen hatte, einen Entlastungsversuch vorzunehmen, befand sich fortan in der endlosen Spirale einer materiellen Entschuldung des emotional Unentschuldbaren.
Die Rechtfertigungslehre geht genau von diesem Bewusstseinsaspekt aus: Letztlich lasse sich das schlechte Gewissen nicht beseitigen, weil eben »die Sünde« als nicht ausrottbar gelten müsse; sie gehöre zur menschlichen Disposition. Dies könnte Anlass für einen radikalen Pessimismus sein, gäbe es da nicht die Kernsätze vor allem des Glaubensbekenntnisses: »[Ich glaube an die] Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.« Davon, dass man sich dies alles mit irdisch Messbarem erkaufen müsse, ist keine Rede. Deshalb lässt sich die Grundlage des Erlösungsgedankens auf eine verhältnismäßig knappe Formel bringen.
Der Bibel zufolge existiert Sünde seit dem Sündenfall; mit ihm entstand zugleich »der zornige Gott« des Alten Testaments, der seinem eigentlich »auserwählten« Volk fortan nicht nur mit Fürsorge entgegentrat, sondern zugleich mit Drohungen, schweren Prüfungen und Strafen. Doch die sündige Menschheit besserte sich nicht. So sandte Gott seinen Sohn in die Welt: um durch dessen Tod die Welt zu retten und um mit dieser Aufopferung, der dann noch Auferstehung und Himmelfahrt folgten, ein konkretes Glaubensvorbild zu schaffen. Schließlich sollte der Heilige Geist den »neuen Bund« zwischen Gott und Menschen dauerhaft sicherstellen: mit seiner Ausgießung über die Welt zu Pfingsten.
Doch dieses Konzept war kein Automatismus: Die Gläubigen hatten nur dann die Aussicht auf Erlösung, wenn sie aktiv Glauben praktizierten; die Rechtfertigung aus Gnade ist kein Freibrief, sondern bringt zugleich diese Verpflichtung mit sich, die im Glaubensbekenntnis benannt ist: an die Vergebung der Sünden zu glauben. Das klingt theoretisch, kaum messbar; doch in der Realität sehen die Dinge viel handfester aus. Dafür, wie Glaube ideal praktiziert wird, benennt Luther ein neutestamentliches Vorbild: Maria. Wie er 1521 in seiner Auslegung des Magnificat hervorhebt, lobe sie Gott allein für seine Güte, nicht für den Wert seiner Werke (wie es unter Christen üblich sei), und sie räsoniere nicht über das Evangelium, sondern folge ihm unmittelbar.8 Dieses Einfältige mache sie zur idealen Christin – eine Vorstellung übrigens, die auch erklärt, weshalb im Luthertum Marienfeste weiterlebten.
In diesem Sinn zwingt die erlösende Gnade des dreieinigen Gottes zu uneingeschränkter Dankbarkeit und zu ewigem Lobpreis – nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern auch mit einem eigenen Verkündigungszweck gegenüber anderen. Lobpreis aber ist Musik, und sie schafft eine direkte Verbindung zum ewigen Himmel. Auch in ihm wird das Lob Gottes gesungen, und zwar noch über den Weltuntergang hinaus. Denn wenn Gott ewig sei, gelte ebenso die Verpflichtung ewig, ihn zu loben. Damit ist die ewige Seligkeit letztlich vor allem eines: Musik. Sie also wird Teil der lutherischen Heilsauffassung, und so wurde sie 1740 in der Kirche von Møgeltønder, wenige Kilometer nördlich der deutsch-dänischen Grenze, auf vier großformatigen Deckengemälden dargestellt: Dem Sündenfall im Frieden des Paradieses folgt der Kreuzestod Christi; beim Jüngsten Gericht trennen sich die Wege der Gläubigen von denen der Ungläubigen. Der Himmel, in dem die Engel »Soli Deo Gloria« singen, wölbt sich über der Orgel.9
Nur Musik ist damit ein Teil der Ewigkeit, anders als alle anderen Künste. Denn aus Sicht der Bibel wird im Zuge des Jüngsten Gerichts die Babylonische Sprachverwirrung überwunden; Grammatik, Rhetorik und Dialektik (bzw. Logik), die drei grundlegenden, »trivialen« Freien Künste, sind im Angesicht Gottes nicht mehr nötig. Die drei Partner-Künste der Musik im fortgeschrittenen Quadrivium (Arithmetik, Geometrie, Astronomie) verlieren mit dem Weltuntergang ihre Bedeutung. Und die beiden so grundlegenden Wissenschaftszweige neben der Theologie (die im Himmel nicht mehr notwendig ist) sind gleichfalls überflüssig geworden: Jura (im Kontext eines ewigen Friedens) und Medizin (in einem Paradies mit ewiger Gesundheit).10 Nur die Musik hat auch in der Ewigkeit einen Sinn.
Teile dieses Denkens wurzeln sicherlich schon in vorreformatorischer Zeit. Denn der 89. Psalm, in dem dieses ewige Musizieren angesprochen wird, gehört auch zur katholischen Begräbnisliturgie:11 »Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich«, heißt es dort in Vers 2. Tatsächlich also »ewiglich«. Und der Text setzt sich fort (Vers 6): »Und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Wahrheit in der Gemeinde der Heiligen.«
Luthers musikalischer Berater Johann Walter führte dies in seinem Gedicht Lob und preis der löblichen Kunst Musica von 1538 so zusammen:
Die Music mit Gott ewig bleibt
Die andern künst sie all vertreibt,
Im Himel nach dem Jüngsten tag,
Wird sie erst gehn in rechter wag,
Jtzt hat man hülsen nür darvon
Dort wird der kern recht auffgethan,
Im himel gar man nicht bedarff
Der kunst Grammatic[,] Logic scharff,
Geometrj, Astronomey,
Kein medicin, juristerey,
Philosophey, Rethorica
Allein die schöne Musica,
Do werdens all Cantores sein
Gebrauchen dieser kunst allein,
Sie werden all mit rhum und preis
Gott loben hoch mit gantzem fleis,
Und dancken seiner grossen gnad
Die er durch Christ erzeiget hat,
Sie singen all ein liedlein neu,
Von Gottes lieb und hocher [= hoher] treu,
Solchs singen ewig nicht vergeht
Wie in Apocalipsi steht,
Gott helff uns allen auch dohin das wir bey
Gott in einem sinn,
Und allen auserwählten gleich
Singen mit freud in Gottes reich.12
Diese Vorstellung hat das Luthertum fundamental geprägt; sie findet sich immer wieder in neuen Zusammenhängen, etwa auch in Philipp Nicolais Lied »Wachet auf, ruft uns die Stimme« (1599):13 »Gloria sey dir gesungen«, beginnt die Schlussstrophe; dieser Lobgesang in der Stadt Gottes, dem himmlischen Jerusalem, erfolgt gemeinsam »mit Menschen und Engelischen Zungen«, zugleich »mit Harpffen und mit Cymbeln schön«, also Instrumenten. Die Situation in dem ewigen »dulci jubilo«, also dem endlosen, süßen Jubelgesang, ist unvorstellbar schön: »Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört, solche Freude.«
Mit dieser Sichtweise hatte die Musik unter allen anderen »Adiaphora« eine luxuriöse Position inne: Letztlich war sie eben doch mehr als nur eine neutrale Facette des christlichen Daseins, weil sie als unmittelbares Glaubenszeugnis untrennbar zur Rechtfertigung und – in der nächsten Stufe – zur Ewigkeit gehöre. Und nachdem der Versuch gescheitert war, zwischen Lutheranern und Calvinisten eine Einigung über den Instrumentengebrauch in der Kirche zu erreichen, wurde der Zankapfel zum lutherischen Erkennungsmerkmal: für eine Kirchenmusik, die neben dem Singen auch »Harpffen und Cymbeln schön« einsetzt.
Offen bleibt bei alledem, welche Rolle die Instrumente in der frühen lutherischen Kirchenmusik denn überhaupt spielten. Belege für ihre Mitwirkung gibt es kaum, und nur verstreute Hinweise aus dem mittleren 16. Jahrhundert deuten auf ein Mitspielen gesungener Parts hin.14 Und dennoch sind, wie zu Beginn des 1. Kapitels angesprochen, zeitgenössische sakrale Bilddarstellungen voller Instrumentalisten. Ein extremes Beispiel stammt erneut aus Dänemark; es findet sich in Rynkeby, einem Dorf an der Ostseite der Insel Fünen.15 Der örtliche Gutsherr, Erik Hardenberg, hatte längere Zeit in Wittenberg als Hausgenosse Melanchthons gelebt, übernahm 1565 die Besitzungen seiner Familie und stattete daraufhin die Nordkapelle seiner Patronatskirche mit einem imposanten »Himmel voller Musik« aus, der für die Instrumentenkunde eine wahre Fundgrube ist. Nicht nur Orgeln oder die gewöhnlicheren Streich- und Blasinstrumente werden in diesem Himmel gespielt, sondern auch Drehleier, Dudelsack und Hackbrett. Für die Verbindung aus Himmel und Instrumenten ist Rynkeby somit ein ideales Beispiel – noch vor dem Mömpelgarder Religionsgespräch. Und doch ist nicht erkennbar, welchem irdischen Kirchenmusik Erleben diese Himmelsvorstellung entsprungen sein könnte.
Für die folgenden Jahrzehnte erscheint dann mit den Gedanken, die Walter in seinem Gedicht äußert, ein theologischer Rahmen abgesteckt, und zwar im gesamten lutherischen Raum. Besondere Schubkraft erhielten sie im Umkreis des Reformtheologen Johann Arndt im frühen 17. Jahrhundert (Vier Bücher vom wahren Christentum 1605/10; Paradiesgärtlein voller christlicher Tugenden, 1612), der vor allem in Braunschweig und Celle wirkte; in seiner Nachfolge entwarf Christoph Frick, Superintendent in Burgdorf bei Celle (und später in Bardowick nördlich von Lüneburg), sein 1631 erschienenes Music-Büchlein – mit dem Untertitel Nützlicher Bericht Von dem Uhrsprunge, Gebrauche und Erhaltung Christlicher Music Und also Von dem Lobe Gottes. Das lässt sich wörtlich nehmen: Frick schrieb eine Musikgeschichte erst aus biblischer Sicht, der dann ein erstaunlich kundiger Schnelldurchgang durch die Entwicklungen des Mittelalters folgt (Frick kann sogar mit Namen wie Dunstable, Guillaume Dufay und Gilles Binchois etwas anfangen) – »biß endlich Josquinus [= Josquin], Fincius [= Heinrich Finck], Senfel [= Ludwig Senfl], Orlandus [= Orlando di Lasso], Stoltzerus [= Thomas Stoltzer] &c. und andere, die Kunst des Figural-Gesanges auffs aller herrligste, wie wir dieselbe jetzo GOtt lob sagen, an Tag bracht haben«.16 Und daran schließt Frick eine Rechtfertigung der Musik im Luthertum an.17
Ein Himmel voller Musik · Rechts der triumphierende Christus auf dem Regenbogen, der die Erlösten und Engel »dirigiert«. In den übrigen Feldern dieser Deckenmalerei sind Engel mit Instrumenten zu sehen: in der linken Gewölbekappe innen von oben nach unten ein Dudelsack, ein Virginal und eine kreisrund gewundene Trompete (oder ein Horn), außen eine »Nyckelharpa«, eine Orgel und vermutlich ein Scheitholt in seiner skandinavischen Variante als »Langspil«.
Rynkeby (Fünen, Dänemark): Grabkapelle der Familie Hardenberg, Nord- und Ostkappe des Gewölbes, nach 1565 – wohl unvollendet, denn die Schrifttafeln sind frei geblieben.
Fricks umfangreiches Buch lässt kaum mehr erkennen, dass es aus einer Predigt hervorgegangen ist (gehalten hatte er sie 1615). Ohnehin legten Predigten dann, wenn sie im Druck erschienen, ihren Tagesbezug ab und traten in den allgemeinen theologischen Diskurs ein. Wer sie zitierte, machte keine Fehler, konnte aber stets auch versuchen, die angelegten Argumentationslinien noch ein bisschen weiter zu fassen als die Vorgänger. Beim Zitieren wiederum waren Autoren nicht zimperlich, denn nicht selten wurden die Formulierungen nur recycelt; Quellenangaben beziehen sich auf Bibelstellen, kaum je auf die Urheber der Textsegmente. Und so wuchs ein differenzierter, reichhaltiger Wissenspool an.
Die zentralen Predigtanlässe dafür, die musiktheologischen Positionen fortzuentwickeln, waren auf der einen Seite – wie schon für Frick – Einweihungen neu errichteter Orgeln.18 Eine Schlüsselstellung hat dabei Conrad Dieterichs Ulmische Orgel Predigt (1624). Orgel-Neubauten waren auch damals äußerst kostspielig, und so verband sich mit ihnen stets der sensibelste Punkt des gottesdienstlichen Instrumentengebrauchs: Lohnt der Aufwand? Neben diese lokalen, momentanen theologischen Rechtfertigungen der Orgel traten zahllose Begräbnispredigten, denn Sterben und Tod warfen in jedem Fall die Frage nach der Ewigkeit auf, also in dieser auch nach der Musik.
Ein Schwerpunkt der Predigttätigkeit auf beiden Feldern ergab sich nach 1650 im Land Hadeln, am Südufer der Elbe in deren Mündungsbereich gelegen. Kaum einer der aktiveren Pastoren der Gegend ließ es sich nehmen, eine musikalisch relevante Stellungnahme ab- und in Druck zu geben. Den Anfang machte Joseph Pipping in Altenbruch: 1653 pries er beim Begräbnis des Dorfschulmeisters die Himmelsmusik.19 Sachkundig sowohl im Theologischen wie im Musikalischen argumentierend, zog er zur Veranschaulichung zeitgenössische Musikstücke heran. Damit wird das musiktheologische Denken für die Gemeinde geradezu ideal nachvollziehbar.
Drei Zugänge waren ihm wichtig: die textlichen und die musikalischen Gattungen sowie die praktische Funktion im Erlösungskonzept. Für jeden dieser Bereiche definierte er erneut drei Typen: Für die Texte ging es ihm um Altes und Neues Testament sowie um das Kirchenlied; die musikalischen Gattungen, die er voneinander absetzte, sind vielstimmige Tutti-Ensemblemusik, solistisch-dialogische Kompositionen und die Liedbearbeitungen, wie sie von Schülern einer lokalen Schule gesungen wurden. Und das Praktische zielt ab auf das Begräbnis, die Rechtfertigung und das ewige Musizieren. Neun Themen also, für die ihm aber drei Beispielstücke ausreichten; offensichtlich konnte er souverän in einem lokalen Repertoire navigieren, das obendrein genügend Mitgliedern der Trauergemeinde vertraut war.
Das erste Stück ist »Wie bin ich doch so herzlich froh« von Heinrich Grimm aus Braunschweig: eine Kirchenliedstrophe für zwei Soprane und Continuo, typisch für das Schülerrepertoire der Zeit, zudem ein Werk, das am Ort vielfach als Begräbnismusik gesungen wurde.20 Die zweite Komposition hat einen neutestamentlichen Text und ist ein modernes, geringstimmiges Concerto: von Thomas Selle aus Hamburg die dialogische Aufbereitung des Gleichnisses vom reichen Mann, der für seinen irdischen Lebenswandel Höllenqualen erleidet, und dem einst armen Lazarus, der nun in Abrahams Schoß sitzt. Dieses Stück steht für den Rechtfertigungsgedanken und das Himmel-Hölle-Problem. Dem dritten Werk schließlich liegt ein Text aus dem Alten Testament zugrunde; es ist eine große Ensemblekomposition von Andreas Hammerschmidt über den 34. Psalm, der, mit den Worten »Ich will den Herren loben allezeit« beginnend, ideal auf die ewige Himmelsmusik verweist. Und der Theologe Pipping verfügte auch über differenzierte musikalische Kenntnisse; den Text des Hammerschmidt-Stückes gibt er in einer Formulierung wieder, die nur im Bass vorkommt. Also verrät er zugleich, dass er diese Musik als Bassist kennengelernt hatte. Davon, dass er sich zu einem Thema geäußert hätte, von dem er keine tiefer gehende Ahnung hatte, kann keine Rede sein.
Dies setzt sich an einem zweiten, besonders individuellen Zeugnis dieser musikbezogenen Sterbenskultur fort. 1660 musste der Pastor Hector Mithobius in Otterndorf zum Begräbnis der erst 24-jährigen Anna Catharina Münstermann predigen, der Frau eines jungen Kollegen. Sie entstammte einer traditionsreichen holsteinischen Pastorenfamilie und war unzweifelhaft mit diesem musikalisch-eschatologischen Denken groß geworden. Mithobius’ Predigt geht von einem Kirchenlied aus, »Meinen Jesum lass ich nicht«; er eröffnete sie so:21
Meinen Jesum, laß ich nicht, sagte […] unsere Seligverstorbene, liebe Mitt-Schwester, in ihrer letzten und hefftigsten Kranckheit, sonderlich in den fünff letzten Tagen ihres Lebens, etliche hundert mahl zu mir unnd andern Anwesenden, wenn wir sie zu besuchen pflegten, ja sie redete diese Worte nicht allein vielmahl mit freudiger Stimme und fröhlichen Geberden, sondern sie fieng auch an mit beweglichen Worten dieselben zu erk[l]ären unnd außzulegen, unnd wie die Kranckheit überhand nam sang sie auch dieselbigen mit erhabener und anmuthiger Stimme, mit hellen und wollautenden Gesange.
Mithobius kannte die Geschichte dieses Liedes; er bezeichnete es als »Ihrer Churfürstlichen Durchlauchtigkeit zu Sachsen, Hertzog Johann Georgen des Ersten Denck- und letzten Spruch«, den Christian Keimann in Zittau in »feine teutsche Reimen verfasset« und Andreas Hammerschmidt mit je fünf Sing- und Instrumentalstimmen vertont hatte. Das Stück war ganz neu; erst zwei Jahre zuvor im Druck erschienen (1658), war es bereits nach Otterndorf gelangt, dort musiziert worden und hatte dabei die nun Verstorbene so ergriffen, dass sie nach dem Anhören gesagt habe, sie »wündsche von Grund ihrer Seelen daß ihr solches in ihrem Todtbette von Gott möchte eingegeben und sie dessen wieder erinnert werden«. Auch hier weist also Musik in die Ewigkeit, noch dazu dadurch, dass die Sterbende sich selbst ins Jenseits singt.
Zwei Jahre später, am 19. September 1662, hielt Johannes Münstermann, vermutlich ihr Schwiegervater, in Otterndorf die klassische Predigt zur Einweihung einer neuen, sehr großen Orgel der Stadt; mit einer weiteren Orgelpredigt trat zehn Tage später, am Michaelisfest, Henricus Henrici im wenige Kilometer südlich gelegenen Neuenkirchen hervor.22 Die beiden Orgeltexte wurden als Teile eines Fundamentalwerks mit dem Titel Psalmodia Christiana gedruckt: In ihm wird umfassend dargelegt, warum die Musik für die Lutheraner so wichtig sei und wie sie wirke; zusammengestellt (und in wesentlichen Teilen verfasst) wurde sie von Mithobius.
Anlass dieses Werks waren Überlegungen des Rostocker Theologen Theophil Großgebauer, die er 1661 in seiner Wächterstimme aus dem verwüsteten Zion geäußert hatte; in seiner Ablehnung der »großen« Kirchenmusik vollzieht er einen Bruch mit den lutherischen Urkonzepten (selbstverständlich ohne dies so zu sehen). Welche Folgen Großgebauers Werk hatte, soll erst im Schlusskapitel dieses Buches gezeigt werden; hier ist zunächst wichtig, dass Mithobius’ Buch in der inhaltlichen Zusammenschau der Argumente einen Gipfel der lutherischen Musiktheologie bildet: konkret als Gegenentwurf zu Großgebauer.
Wie in einem Brennspiegel sind die Überlegungen auf dem Titelbild des Bandes zusammengefasst. Das untere Drittel zeigt vermutlich die Otterndorfer Kirche; nur wendet sich die Gemeinde nicht dem Altar zu, sondern der Orgelempore im Westen.
Kirchenmusik als Weltkonzept · Unten lauscht die Gemeinde dem Musizieren von Kantor und Schülern (im Mittelgang) sowie der »großen« Kirchenmusik auf den Emporen beiderseits der Orgel. In der Mitte das alttestamentliche Musizieren König Davids (links mit der Harfe), auf das sich die irdische, christliche Gegenwart bezieht. Beide finden ihre Erfüllung oben im himmlischen Musizieren: im Sinne der Offenbarung Johannis.
Hector Mithobius, Titelblatt der Psalmodia Christiana von 1665.
Im Mittelgang steht ein Dirigent, wohl der Kantor der örtlichen Lateinschule, denn neben ihm am Chorpult singen drei Schüler. Die Südempore (auf deren Brüstung, dezent versteckt, der Buchtitel steht) trägt vor allem Spieler von Saiteninstrumenten, die Nordempore ist Bläsern vorbehalten (und liefert den Untertitel: mit dem Hinweis auf die Epistel des 20. Sonntags nach Trinitatis als Predigttext zur örtlichen Orgeleinweihung). Zwischen den Instrumentalisten ist immer wieder einmal ein Musiker mit Notenblatt und ohne Instrument zu sehen, folglich ein Sänger. Die Orgel ist auf das Wesentliche reduziert; zwischen den massigen Pedaltürmen und vor dem Hauptwerk ist das Rückpositiv optisch gestaucht wiedergegeben, um auch den Blick auf den Organisten freizugeben. Vor dem Hauptwerk schwebt, von zwei Engeln gehalten, der entscheidende Bibelspruch aus dem Epheserbrief, auf seine Essenz »Singet und spilet dem Herrn« verkürzt.
Die Mittelzone des Bildes zeigt den Transport der Bundeslade nach Jerusalem. Drei Verse aus dem 6. Kapitel des 2. Buchs Samuel werden genau bezeichnet; und so ist links als Anführer David mit der Harfe zu erkennen, ihm folgend (vor und hinter den Trägern der Bundeslade) das »ganze Israel […] mit Jauchzen und Posaunen«. Die Bilddarstellung ist noch reicher; hinzu kommt, was in der umfassenden »biblischen Instrumentenkunde« des 150. Psalms erwähnt ist (dieser Text steht zwischen Bundeslade und dem Epistelwort an der Orgel): von links nach rechts erst Pauken, dann Pfeifen unterschiedlicher Art, eine Triangel und zwei unterschiedliche »Saitenspiele«.
Oben schließlich ist der Himmel wiedergegeben. Über dem Lamm schwebt ein Schriftband mit dem Anfangssatz des Engelskonzerts aus der Weihnachtsgeschichte; im Wolkenkranz sitzen 24 Sänger, jeder von ihnen mit einer Harfe ausgestattet – in direkter Anspielung auf die Offenbarung Johannis, auf die links im Schriftfeld verwiesen wird.23 Und die Szenerie erscheint eingebettet in die »Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und die Ältesten her«, von der in der Offenbarung ebenfalls die Rede ist.
Also zeigt das Bild einen Prozess: Das Musizieren im Diesseits ist mit dem in der Ewigkeit verbunden, und es ist dessen unterste Stufe; in der Ewigkeit wird zugleich das Musizieren des Alten Testaments vollendet, das seinerseits der irdischen Alltagspraxis übergeordnet ist – als Teil der christlichen Lehre. So schlägt das Bildkonzept (und mit ihm das gesamte Buch) den Bogen zurück zum Gedicht Johann Walters und gibt dessen Gedankenwelt nun, 1665, nochmals besondere Schubkraft.24
Dieses Denken also hat Musizieren und Komponieren der lutherischen Tradition geprägt. Das Reformationsjahrhundert hatte einen Legitimationsdruck entstehen lassen; in ihm hätte nicht ausgereicht, dass Kirchenmusik einfach nur Erbe einer Tradition war. Wüsste man nicht, dass es auch Fundamentalkritik wie die Großgebauers gab, könnte man meinen, die Debatten des 16. Jahrhunderts seien endgültig zugunsten der lutherischen Musik ausgegangen – zumal auch der immense künstlerische Ertrag, wie von Pipping zitiert, den Nutzen zu bestätigen schien. Und das Konzept ging auf: Niemand im (reichen) Bauerndorf Altenbruch hatte ein Problem mit kunstvoller Kirchenmusik; die Identifikation der Einwohner mit ihr ging so weit, dass Pipping mit dieser Musik frei operieren konnte, um sein Himmelskonzept verständlich zu machen – gegenüber einer Trauergemeinde, die (weil es um das Begräbnis des Schulmeisters ging) aus allen Gesellschaftsschichten des Dorfes stammte.
Für die lutherische Musik im 17. Jahrhundert bedeutete diese Ideenwelt eine pauschale Wertschätzung, und sie strahlte aus auf das Leben des Einzelnen. Nicht irdische Werke entscheiden über das himmlische Weiterleben, sondern der Glaube; um ihn individuell zu äußern, müsse jeder beim Musizieren schon auf Erden das Bestmögliche bieten. Diesen Gegensatz bringt Henricus Henrici in seiner Neuenkirchener Orgeleinweihungspredigt besonders plastisch auf den Punkt, und er umreißt die Grundlage dafür so:25
Die ganze Christliche Kirche, so wohl die Triumphierende [im Himmel] als die Streitende [auf Erden], theilt sich in zwey Choros und Reyen [= Reihen, Reigen], den Obern und den Untern. Jener figurirt droben im Himmel, wier hierunten auf Erden singen den Choral. Unsere Music soll sein ein Echo und Wieder-Schall der Himmlischen Music. Wie der Papagey dem Menschen lernet nachschwätzen, so sollen auch wir den Engeln und Außerwehlten Himmels-Bürgern nachsingen. Die Englische Music soll unser Exemplar [= Vorbild] und Tabulatur sein, damit sie auch Gott möge gefallen.
Und dann fährt er fort: »Wir sollen und müssen Gott loben, es geschehe nun mit schlechten oder mit Kunst-Stimmen.« Also: Jeder muss sich nach seinen Kräften bemühen, den irdischen »Wieder-Schall der Himmlischen Music« entstehen zu lassen. Wer eine »schlechte« (schlichte, unausgebildete) Stimme hat, nutzt sie für das Lob Gottes; wer für dieses auch Kunstmittel einsetzen könnte und hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, reicht individuell nicht an den »Wieder-Schall der Himmlischen Music« heran und verweigert somit das Glaubenszeugnis.
In der ewigkeitsbezogenen Bestattungspraxis war das Singen der Schüler am Grab unverzichtbar; es konnte auch mit den »schlechten« Stimmen einer Dorfschule geleistet werden. Im städtischen Bürgertum konnte der Musiziergedanke auch weit über den Tod hinauswirken; die Leipziger Thomaner bekamen Geld aus privaten Stiftungen, die eigens dazu angelegt worden waren, dass alljährlich am Sterbetag des Stifters vor dessen einstigem Haus ein Lied oder eine Motette gesungen werden sollte – eine Praxis, die sinnigerweise erst nach einem sächsischen Glaubensschwenk prominent nachweisbar ist (vgl. 5. Kapitel).26 Und schließlich waren Trauerfälle auch Anlässe für neue Kompositionen. Breit dokumentiert sind die Drucke, in denen Musiker des 17. Jahrhunderts strophische »Arien« zum Gedächtnis an einen Verstorbenen publizierten – neben den typischen Trauergedichten, die zumeist nicht auch vertont wurden. Diese persönlichen Abschiedsworte traten in der Sterbenskultur neben die Trauerpredigt und den biographischen Nachruf (als Exempel geistlichen Lebenswandels). Ob jene strophischen Trauerkompositionen stets musiziert wurden, mag man bezweifeln, denn auch die Gedichte werden nicht vorgelesen worden sein; sie leben ein Stück weit von der Komplexität ihrer poetischen Anlage.
Aufgeführt wurden aber die größeren Kompositionen, die eigens und direkt für die Trauerfeiern entstanden. Stil und Besetzungsumfang richteten sich – dem Erlösungsgedanken folgend – nach den Frömmigkeitsvorstellungen; denn auf sie kam es an, nicht auf den messbaren äußeren Aufwand. Wem ultramoderne Musik nicht gottesfürchtig genug schien, der griff zu stilistisch anderem. So schrieb Bach seine Motette »Der Geist hilft unser Schwachheit auf« BWV 226 für das Begräbnis des Thomasschul-Rektors Johann Heinrich Ernesti 1729: Der Verstorbene war 1652 geboren und hatte als Theologe und Philologe wissenschaftlich gearbeitet; eine doppelchörige Motette (insofern traditionell wirkend, auch mit ihrem vollen Instrumentarium) mag seinem Denken exakt entsprochen haben. Drei Jahre zuvor hingegen war der Kammerherr Johann Christoph von Ponickau gestorben; neun Tage jünger als Ernesti.27 war er als Hofbeamter in der kursächsischen Staatsverwaltung aktiv gewesen. Dass zu seinem Trauer-Actus eine Kirchenkantate entstand (Bachs »Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn« BWV 157), zeigt insofern modernere Stil-Interessen eines Menschen, der in das höfische Leben eingebunden war.
Ohnehin entstanden die auffälligsten Werke dieser Art zu fürstlichen Trauerfeiern; die musikalischen Möglichkeiten dazu, qualitativ und quantitativ Einsatz für den Ewigkeitsbezug zu leisten und ihn zu propagieren, waren an einem Hof naturgemäß größer als in jedem anderen Kontext. Hier ist zu unterscheiden zwischen einer älteren, dezidiert lutherisch motivierten Kultur und der jüngeren, ausgeprägt absolutistischen des 18. Jahrhunderts, in der dem Verstorbenen auch Personenkult zuteilwurde. Ihn lässt Bachs Kantate »Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl« BWV 198 (1727) schon im zweiten Wort erkennen; Johann Christoph Gottscheds Text spricht nur von Kurfürstin Christiane Eberhardine, nie von der musikaffizierten Ewigkeit. Ziel dieses Personenkults war, die Untertanen, die der Aufführung beiwohnten, in eine möglichst breit aufgestellte Landestrauer einzubeziehen.
In jener älteren Gestalt steht dieser Aspekt im Hintergrund; wichtiger sind – nicht unerwartet – Erlösung und Jenseits. Drei beispielhafte Werke oder Werkgruppen stechen hier aus der Musikgeschichte hervor: die Musikalischen Exequien von Heinrich Schütz, geschrieben zur Trauerfeier für Heinrich Posthumus Reuß in Gera 1636, ferner die Trauermusiken, die Johann Philipp Förtsch und Georg Österreich am Hof der Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf zwischen 1680 und 1704 schufen, und schließlich die Trauermusik zum Tod Herzog Ernst Ludwigs von Sachsen-Meiningen in der Vertonung von Johann Ludwig Bach von 1724.28 All diese Werke sind von dem so elementaren lutherischen Denkmodell getragen, und zwar auf doppelte Weise: Aus Sicht der Irdischen wird dem Verstorbenen etwas Wirksames mit auf den Weg ins ewige Engelskonzert gegeben; und ein Hof legte vor den Untertanen, deren Repräsentanten im Rahmen der regionalen Ständeordnung dem Staatsbegräbnis beiwohnten, ein Zeugnis des Glaubens an Rechtfertigung, Ewigkeit und Engelskonzert ab.
Was also zeichnet jene höfischen Werke aus? Heinrich Posthumus hatte für seine Trauerfeier ein differenziertes, ausbalanciertes Programm an Bibelzitaten ausgewählt; diese sind als »Devisen des Sterbens« komplett auch auf seinem Prunksarg wiedergegeben, und Schütz hat genau diese Texte vertont. Die Anordnung auf dem Sarg wurde in einer gedruckten Schrift kommentiert, als beispielhaftes Zeugnis dafür, welche Bedeutung Tod und Auferstehung haben – insofern als theologische Lehrschrift. Der Druck von Schütz’ Komposition gehört ebenso zu dieser Memorialkultur: Mit ihr wurde zwar auch dem Verstorbenen ein Denkmal gesetzt, doch weil er an keiner Stelle der Komposition erwähnt wird (und diese daraufhin, von ihm persönlich abgelöst, universell aufführbar ist), entsteht etwas Musterhaftes. Der Herrscher scheute keine Mühe, für seinen Abschied von der Erde das Maximum an textlich-musikalischer Konzeption zu erarbeiten, und das Resultat fordert andere auf, es ihm nach Kräften gleichzutun.
Schütz’ Musik im einleitenden Teil kann ein wenig kurzatmig wirken; das ist dem Umstand geschuldet, wie viele Texte Schütz vor allem in diesem »Concert […] in form einer teutschen Missa« zu verarbeiten hatte. Kaum eines der Bibelzitate, die bei Trauerfeiern Predigttext sein konnten, fehlt; der Bogen spannt sich von »Nacket bin ich von Mutterleibe kommen« und »Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn« über »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt« bis zu »Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn«. Und sowohl das Fürstenhaus als auch Schütz als Komponist wussten, was »große Musik« ist: Sie wird teils klangräumlich als Doppelchörigkeit angeordnet, teils handelt es sich um solistische Musik mit Generalbass.
Sterbenskultur als Gesamtkunstwerk · Heinrich Posthumus Reuß (gestorben 1635) ließ seinen Prunksarg mit Bibelzitaten versehen; diese kamen nicht nur in der Trauerpredigt vor, sondern sie wurden obendrein von Heinrich Schütz in den Musikalischen Exequien vertont, die aus Anlass des Trauergottesdienstes entstanden. »Also hat Gott die Welt geliebet« und »Er sprach zu seinem lieben Sohn« eröffnen den zweiten Abschnitt des einleitenden »Concerts in form einer teutschen Missa«.
Die Gruft der Familie Reuß befindet sich in der Kirche St. Johannis in Gera.
Als rund 90 Jahre später in Meiningen Herzog Ernst Ludwig starb, hatte auch dieser sich den Text seiner Trauermusik kompiliert; dem mittleren ihrer drei Teile liegt ein Ewigkeitsgedicht zugrunde, das er sogar selbst verfasst hatte. Der Hofkapellmeister Johann Ludwig Bach konnte musikalisch alle Register ziehen: ebenfalls mit einem doppelchörigen Vokalensemble, zudem in solistischen Arien mit modernsten Instrumenten (wie dem Chalumeau, einem zeitgenössischen Verwandten der Klarinette). »Traurig« wirkte die Trauermusik nur bedingt; selbstverständlich gibt es auch Moll-Farben, doch im Zentrum steht der Gedanke, den der Herzog am Anfang seines Gedichts äußert: »Ich suche nur das Himmelleben«. Wer er zu Lebzeiten gewesen war und wie er von seiner Nachwelt gesehen werden wollte, wird mit keinem Wort erwähnt; das Werk mit seinen eindrucksvollen Ausmaßen dient also nur zur Darstellung der Glaubensinhalte und – unter ihnen – vor allem des himmlischen Jerusalem.
Wie sich fürstliche lutherische Trauermusiken zwischen den Gottesdiensten in Gera 1636 und Meiningen 1724 entwickelten, ist vor allem deshalb schwer zu rekonstruieren, weil von nahezu keinem Hof entsprechende Werke erhalten geblieben sind; sie wurden auch nicht weiter verbreitet, wohl weil Traueranlässe (als Staatsakt) und Besetzungsaufwand jeweils einzigartig erschienen. Breit informiert ist man nur über das, was am Hof der Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf geschah; dessen Musik ist in der Sammlung ihres Kapellmeisters Georg Österreich erhalten geblieben (lange Zeit irreführend als »Sammlung Bokemeyer« geführt – Heinrich Bokemeyer hatte jedoch am Zusammentragen der Noten einen nur marginalen Anteil).29 Neben den Werken, die Österreich selbst für Trauergottesdienste des Hofes schrieb, umfasst die Sammlung auch entsprechende Kompositionen seines Vorgängers Johann Philipp Förtsch. Sie alle zeigen die lutherische Sterbenskultur in besonders breit differenzierter Form; und zugleich lässt sich an ihnen ablesen, was nach zeitgenössischer, individueller Einschätzung als künstlerische Höchstleistung im Angesicht der Ewigkeit verstanden werden konnte.
Deren Indikatoren sind teils besonders umfangreiche Besetzungen (ein elfstimmiges Streicherensemble in Förtschs »Unser Leben währet siebenzig Jahr«, 1692), teils extreme sängerische Herausforderungen (Sopran-Höhe und Bass-Melismen in Österreichs »Unser keiner lebet ihm selber«, 1702). Manche Texte werden in kantatenartige Satzfolgen überführt; andere wirken wie ältere Schwesterwerke zu Bachs Choralkantaten, und ihnen liegen dann die typischen Sterbechoräle zugrunde. Und wieder andere sind sehr breit angelegte und groß besetzte Geistliche Konzerte mit großer formaler Spannkraft (wie Österreichs »Wir haben nicht einen Hohenpriester«, 1695). Schließlich aber gibt es auch Österreichs »Plötzlich müssen die Leute sterben« von 1702, das den Kriegstod Jonathans zum Thema hat – mit seinem alttestamentlichen Stoff (und auch im Klangkonzept) nicht unähnlich den späteren alttestamentlichen Oratorien Händels. Anlass war der Tod des Herzogs, Friedrich IV., in einer Schlacht des Großen Nordischen Krieges, und jeder, der dem Trauergottesdienst beiwohnte, muss die Verbindung zwischen Jonathan und dem Herzog gesehen haben. In der Erstfassung des Werks wird dieser jedoch nie erwähnt; zur Aufführung kam dann eine erweiterte Version, in der der Personenkult sich Raum bricht. Flankiert wurde dieses Werk von einem Choralkonzert und jenem »Unser keiner lebet ihm selber«, das – wie Schütz’ Musikalische Exequien – als Reihung zahlreicher Bibelstellen mit Sterbethematik aufgebaut ist; an der Schwelle der lutherischen Kantatenkultur stehend, bildet dieses Werk also eine Art Bindeglied zwischen Schütz’ Werk und dem 160 Jahre später entstandenen Ein deutsches Requiem von Johannes Brahms mit einer ähnlichen biblischen Textgestalt.
So macht der Ewigkeitsgedanke deutlich, warum die Musik des Luthertums sich auf einem so breiten, theologisch abgesicherten Fundament entfalten konnte und immer wieder um Tod und Ewigkeit kreist. Dies ist Ausdruck nicht allein irdischer Bedrängnisse, sondern zugleich einer elementaren, überzeitlichen Hoffnung. Musik war deshalb zugleich zwingend in die Liturgie eingebunden; und alle Gläubigen hatten zudem den Auftrag, außerhalb des Gottesdienstes zu musizieren – geistliche Lieder. Mit der Ewigkeitsdimension wurde die Musik somit zu einem essenziellen Ausdrucksmittel des lutherisch geprägten Glaubens. Fortwährend bestand der Druck, musikalisch das Bestmögliche zu leisten, weil diese Klänge aus der irdischen »streitenden Kirche« in die himmlische »triumphierende Kirche« wiesen; ohne dieses Konzept hätte sich eine eigene lutherische Musikkultur kaum profilieren lassen. Unter welchen Bedingungen dieses für Musik so ideale Konzept ausgehöhlt und schließlich aufgehoben wurde, wird Thema des 10. Kapitels sein.