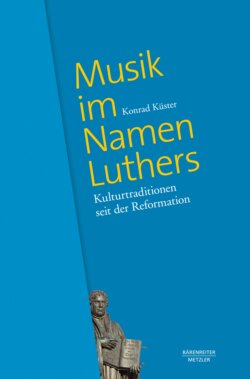Читать книгу Musik im Namen Luthers - Konrad Küster - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fromme Musiker?
ОглавлениеSchließlich stellt sich eine im Umfeld musiktheologischer Zugänge unvermeidliche Frage: Wie fromm muss ein Musiker sein, um für kirchliche Dienste zu taugen? Muss er sein wie Joseph Berglinger, dessen (fiktive) Lebensbeschreibung Wilhelm Heinrich Wackenroder und Ludwig Tieck 1795/96 ans Ende der Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders stellten? Berglinger weihte sein Leben einer sakralen Tonkunst, und als er eine Passionsmusik (wie sich zeigte: sein letztes Werk) komponieren wollte, musste er erst gegen sein zerrissenes Herz ankämpfen und schrieb die Musik schließlich »unter heftigen Gemütsbewegungen« nieder.36 Bilder wie dieses haben den Zugang zu Komponisten von Musik mit geistlichen Texten tiefgreifend geprägt, nicht aber erst in der Romantik. Denn die Frage, wie es der kirchliche Musiker mit der Religion hält, wurde schon im Mittelalter diskutiert, und sie hatte auch für die lutherische Seite Bedeutung. Zwar gab es hier keine Instanz, die einen Musikstil dogmatisieren konnte wie die päpstliche Kurie. Doch umgekehrt war die Sorge vor dem unfrommen Musiker möglicherweise nur diffuser.
1324/25 taucht die Frage einer missbräuchlichen Verwendung von Musik wohl erstmals in den Argumentationen des Papsttums auf.37 Das Gedächtnis der päpstlichen Verwaltung sorgte dafür, dass dieser Satz reaktiviert werden konnte, besonders im mittleren 16. Jahrhundert (in der Zeit des Trienter Konzils) und im Vorfeld des Heiligen Jahres 1750. Und da alle Argumentationen der Kurie über Jahrhunderte hinweg den Anspruch der Unfehlbarkeit hatten, gab es kaum Möglichkeiten, den Missbrauchsvorwurf zu hinterfragen.
Die Bulle wurde in Avignon erlassen, seit 1309 der Sitz der Päpste. Johannes XXII., verantwortlicher Urheber der Bulle, verurteilte die junge französische Motette, in der neben einem liturgischen Cantus firmus mit dessen Originaltext (im Tenor) in den Oberstimmen weltliche, volkssprachige Texte vorgetragen werden. Johannes XXII. war Franzose und konnte französische Musik kennen; doch offensichtlich war jene Motette nicht auch in den römischen Traditionen verwurzelt, und so war die erhoffte Einheitlichkeit der Liturgie nicht gegeben. Wer dafür verantwortlich war, aus einem stilistischen Unterschied zwischen Rom und Frankreich einen Missbrauchsvorwurf abzuleiten und ihn gegen die Musiker zu richten, ist nicht zu klären; Johannes trug letztlich nur die »politische Verantwortung« für die Formulierungen, die fortan christliche Kirchenmusik-Diskurse begleiten konnten.
Der Vorwurf geht auf jeden Fall an der Sachlage vorbei. Jeder Musiker der Zeit, der irgendwie in der Kirchenmusik tätig war, war zugleich eingebunden in kirchliche Strukturen. Musik entfaltete sich also in einer lokalen Hierarchie; unterlief ein nachgeordneter Priester (als Musiker) liturgische Vorschriften, hätte er sehr schnell Grenzen gesetzt bekommen. Folglich entstand der Konflikt daraus, dass die liturgischen Bedingungen grundsätzlich nicht einheitlich waren, aber das Papsttum ein einheitliches Erscheinungsbild postulierte: Die Liturgie, die dem Papst vorschwebte, bestand eben nicht überall gleich, und sachgerechter wäre gewesen, die Unterschiede den lokalen Liturgieverantwortlichen anzulasten, als den musikalisch Ausführenden ein Eigenleben vorzuwerfen. Folglich muss man die Mechanismen eingehender beschreiben, die diese Musikkultur trugen.
Elementar für die Kirche war, dass in ihr nie eine mehrstimmige Motette »aufgeführt« wurde: Liturgie kennt keine musikalischen Gattungen, sondern nur den spezifischen Introitus des jeweiligen Gottesdienstes oder den spezifischen Psalm einer liturgisch festgelegten Konstellation des Stundengebetes. Selbst wenn ein Musiker glaubte, mit einer mehrstimmigen Bearbeitung dem jeweiligen liturgischen Gesang eine ideale Gestalt gegeben zu haben, war er in seiner Einschätzung von der des kirchlichen Vorgesetzten abhängig. Wie weit sich Musik entfalten konnte, regelte sich also primär vor Ort. Dabei konnte sich ein Professionalitätsproblem ergeben: Denn Priester haben eine geistliche Kompetenz; wollten sie (als Priester) zugleich musikalische Aufgaben ausüben, war auch musikalische Kompetenz notwendig. Doch für die bloße Beurteilung von Musik galten nur die geistlichen Konzepte; und so konnte sich Musik nur in dem damit abgesteckten Rahmen entfalten. Er aber brauchte wiederum nicht überall einheitlich zu sein; eine überregionale Verständigungsgrundlage war allein mit den einstimmigen gregorianischen Gesängen gegeben, und schon die prinzipielle Frage, ob deren Einbettung in einen mehrstimmigen Vortrag zulässig sei, ließ sich nicht pauschal beantworten. Das also führte zu Reibungsflächen – wie 1324/25. Und sie vergrößerten sich durch Mobilität: teils durch die der Musiker, die ihr Musikverständnis an einen anderen Ort mitnahmen, teils durch die der kirchlich Verantwortlichen, die von außen in ein eingespieltes Milieu eintraten. Und das gilt genauso für die lutherische Praxis.
Gesetze einer örtlichen oder regionalen Tradition bestimmten die Komposition also in weitaus höherem Maße, als eine romantisch geprägte Gesellschaft es sah. Ein Komponist, der einen bestimmten Psalmausschnitt vertonte, tat dies innerhalb der Liturgie, nicht aus persönlicher Ergriffenheit (wie Wackenroders und Tiecks Joseph Berglinger). Und wenn man sich wünscht, Bach hätte doch mehr Lieder Paul Gerhardts in Choralkantaten »behandeln« sollen als nur in einer einzigen (»Ich hab in Gottes Herz und Sinn« BWV 92), liegt die Ursache nicht in Bachs Einstellung zu Gerhardt; sie beruhte ganz konkret auf der Liedtradition, in die er vor Ort eingebunden war.
Vorbildgestalten der Kirchenmusik wie Josquin, Palestrina oder Bach schrieben kaum aus einem akuten Bedürfnis heraus geistliche Musik; es war Teil ihres Berufes, sie zu schaffen und aufzuführen. Musik wurde nie auf etwas Geistliches verengt, sondern war (umgekehrt) von diesem umfassend getragen, in sich selbst und in allen Lebenslagen. Dies steht auch hinter einer Formulierung, die sich beim Propheten Jesaja findet (5, 11–12): »Weh denen, die des Morgens früh auf sind, des Saufens sich zu fleißigen, und sitzen bis in die Nacht, daß sie der Wein erhitzt, und haben Harfen, Psalter, Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlleben und sehen nicht auf das Werk des Herrn und schauen nicht auf das Geschäft seiner Hände!« Dieser musikalische Imperativ des bedingungslos Geistlichen findet sich auch an sensibler Stelle: in der Dorfkirche in Hamburg-Neuenfelde, an einem Deckenbalken, der direkt der Orgel Arp Schnitgers (1688) zugewandt ist. Zahlreiche Bibelzitate, die zur Begründung der »großen« Kirchenmusik typischerweise herangezogen wurden, sind in dieser Dorfkirche für die Gemeinde sichtbar; das Jesaja-Wort aber richtete sich direkt an den Organisten – und wurde über seinem Spieltisch als Aufforderung »Gott allein die Ehre« präzisiert. Kunst »zu Gottes Ehre« war kein Bekenntniswerk, sondern eine essenzielle Arbeitsgrundlage.
Kurz: Eine gläubige Grundeinstellung vorromantischer Musiker beim Schreiben und Spielen von Kirchenmusik war eine Selbstverständlichkeit, allerdings auf einem breiten Fundament. Wenn sich alle Beteiligten vor Ort einig waren, konnten alle nur erdenklichen Kunstmittel genutzt werden – und mussten es auch, und zwar als Teil der individuellen wie kollektiven Ewigkeitsfürsorge: Textausdruck, komplexer Kontrapunkt, auch Modernität und Aktualität. So brauchte auch nicht gefragt zu werden, ob Kunst allen, die mit ihr konfrontiert wurden, bis in letzte Winkel verständlich sei; es ging auch nicht darum, Gläubige auf einer möglichst niedrigen Kunststufe abzuholen. Warum hätte gerade die Musik leichter verständlich sein sollen als die vielen anderen Aspekte des Glaubens? Christliche Grundfragen wie die Rechtfertigung (als Hilfe, mit dem Gewissen und der eigenen Endlichkeit klarzukommen), die Nächstenliebe (als zwischenmenschlicher Respekt, über die eigene Person hinausgehend) und das Pfingstwunder des Heiligen Geistes (als Halt für den Menschen, auch wenn er allein ist) sind intellektuell ähnlich herausfordernde Fragen wie die nach der Wirkung von Musik. Viel charakteristischer erscheint somit die Anforderung, die Henricus Henrici in der Neuenkirchener Orgelpredigt formulierte: Alle Gläubigen leisten das individuell Bestmögliche; das zwingt auch zu Höchstleistungen derer, die sie erbringen können. Darin treffen sich alle und vertrauen einander. Dies steckte den Rahmen dafür ab, dass sich im Luthertum eine spezifische musikalische Kunst entwickeln konnte.