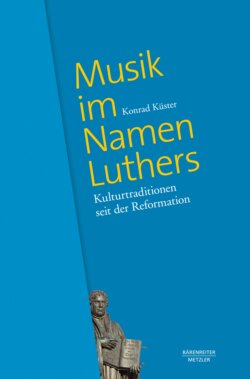Читать книгу Musik im Namen Luthers - Konrad Küster - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Graduale und Gesangbuch
ОглавлениеIn dem weiten Bogen, der sich von Pforzheim über Wittenberg und Ribe nach Lublin schlagen lässt, wird deutlich, wie sehr die Kunstmusik im frühen lutherischen Gottesdienst dem Spätmittelalter verpflichtet war. Die einzige veritable Wortbotschaft der Messe war die Predigt, denn auch die Lesungen wurden gesungen. Vor allem in der ersten Hälfte des Gottesdienstes konnten die alten Messgesänge problemlos fortleben; in der zweiten, nach der Predigt, veränderte sich die Musik, weil das prägende Element, das Abendmahl, eine neue Ausrichtung erhielt. Orgelmusik, kaum je eigens erwähnt, wird dort, wo es Orgeln gab, weiter praktiziert worden sein; die Schweigsamkeit der Quellen erklärt sich zweifellos daraus, dass es den Zeitgenossen primär auf die Texte ankam, mit denen die Orgelanteile verbunden waren.
Die Besucher eines Gottesdienstes waren über weite Strecken dessen Zuhörer und Zuschauer; nur für kurze Momente spielten sie eine aktive Rolle. Lieder sangen Schüler, die mit ihnen liturgische Anteile der spätmittelalterlichen Messe in der Volkssprache ersetzten. Wenn nun aber die Gottesdienstbesucher fast nichts sangen (außer »dem Glauben« und den traditionellen Leisen-Einschüben in der Sequenz): Warum misst die Nachwelt Luther und seinem Kreis dann eine so große Bedeutung für das Kirchenlied bei? Und welchen Sinn hatte die sich anscheinend explosionsartig ausbreitende Gesangbuchkultur, wenn diese nicht auf die Gottesdienstbesucher abzielte? Ein Antwortversuch muss neben den geistlichen Anliegen der Reformation auch die Medienkultur des 16. Jahrhunderts in den Blick nehmen.
Wie erwähnt, war zu Luthers Zeit Notendruck jung, und weil dieser sehr aufwendig war, stellten sich einer großflächigen Nutzung mehr Hindernisse in den Weg als dem »Buch«-Druck im engeren Sinn. Gedruckte Noten blieben deshalb noch bis ins 18. Jahrhundert Luxus. Was das bedeutet, lässt sich von den Frischen teutschen Liedlin von Georg Forster aus betrachten, einer Sammlung weltlicher Liedbearbeitungen, die zwischen 1539 und 1556 erschien. Wegen des Liedcharakters wurde die Sammlung bei ihrer Wiederentdeckung im mittleren 19. Jahrhundert als zentrale Quelle eines deutschen Volksliedes aufgefasst; in ihrer Entstehungszeit kann sie aber nur eine Musiksammlung für die Hausmusik der zeitgenössischen Aristokratie gewesen sein.46 Menschen, die sie sich anschafften, waren wohlhabend, konnten neben Text auch Noten lesen und waren obendrein noch imstande, die Musik irgendwie aufzuführen. Dies alles war im »einfachen Volk« nicht gegeben. Die Sammlung Forsters (der in Wittenberg zeitweilig »Tischgenosse« Luthers gewesen war) erschließt damit auch Möglichkeiten zum Verständnis geistlicher Gesangbücher der Zeit: Keinesfalls waren Vokalmusik-Drucke im 16. Jahrhundert ein Massenmedium.
Viele der frühen Gesangbücher enthalten Noten. Und viele Melodien waren neu; nur selten konnten sie weggelassen werden. Jedes Gesangbuch berichtet somit darüber, welche Melodien bei seinen Käufern als bekannt vorausgesetzt werden konnten (nämlich die, die bei einem Textabdruck weggelassen wurden). Der Aufwand, der für diese Wiedergaben betrieben wurde, war groß: Frühe Gesangbücher enthalten die Melodien noch nicht in der Fortführung von Gutenbergs »Satz mit beweglichen Lettern«, sondern als Holzschnitte, wie Bildleisten oder andere Grafiken, die in einen Text eingefügt werden.
So erscheint es sinnvoll, die Lieferkette nachzuzeichnen: vom Gesangbuch Initiator zum Kunden. Sie ging nicht von den Regierenden aus; die frühen Gesangbücher waren noch nicht obrigkeitlich »privilegiert« oder gar »oktroyiert« wie im späten 18. Jahrhundert, als der Staat sogar das Singen in der Kirche kontrollieren wollte. Die Initiative zur Publikation lag in vielen Fällen bei den Druckern, die in ihrer Arbeit strikt auf Wirtschaftlichkeit achteten. Sicher: Sie konnten mit Theologen zusammenarbeiten, und ohnehin stellten sie Lieder für die aktuelle Glaubenspraxis zusammen; das teure Papier und die aufwendigen Drucktechniken wurden nicht für ein Liedrepertoire verwendet, dem die Käufer ratlos gegenüberstanden.
Die beste Reklame für diese Produkte war offenbar, zu Beginn eine Gesangbuchvorrede Luthers nachzudrucken; in der Praxis scheinen diese wie gemeinfreies Gut gebraucht worden zu sein. Wie nonchalant man dabei vorgehen konnte, zeigt zuerst das Enchiridion von 1525. Eigentlich ein »normales« Gesangbuch mit Melodie- und Textwiedergaben, enthält es die Vorrede, die Luther 1524 zu den vierstimmigen Liedbearbeitungen Johann Walters im Wittenberger Geystlichen gesangk Buchleyn geschrieben hatte. Nicht einmal der Hinweis auf den Nutzen der Vierstimmigkeit wurde unterdrückt.47 Nur wenig besser ist dies im Leipziger Gesangbuch von 1530 gelöst48 Dort verweist immerhin ein Klammerzusatz darauf, dass die Vierstimmigkeit nicht hier realisiert ist, sondern in einem andersartigen Produkt. Trotzdem konnte es scheinen, als habe Luther diesen Text eigens geschrieben und für das ältere Produkt lediglich Werbung gemacht. Das aber war nicht der Fall; der Wiederabdruck der Vorrede gibt dem vorgelegten Werk lediglich eine höhere Weihe. Dass diese Vorrede schließlich auch im Gesangbuch des Leipziger Druckers Joseph Klug (1533) wiederkehrt, obwohl Luther für dieses zusätzlich eine neue Vorrede schrieb, zeigt, wie sehr sich jene »alte« binnen kurzem zu einem Markenzeichen entwickelt hatte.
Mindestens bis hierhin lässt sich das Liedrepertoire also aus Sicht der Drucker betrachten; das verlegerische Interesse steht im Vordergrund, nicht die Gemeinde. Folglich ist das Erfurter Enchiridion von 1524 ebenso wenig ein lokal »gültiges« Kirchengesangbuch, das auf aktuelle Liturgie abgestimmt war, wie das Zwickauer gesang Buchleyn aus dem Folgejahr; die Ortsangabe verweist nur auf die Interaktion eines Druckers, der am jeweiligen Ort wirkte, mit Kunden, die sich hinter den Liedern irgendwie sammeln konnten. Ohnehin waren die Gesangbücher der mittleren 1520er-Jahre noch weniger als ihre jüngeren Nachfahren dafür geeignet, einen lutherischen Gottesdienst zu begleiten. Denn immer wieder fehlen in ihnen Lieder, die liturgisch von zentraler Bedeutung waren. So verzichtete der Zwickauer Drucker 1525 auf die Wiedergabe der Sequenz-Leisen, und im Erfurter Enchiridion sucht man »Wir glauben all an einen Gott« vergeblich: Zwar wird in einer Überschrift auf diese Melodie Bezug genommen (ohne dass sie abgedruckt wurde), doch es folgt ein anderer Text, und unter der Überschrift »zu bekennen den glauben« ist ein Text von Paul Speratus wiedergegeben. Somit hätten in einem Gottesdienst Wittenberger Prägung weder Schüler noch Kirchgänger mit diesen Büchern etwas anfangen können.
Mit diesen Druckerpublikationen kristallisierte sich im Lauf der ersten nachreformatorischen Jahrzehnte ein Kern-Liedbestand heraus; er konnte jeweils um freiere Anteile ergänzt werden. Zunächst bezog sich dieser Kern auf Luthers Umkreis; so heißt es mitten im Leipziger Gesangbuch von 1530:49 »Bis hieher gehen die Wittenbergische lieder und geseng, Die weil die andern nu auch gemein [= verbreitet] sind, wollen wir sie auch hernacher setzen.« Unter den folgenden sind dann weitere, die für lange Zeit in lutherischen Gesangbüchern zu finden waren: »Mag ich Unglück nicht widerstahn«, »Christ, der du bist Tag und Licht« oder »Ein Kindelein so löbelich«. Der Drucker bildete also einen Überschuss gegenüber den Konkurrenzprodukten – wiederum eher ein Kaufanreiz für die interessierten Anhänger Luthers als ein Kennzeichen für eine lokale gottesdienstliche Praxis.
Luther stand dieser Entwicklung skeptisch gegenüber; er schreibt dazu in der »neuen« Vorrede zum Klug-Gesangbuch:
Nu haben sich etliche wol beweiset, und die lieder gemehret, also das sie mich weit ubertreffen, und inn dem wol meine meister sind, Aber daneben auch die andern wenig guts dazu gethan, Und weil ich sehe, das des teglichen zuthuns ohn allen unterscheid, wie es einen jeglichen gut dunckt, uber das, das auch die ersten unser lieder je lenger je fälscher gedruckt werden, hab ich Sorge, es werde diesem büchlin die lenge [= langfristig] gehen, wie es allezeit guten büchern gangen ist, das sie durch ungeschickter köpffe zusetzen [= Zutun], so gar uberschüttet und verwüstet sind, das man das gute drunter verloren, und alleine das unnütze jm brauch [= in Gebrauch] behalten hat.
Daher, so Luther, habe er das gesamte Liedmaterial quasi auf einen Null-Zustand zurückgesetzt, neu geordnet und mit Verfassernamen versehen, »welchs ich zuvor vermieden, aber nu aus Not thun mus, damit nicht unter unserm namen, frembde untüchtige gesänge verkaufft würden«. Und so stehen Luthers Lieder nun am Anfang, gefolgt von seinen Psalmnachdichtungen und einer Reihe liturgischer Gesänge; dann schließen sich einige wenige auch seines engsten Kreises als »andere, der unsern Lieder« an. Nach »Christ ist erstanden« kommt dann die erste Einschränkung, die zugleich deutlich macht, dass es eine umfangreiche lutherische Liedkultur ohne direkte kirchliche Bindung gab:
Es sind auch geistliche lieder, durch andere, zu dieser zeit gemacht, weil aber der selbigen sehr viel sind, und der mehrer [= größere] teil nicht sonderlich tügen [= taugen], habe ich sie nicht alle wollen jnn dis unser Gesangbüchlin setzen.
Vor allem Lieder von Paul Speratus fanden Gnade vor Luthers Augen, daneben solche von Lazarus Spengler und Erhard Hegenwald. Ein weiterer Teil des Bandes bezieht sich dann direkt auf die Lobgesänge der Bibel. Und so entstand hier eine Art Enzyklopädie lutherischer Liedkultur: ein Kernrepertoire des evangelischen Selbstverständnisses. Damit rechtfertigt sich auch, von einer prägenden Rolle Luthers für das geistliche Lied seiner Zeit zu sprechen. Zu »Kirchenlied« oder gar »Gemeindelied« war dies damit aber noch nicht geworden.
Dieser Liedbestand wurde nun den Käufern angeboten: Menschen, die zunächst einmal lesen, außerdem die nicht mit abgedruckten Melodien kennen und notfalls auch mit Noten umgehen können mussten. All dies war auch Unterrichtsstoff der Schulen, die in jeder umfangreicheren Kirchenordnung als Multiplikatoren der (geistlichen) Bildung erwähnt werden. Und weil die Schüler eine der hauptsächlichen Akteursgruppen im Gottesdienst waren, schließt sich bei ihnen ein Kreis: Frühe Gesangbücher waren vor allem pädagogische Instrumente; die Schulen waren ihre zentralen Abnehmer – neben den materiell und intellektuell privilegierten Schichten der Bevölkerung. Und aus welcher Richtung man die weitergehenden Informationen auch zusammenträgt: Immer wieder stößt man auf dieses schulische Ziel der Liedkultur.
Dies lässt sich zunächst in zahlreichen Gesangbüchern so nachlesen: in den Vorworten, auch denen Luthers. Wie zitiert, war das Erfurter Enchiridion von 1524 laut Titelvermerk ausdrücklich auch zur Erziehung der »iungen iugendt« bestimmt; ebenso waren die vierstimmigen Sätze im Geystlichen gesangk Buchleyn von Johann Walter ein Teil dieser schulisch ausgerichteten Publikationskultur. Denn ausgehend von dem Wittenberger Liedbestand benennt Luther den Zweck des Bandes in der so häufig nachgedruckten Vorrede so:
Und sind dazu auch in vier stimme bracht, nicht aus anderer ursach, denn das ich gerne wollte, die iugent, die doch sonst soll und mus ynn der Musica und andern rechten künsten erzogen werden, ettwas hette, damit sie der bul lieder und fleyschlichen gesenge los worde, und an derselben stat, ettwas heylsames lernete.50
Der Hinweis auf die »bul lieder und fleyschlichen gesenge«, also auf Liebeslieder, wird in einer weiter ausgreifenden soziologischen Konstellation verständlich. Weltliche, populäre Musik spielte im frühen Musikdruck-Wesen eine wichtige Rolle: die französische Chanson, das in den 1520er-Jahren entwickelte italienische Madrigal oder eben auch das deutsche Gegenstück (das »Lied«). Diese Publikationen erreichten aber, wie beschrieben, nur die höheren Schichten. Sofern Luther also auf im Druck verbreitete »Buhllieder« anspielte, sprach er von diesen Spitzen der Gesellschaft. Aus ihnen stammten aber zugleich die Schüler der großen Lateinschulen.
Lutherischer Gottesdienst als Stundengebet und Messfeier · Die Gottesdienst-Abläufe werden anhand der Liturgie für den 1. Advent erläutert. Der Messe geht die Matutin (Mette) mit ihren sechs Teilen voraus, darunter als zweites Stück ein lateinischer Psalm (hier Psalm 112). Nach dem abschließenden »Benedicamus« folgt die Messe mit ihrer charakteristischen Verschränkung aus Stücken des Ordinariums (vom Kyrie zu Anfang bis zum abschließenden Agnus Dei) und des Propriums (Introitus, Alleluja, Sequenz). Als Nr. 7 ist die Predigt benannt, als Nr. 14 werden die Einsetzungsworte des Abendmahls erwähnt. Nur die beiden in Fraktur gesetzten Stücke (Nr. 15 und 18) sind deutschsprachige Lieder, die in jedem Gottesdienst gleich Vorkommen; ob die Gemeinde sie mitsang, wird nicht erwähnt.
Lucas Lossius, Psalmodia, 1553.
Andere Lieder konnte man im Alltag aufschnappen und ebenso in der Erinnerung abspeichern, wie Menschen des 21. Jahrhunderts mit Hits umgehen und sich den musikalischen Anteilen von Werbung nicht entziehen können. Wollte man jenen mündlich tradierten »Buhlliedern« mit einem geistlichen Gesangbuch begegnen, bedurfte es eines Hebels, der an dem »auf der Straße« kursierenden Repertoire ansetzen konnte. Auch dieser lag nur in den Schulen. Selbstredend konnte diese Zielrichtung der Gesangbücher gesteigert werden, wenn ihr Inhalt auch in den Elternhäusern gepflegt wurde; deshalb appelliert Luther auch an die Verantwortung aller Erzieher. Sein Ruf wäre verhallt, hätte es nicht eine Zielgruppe gegeben, die mit den aufwendigen Publikationen (mit Noten und Melodien) etwas anfangen konnte. So landet man wieder in den gehobenen Gesellschaftsschichten.
Und erneut hilft ein Blick auf die dänische Situation weiter. Auch dort hatte es schon früh umfangreiche Gesangbücher gegeben: 1533 im damals noch dänischen Malmö, zwanzig Jahre später in Kopenhagen, schließlich 1569 das Psalmebog des zuvor in Ribe so bemerkenswert wirkenden Hans Thomissøn. Auch sein Buch kam zunächst auf seine eigene Initiative hin zustande; doch in der besonders straff regulierten dänischen Gottesdienstkultur51 bestimmte der König unmittelbar nach Erscheinen in einem Erlass, dass Thomissøns Sammlung in jeder Kirche und jeder Schule vorliegen müsse – also oktroyiert wie andernorts erst in sehr viel späterer Zeit. Jede Kirche, das heißt: Das Gesangbuch musste in einfacher Ausfertigung vorhanden sein, zum Gebrauch also mindestens »des Schulmeisters«. Und »jede Schule« bedeutet, dass es sich um ein didaktisches Hilfsmittel teils der Glaubenslehre, teils der Gottesdienstvorbereitung handelte. Die Anschaffung für jeden einzelnen Gläubigen hätte nicht nur die Drucksysteme überfordert, sondern auch die Geldbeutel; für die (wiederum gut fassbare) dänische Situation ist erkennbar, dass der Anschaffungspreis etwa dem entsprach, was eine Kuh kostete.
Kurz: Wohin man sieht, hatten die Gesangbücher ihre Zielgruppe in den Schulen und – flankierend – in Häusern der Oberschicht. Diese Basisarbeit mithilfe von Liedern bot eine wesentliche Grundlage des Glaubens. Dem Gemeindelied stand im Gottesdienst zudem eine Liturgie entgegen, die von den Gradualien gespiegelt wird: als Fortentwicklung der vorreformatorischen Praxis. Lucas Lossius bot 1553 eine vereinheitlichte Grundlage allein der lateinischen Gesänge, Franciscus Elerus in Hamburg 1588 mit niederdeutschen Zusätzen.52 Dazwischen liegen 1573 die Kirchen-Gesenge Latinisch und Deudsch von Johannes Keuchenthal,53 der am Harz wirkte und sein Fundamentalwerk in Wittenberg herausbrachte, aus demselben Jahr schließlich – für Dänemark, nun ausdrücklich königlich patentiert – das Graduale von Niels Jesperssøn. Bei Elerus findet sich ein Liedanhang, bei Keuchenthal sind Lieder in die alte Liturgie eingestreut – aber letztlich so, wie es auch schon aus den alten Kirchenordnungen hervorgeht. Jesperssøn brauchte das nicht zu tun; Thomissøns Psalmebog war ja präsent. Dass damit – über das Schulische hinaus – irgendwo ein Weg zum Gemeindelied eingeschlagen worden war, ist nirgends erkennbar.