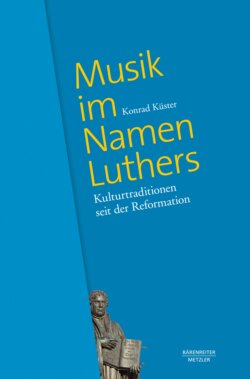Читать книгу Musik im Namen Luthers - Konrad Küster - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Schulmeister, Kantoren und die Lateinschüler
ОглавлениеWie im 1. Kapitel beschrieben, wuchs dem »Schulmeister« mit der Reformation eine wichtige liturgische Funktion zu. Im Gottesdienst trug er manche Gesänge als Solist vor; bei anderen führte er die Gemeinde an, und schließlich stellte er den Gesang der Schüler sicher; folglich musste er die Musik, die von ihnen gesungen wurde, auch einstudieren. Das konnten die liturgischen Gesänge sein, die aus den vorreformatorischen Gottesdiensten in die lutherischen übernommen worden waren – einstimmig choraliter oder mehrstimmig figuraliter. Der Schulmeister trug aber auch Verantwortung dafür, dass die neuen Lieder vom musikalischen und religiösen Bewusstsein der Schüler Besitz ergriffen, genau so, wie sich dies in Johann Walters Geystlichem gesangk Buchleyn darstellt.5
Wie diejenigen, die an den frühen lutherischen Lateinschulen für die Musik zuständig waren, diesen pädagogischen Auftrag erfüllten, ist beispielhaft für die Kathedralschule im dänischen Ribe belegt. Hans Thomissøns zweiter Nachfolger, Peder Hegelund, hat dies in seinem privaten Tagebuch aufgezeichnet.6 Im November 1569 hatte er, eben vom Studium in Leipzig und Wittenberg nach Dänemark zurückgekehrt, den Posten an der Schule angetreten; am Ersten Weihnachtstag, der im Anschluss an die morgendliche Messfeier ein normaler Unterrichtstag war, begann er nachmittags mit der Lektüre der Loci communes von Melanchthon (von ihm als »Definitiones Theologiae« zitiert) – nachdem er zuvor acht Weihnachtslieder aus Den Danske Psalmebog behandelt hatte, dem eben erschienenen Gesangbuch seines früheren Lehrers Thomissøn. Mit den Blattnummern dieses Buches bezeichnet, setzte er bei der dänischen Version von »Der Tag, der ist so freudenreich« an; sein Pensum schloss »Gelobet seist du, Jesu Christ« ein und reichte bis zu »Jesaja dem Propheten das geschah«. Zwei der Lieder waren von Thomissøn erstmals auf Dänisch ins Gesangbuch gelangt: »Vom Himmel hoch, da komm ich her« und »Was fürchtst du, Feind Herodes, sehr«. Also handelte es sich tatsächlich um ein Einstudieren; und mit ihm wird sich zwangsläufig auch ein Kommentieren der Glaubensaussage verbunden haben. Auf diese Weise ließ sich also, wie Luther es im Vorwort zu Walters Geystlichem gesangk Buchleyn geschildert hatte, »das heylige Evangelion […] ynn schwanck« bringen.7
Arbeiten wie diese scheinen für die Nachwelt zwingend mit dem Begriff »Kantor« verknüpft; warum aber ist von Schulmeistern die Rede – oder (im Fall Hegelunds) von einem Rektor? Die Antwort liegt im Schulwesen der Zeit. Denn selbstverständlich gab es Musikunterricht auch an Schulen, die nur einen Lehrer hatten und in denen alle Schüler in einem einzigen Klassenraum unterrichtet wurden: vom Schulmeister. Diese Schulen führten nicht zu »höheren akademischen Weihen«, sondern nur zu Basiswissen. Das Wichtigste in ihm war die Glaubenspraxis, und dies gab dem einen Lehrer eine Schlüsselfunktion: im Alltag (an der Schule) und im Gottesdienst (neben dem Pfarrer).
Wenn sich eine Gemeinde für ihre Schule einen zweiten Lehrer leisten konnte,8 führte dies zu einer umfassenden Teilung des Schulbetriebs. Es gab dann zwei Klassen; eine von ihnen beschäftigte sich mit dem Stoff für Fortgeschrittene und war einem Lehrer in höherwertiger Position zugeordnet, während dessen niedriger gestellter Kollege in der unteren Klasse Basiswissen vermittelte. Worum es dabei ging, erklärt sich direkt aus der Berufsbezeichnung: »Schreib- und Rechenmeister«. Der höhere Lehrer hingegen konnte sich »Rektor« nennen und vertrat die Schule nach außen. Dazu gehörte auch die musikalische Aktivität im Gottesdienst. Und in Abgrenzung vom Basiswissen, das der untere Kollege vermittelte (oder der »Schulmeister« einer einklassigen Schule), umfasste der Stoff für Fortgeschrittene nicht selten auch elementares Latein. Denn je höher qualifiziert der Posten war, den ein junger Mensch einmal antreten wollte, desto mehr wurde von ihm verlangt, auch die lateinischen Fremdwörter oder Satzkomplexe zu verstehen, die im Sprachgebrauch der Regierungen und Gerichte einen festen Platz hatten. Wer – auch in ländlichen Gebieten – hier mithalten wollte, kam um das Lateinische nicht herum.
Die Funktion eines Kantors ist erst ab einem mindestens dreiklassigen Schulsystem vorhanden. Sie ergab sich zwischen den Stufen des Rektors und des Schreibund Rechenmeisters, und ihr Inhalt ist leicht verständlich: An einer dreiklassigen Schule war die Qualifikation höher, die die Absolventen erwerben konnten; folglich musste der Stoff nach oben hin ausgebaut werden. Für sie stand der Rektor ein, und so wurde all das, was dessen Posten an einer nur zweiklassigen Schule charakterisierte, nun dem Kantor zugeordnet: vor allem der elementare Lateinunterricht und das Musizieren.
Dies veränderte sich nicht, wenn über der Kantorenstufe noch eine zusätzliche Lehrerposition eingeführt wurde: die des Konrektors (dann konnte der Rektor auch noch Griechisch unterrichten). Sollte diese vierklassige Schule noch weiter vergrößert werden, wurden weitere Stufen hinzugefügt, nun unter der des Kantors, und der Nomenklatur lagen nur noch die lateinischen Ordnungszahlen zugrunde: Ein »Collega quartus« war also Kollege auf dem vierthöchsten Rang und konnte dem Kantor zuarbeiten, indem er seinen Schülern erste Brocken Latein beibrachte. Beim Kantor verblieb dann die Aufgabe, diese Grundlagen in Syntax zu überführen, und zwar in der Tertia, der Klasse auf dem dritten Rang von oben.
Das Schulsystem mit zumeist fünf, nur selten bis zu acht Kollegen umfasste auf diese Weise ebenso viele Klassen wie Lehrer. Standardmäßig verblieben Schüler zwei Jahre in jeder Klasse (etwas, das sich noch im späten 20. Jahrhundert in Bezeichnungen wie »Unter-« und »Obersekunda« spiegelte); Überflieger kamen jedoch mit nur einem Durchlauf aus – weshalb sich Philipp Melanchthon bereits mit zwölf Jahren an der Universität Heidelberg immatrikulieren konnte. Andererseits musste die Lateinschule auch nicht bis zum Ende besucht werden; vielen Handwerkern genügte es, ihre Söhne bis in die Tertia auf die Lateinschule zu schicken, in der sie die im Alltag so wichtigen lateinischen syntaktischen Konstruktionen lernten. Die Tertia aber war die Klasse des Kantors; er war also für viele Lateinschüler der am höchsten gestellte Lehrer, den sie im Unterricht erlebten. Wo aber bleibt bei alledem die Musik – auch über die elementaren Liedzugänge hinaus, wie sie exemplarisch für Hegelund erfassbar sind?
Zuallererst prägte sie den Lateinunterricht. Ohnehin stand aller Stoff, der vermittelt wurde, im Dienst der Glaubensübung: Auch Schreiben-, Rechnen- und Lateinlernen waren Teil der religiösen Konditionierung heranwachsender Menschen. Ein brillantes Zeugnis dafür, wie dieser Unterricht aussah, liefert 1665 Hector Mithobius; er porträtiert die Unterrichtspraxis eines Ratzeburger Kantors, Henricus Sartorius:
Er thate gegen die hohen Feyertage nichts anders, als daß er die Schüler zur gebührlichen Feuer [= Feier] des instehenden [= bevorstehenden] Festes, und zur geistlichen Freude rechtschaffen præpariret. Die kleinesten übete er mit schönen Sprüchen und Gebetlein, die mitlern mit analysiren, construiren, disponiren und recitiren der schönesten Psalmen, hymnorum, Sequentium &c. Welche er aus den Choral-Büchern und uhralten Christlichen Poeten fleissig aufsuchte, zum öfftern choraliter über singen und wol bekant machen lies.9
Folglich dienten die Psalmen, Hymnen und Sequenzen als lateinischer Schulstoff. Die Begriffe »analysiren, construiren, disponiren und recitiren« umschreiben den Unterrichtsverlauf: Wie also ist der zugrunde liegende Text aufgebaut, und wie könnte er unter veränderten grammatikalischen Bedingungen sonst heißen? Zugleich wurden die Texte aufgesagt, aber auch einstimmig (choraliter) gesungen. Und schließlich folgt noch eine ungeschminkte Schlussbemerkung: Denn mit dieser intensiven Beschäftigung wurde nicht nur die Syntax, sondern zugleich die Glaubensessenz der Texte »bekant« gemacht. Sie prägten sich also durch beständige Wiederholung ein: die Texte und die Syntax mithilfe der Musik. Davon spricht auch die Zwischenüberschrift, unter die Mithobius die Beschreibung stellt: »Wie man in Schulen fürnemlich auf die Sacra sehen solle.« Das war der »Endzweck« des Unterrichts.
Damit wird zugleich eine reformatorische Fundamentalposition berührt: Glaubenszugang findet der Mensch »allein durch das Wort« und die Sakramente.10 Die Essenz davon bedeutet jedoch »sola scriptura«: »allein durch die (Heilige) Schrift«. Und zu deren Verkündigung ist letztlich jedes Mittel recht: nicht allein der Mund eines Pfarrers, sondern ebenso das Bild oder die Musik. In der Pädagogik gilt eine sinnvolle Mischung von Medien als lernfördernd, permanenter Frontalunterricht hingegen nicht. Die lutherische Reformation hatte gerade dafür ein ausgesprochen modernes Bewusstsein: Sie stützte sich in der Verkündigung des Wortes in herausragender Weise auch auf die Fachkompetenz Lucas Cranachs des Älteren; ebenso hörte Luther auf den musikalischen Rat Johann Walters, als er die Deutsche Messe ausarbeitete.11 Wer hingegen (in späterer Zeit) die Bild- und Klangkünste abstreifte und die Parole »allein durch das Wort« nur mit der verbalen Kompetenz der Theologie verknüpfte, verengte die reformatorische Grundidee in nicht sonderlich sachdienlicher Weise. Sinnvoller wirkt die Botschaft des Thomaskantors Calvisius, der 1597 in der Vorrede seiner vierstimmigen Kirchenliedbearbeitungen Harmonia Cantionum Ecclesiasticarum schreibt:
Wo aber ein Gesang Gottes Wort und Geist hat, und kömpt nach S. Pauli meinung, Fürs ander [= außerdem], darzu die liebligkeit, so schafft es grossen nutz, weil eine liebliche schöne Melodey, oder auch Harmoney, wann die Lieder mit menschlicher stimm gesungen, oder auff Instrumenten gespielt werden, die gemüter der Menschen vielmehr und krefftiger bewegen und zur andacht erwecken: Als wenn die Wort nur blos geredet und gehört werden.12
Im Anschluss bezieht er sich auf einen Satz, den »der weise Heyde [= Heide] Plato […] recht geschrieben« habe und den er so ins Deutsche übersetzt: »Das nichts leichters eingehe, auch bey den Kindern, als was man jhnen mit Gesang beybringet.« Sartorius in Ratzeburg wandte dieses Konzept »gegen die hohen Feyertage« an. Die Gesänge, die im Syntax-Unterricht zergliedert und memoriert wurden, kamen daraufhin im Gottesdienst vor. Auf eine aktive Mitwirkung an ihnen waren die Schüler also bestmöglich vorbereitet.
Musikunterricht fand folglich auch zu Zeiten statt, zu denen er nicht auf dem Stundenplan stand. Hierfür jedoch war typischerweise (landauf, landab) die Stunde nach dem Mittagessen vorgesehen – physiologisch eigentlich keine gute Wahl. Doch dies war seit undenklichen Zeiten so üblich. Zu dieser Mittagszeit nun wird kaum nur der musikalische Spezialunterricht stattgefunden haben, der (je nach Potenzial des Ortes) auf das Musizieren beim nächstfolgenden gottesdienstlichen Anlass hinführte, sondern die generell geforderte, elementare Musikunterweisung. Hierfür gab es Handbücher (Kompendien); sie waren geprägt von einem Konzept, das Heinrich Faber 1548 in Braunschweig entwickelt hatte. Für mehr als ein Jahrhundert wurde es benutzt, kopiert, relativiert und fortentwickelt, behielt aber stets den ursprünglichen Kern.13
In diesem Unterricht ging es demnach nicht um komplexe Fragen wie Fugenlehre oder Textausdruck, sondern um Notenlesen und dessen sängerische Umsetzung. Schüler mussten Notenwerte unterscheiden und in Verbindung mit Taktvorzeichnungen anwenden können; außerdem war das Verständnis sämtlicher denkbarer Notenschlüssel essenziell, weil von ihnen aus die Tonhöhe der Noten errechnet werden sollte. Hierfür wiederum bedienten sich die Musiklehrer eines aus dem Mittelalter ererbten Systems: Die Töne wurden mit sechs Silben bezeichnet, als Ut, Re, Mi, Fa, Sol und La. Ut konnten dabei die Töne c, f und g sein; von ihnen aus gerechnet kommt dann zwischen Mi und Fa immer ein Halbtonschritt zustande (über c zwischen e und f über f zwischen a und b, über g zwischen h und c). Wer dies zu ermitteln gelernt hatte, konnte vom Blatt singen; man brauchte nur zu wissen, wo der Mi-Fa-Halbtonschritt liegt. Darauf bezog sich der Merkvers »Mi et Fa / est tota musica« – Mi und Fa machen die ganze Musik aus. Für Luther hatte dies den Rang eines theologischen Paradigmas: Der alles entscheidende Unterschied zwischen b und h entspreche dem Evangelium; diesem seien alle übrigen Tonstufen ebenso nachgeordnet wie im Außermusikalischen das weltliche Gesetzwerk.14
Der Zugang wurde anhand von allen erdenklichen Melodien geübt: Sie wurden von den Schüler zunächst mit den jeweils zugehörigen Tonsilben versehen. Um den Lerneffekt zu steigern, ließen sich Mustermelodien im Kanon singen: Dann musste sich jeder Schüler auf seinen eigenen Part konzentrieren, weil Kameraden neben ihm etwas anderes sangen; letztlich arbeiteten sich aber – im Kanon – alle an derselben Musik ab, sodass die Schwierigkeiten für alle gleich waren. Dieses elementare Kanonsingen erklärt, weshalb angehende Choristen gute Sopranstimmen haben mussten;15 dies hat nichts mit der Stimmlage zu tun, die die Jungen daraufhin im kirchlichen Ensemble übernahmen, sondern mit dem elementaren Lernen, das für alle von demselben Tonraum ausgehen sollte. Und erst in zweiter Linie wird deutlich, weshalb diese Einheitlichkeit erwünscht war; denn sie ermöglichte einen fließenden Übergang ins Musizieren.
Dieser Schritt vom Unterricht zum tatsächlichen Musizieren ist kaum je deutlich gemacht worden; zwischen den Kompendien und »der« Musik fehlt zumeist die Vermittlung – auch dann, wenn (wie im Compendium musicum des Augsburger Kantors Adam Gumpelzhaimer) dem Textteil ein Motettenanhang beigegeben ist.16 Denn Unterricht und Motetten müssen pädagogisch in Zusammenhang zueinander gestanden haben. Diese Vermittlung hat Matthias Ebio klargestellt, Kantor an der Lateinschule in Husum.17 Wenn seine Schüler die Grundlagen der Notation verstanden hatten und diese auf die abstrakten Kanons anwenden konnten, fuhr er mit Kanons fort, in denen Kirchenlieder aufbereitet waren, denn diese waren ohnehin der elementare Kirchenmusikzugang seiner Schüler. Zunächst sollten auch diese Kanons mit den Tonsilben textiert werden, und wenn das Lernresultat befriedigte, wurde der »echte« Liedtext eingesetzt. Dann lockerte Ebio die Kanontechniken: in Liedbearbeitungen für zwei Soprane und Generalbass. Und schließlich löste er sich von den Liedmelodien; seine Soprane konnten dann die latenten Kanontechniken auch in Psalmkompositionen singen und waren daraufhin für die Kirchenmusikmitwirkung konditioniert. Diese pädagogischen Schritte müssen weit verbreitet gewesen sein; denn viele Kantoren hinterließen Musik, in deren Oberstimmenparts noch die Kanontechniken hindurchschimmern (wie 1618 in den Opella Nova I des Thomaskantors Johann Hermann Schein).
Ebios Kompendien-Version, 1651 erschienen, ist eine der letzten, die neu publiziert wurden. Hundert Jahre waren seit dem Erscheinen von Fabers Ur-Werk (1548) vergangen. Für Lutheraner dieser Zeit hatte es kaum eine Alternative dazu gegeben, einen Einstieg in das Musizieren zu finden: Alle Komponisten, die in jener Zeit ausgebildet wurden, müssen von diesem Konzept geprägt worden sein und standen unter dessen allgegenwärtigem Einfluss. In manchen Regionen wirkte es auch noch länger. So erschien der Faber-»Abkömmling«, den Gumpelzhaimer 1591 erstmals in Druck gegeben hatte, 1681 letztmals neu.
Von diesem Musikzugang waren ebenso auch alle geprägt, die irgendwann einmal eine Kantorenstellung übernahmen und dann einen anderen Karriereweg einschlugen.18 Kantor zu sein war nur in seltenen Fällen eine Stellung »fürs Leben«: Sie bot Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Schulsystems (als Konrektor, Rektor), ebenso auch außerhalb (als Pfarrer). Deshalb war es nicht ungewöhnlich, wenn eine Schule alle paar Jahre einen neuen Kantor einstellte; ein Kantorat war ein ideales Trittbrett für die theologische Laufbahn. Und so brauchte sich mit einer Kantorenstellung keine wirkliche musikalische Professionalität zu verbinden. Im Prinzip hatte jeder Lateinschulabsolvent die notwendige Qualifikation erworben: Er musste gelernt haben, wie das Kompendiensystem funktionierte, und die Regeln auf das lokal übliche Musikrepertoire anwenden. Das war nicht viel; der Kirchendienst, der sich aus dem Schulamt herleitete, verband sich also nicht mit unüberwindlichen Schwierigkeiten.
Auf diese Weise entstand ein idealer Kreislauf lutherischer Musikpraxis. Jeder, der lateinische Syntax verstehen wollte, lernte dies bei dem Lehrer, der für die Musik in der Kirche zuständig war. Jeder verinnerlichte zugleich das Prinzip, wie aus den Noten des einschlägigen Repertoires Klang werden konnte, und memorierte zeitlebens bestimmte geistliche Kernbotschaften mithilfe der Melodien, die er zugleich mit der lateinischen Syntax im Gedächtnis abgespeichert hatte. Deshalb war es nicht schwer, vom Schüler zum Lehrer zu werden und genau dieses Funktionieren von Musik an eine nochmals jüngere Generation weiterzugeben – außer, jemand entwickelte eine ausgesprochene Aversion gegen das Erlebte.
Damit war zugleich dafür gesorgt, dass die Musik gesamtgesellschaftlich eine ähnlich luxuriöse Stellung innehatte, wie sich dies für ihre Rolle im Erlösungskonzept darstellen lässt. Jeder Handwerker (der bis zur Tertia auf die Lateinschule gegangen war) hatte eine unmittelbare Beziehung zu der mehrstimmigen Musik, die sonntags im Gottesdienst erklang, erst recht jeder Pfarrer oder auch Jurist, der nach dem kompletten Besuch der Lateinschule seine Ausbildung an der Universität fortgesetzt hatte. Die Bedeutung kunstvollerer Kirchenmusik musste folglich vor niemandem begründet werden, der an diesem Bildungssystem teilgenommen hatte.
Doch gab es auch Menschen, die keinen Anteil daran hatten. Das waren typischerweise nicht die Menschen »auf dem Land«. Viele Agrargemeinden leisteten sich aufwendige Kirchenmusik; Handel mit landwirtschaftlichen Produkten, von denen das Überleben der Städte letztlich abhing, sicherte den Agrargebieten einen sozialen und kulturellen Standard, der oft weit mehr als nur Elementares enthielt, also auch zumindest die Anfangsgründe des Lateinschul-Stoffes – dies alles ist im folgenden Teilkapitel näher zu betrachten. Unterprivilegiert war viel eher das städtische Dienstpersonal, das in sonntäglichen Frühgottesdiensten nur eine geistliche Grundversorgung erhielt; zu einer Vertiefung kam es in der Kirche erst später, während jenes Dienstpersonal das sonntägliche Mittagessen zubereitete.
Die Bedingungen dafür, Kantor zu sein, veränderten sich zwischen dem mittleren 17. und dem frühen 18. Jahrhundert zumindest für die Metropolen grundlegend. Bach (in Leipzig) oder Telemann (erst in Frankfurt, dann in Hamburg) hatten mit den geschilderten Verhältnissen kaum mehr etwas zu tun. Der Wandel wird 1642 erkennbar: Im Lehrbuch Musica practica des Nürnberger (später Frankfurter) Kantors Johann Andreas Herbst wird urplötzlich nicht mehr der traditionelle Kompendienstoff beschrieben, sondern der Umgang mit den komplexen Verzierungen der modernsten italienischen Opernmusik; mit ihnen arbeitete auch Tobias Michael, Leipziger Thomaskantor nach Scheins Tod 1631.19 Ohne diesen Perspektivwechsel hätten lutherische Lateinschulen der wenig späteren Zeit keine konkurrenzfähigen Gesangsstars hervorbringen können: wie Johann Philipp Förtsch, der in Frankfurt zur Schule gegangen war und ebenso wie Johann Carl Quellmalz (Absolvent der Lateinschule in Freiberg) nach 1678 an der Hamburger Oper Karriere machte. Folglich verschoben sich auch die stilistischen Ansprüche ans Musizieren. Doch noch lange wirkte das alte »Qualifikationskantorat« fort, das nur wenige zu einer lebenslangen Aktivität ausbauten.