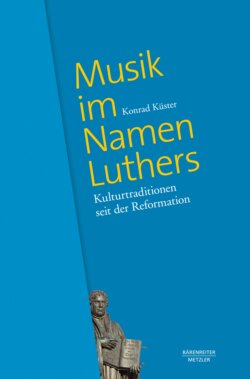Читать книгу Musik im Namen Luthers - Konrad Küster - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 »Ein neues Lied wir heben an«? Musik in der Liturgie Luthers Das gesamtkulturelle Klima
ОглавлениеAm 31. Oktober 1517, einen Tag vor Allerheiligen, brachte Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen an die Öffentlichkeit. Der Nachwelt gilt dies als Stichtag der Reformation. Sie stand in einem weit ausgreifenden Kontext, und aus europäischer Sicht wird die Zeit, die dem Thesenanschlag vorausging, vor allem als eines gesehen: als aufregend.
Das Weltbild befand sich in grundstürzenden Veränderungen. Nikolaus Kopernikus konnte begründen, weshalb nicht die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt des Kosmos stehe. Amerika wurde »entdeckt«, und die Folgen der Entdeckung lagen auf zwei Gebieten. Nun dämmerte auch den letzten Zweiflern, dass die Erde kugelförmig ist, dass sich über ihr also nicht der Himmel wölbe und unter ihr kein Platz für die Hölle sei. Zugleich verschoben sich die Handelswege: Genua und Venedig, ebenso Lübeck als Hansezentrum an der Ostsee verloren ihre einstige Drehscheibenfunktion; ein neuer maritimer Wettstreit entstand zwischen Spanien und Portugal, und dieser wurde schon nach wenigen Jahrzehnten durch Niederländer und Engländer aufgemischt (auch Hamburg hatte an ihm Anteil). All diesen Entwicklungen wuchs Popularität zu: mithilfe des ab 1450 von Johannes Gutenberg entwickelten Buchdrucks. Zwar verhinderten Analphabetismus und die hohen Kosten des Verfahrens eine Breitenwirkung. Doch das Ausmaß, in dem das neue Medium genutzt wurde, macht deutlich, wie wichtig es für den Umgang mit allen Neuentwicklungen der Zeit war. Und auch in der Kirche zeichnete sich ein Wandel ab. Schon seit dem Konstanzer Konzil (1414–1418) gärten Konflikte. Von 1512 an tagte in Rom das Fünfte Laterankonzil, um über Reformen zu beraten; das erfolglose Ende, das es im März 1517 fand, wirkt wie ein Auftaktsignal der Reformation Luthers.
Der Reformbedarf als solcher erfasste auch die gottesdienstliche Praxis. Bis dahin hatte der Zelebrant der Messe, fern jeglicher kirchlicher Zuhörerschaft, direkt vor einem Altar gestanden, das Gesicht zu dessen Bildwerken gewandt. Ihn schien er anzusprechen, quasi als Stellvertreter des Adressaten: des Heiligen, dem der Altar geweiht war, oder nicht zuletzt des gekreuzigten Sohnes Gottes. Neue Bewegungen1 wie die »Devotio moderna« strebten nun an, Gottesdienst als Botschaft zu verstehen und das Heilige stärker zu vermitteln. Dies führte auch zur Entstehung von Lettnern (»Lektorien«), an denen zusätzliche Altäre Platz fanden. Zugleich wurde das Predigen der hochmittelalterlichen Bettelorden aufgewertet, das faktisch eine Wendung des Gottesdienstes um 180 Grad bedeutete; dieser Predigttätigkeit verdanken die Kanzeln ihre Legitimation. Von ihnen aus traten auch Laienprediger für eine neue Frömmigkeit ein; dasselbe Forum nutzten aber auch Ablassprediger. In dieser Wendung des Geschehens hin zur Zuhörerschaft spielte auch die Orgel eine Rolle, denn sie konnte auf einem Lettner einen unübersehbaren Platz erhalten.
Man könnte meinen, kein Lebensbereich habe von diesen Entwicklungen unberührt bleiben können. Doch gerade bei der Musik sind Folgen kaum zu erkennen: Für sie war die Zeit um 1500 relativ ruhig, ohne große Irritationen oder Brüche. Sicher: Das vorkopernikanische Weltbild war auch mit musikalischen Mitteln interpretiert worden. Denn für Umlaufbahnen und Positionen der Himmelskörper wurde angenommen, dass ihnen dieselben Proportionen zugrunde lägen, nach denen auch die Akustik funktioniert: Wer eine Saite in der Mitte teilt und den Rest zum Klingen bringt, erhält die nächsthöhere Oktave; das Teilungsverhältnis 2 : 3 führt zur Quinte, 3 : 4 zur Quarte. Dieselben Verhältnisse »galten« für den Aufbau des Himmels: für die Relation zwischen der Erde und den um sie kreisenden Planeten. Musste dieses System aber für ein heliozentrisches Weltbild infrage gestellt werden? Was sprach gegen eine Weiterarbeit mit den so fundamental wirkenden, musikalischen Zahlen? Klar ist jedoch: Von derlei Überlegungen wurde die klingende, irdische Musik nicht erfasst.
Auch der Buchdruck ließ sich erst mit Verzögerung für Musik nutzbar machen. Ihr Notationssystem ist zu komplex. Buchdruck ist einfacher: Text wird auf ein weißes Papier gebracht, ähnlich wie beim Schreiben. Musiknotation dagegen setzt sich aus zwei Vorgängen zusammen: Ehe Noten aufgeschrieben werden können, müssen Notenlinien gezogen werden. Also müssen auch für einen Druckvorgang diese beiden Arbeitsgänge zusammengeführt werden – aber wie? Eine erste Erfindung (durch Ottaviano Petrucci in Venedig) ermöglichte eine Herstellung in tatsächlich zwei Arbeitsgängen: Zuerst wurden die Notenlinien gedruckt, dann exakt auf ihnen (und in ihren Zwischenräumen) die Noten. Das erforderte Präzisionsarbeit. Eine sicherere Alternative war, jede Notenseite wie eine Grafik komplett als Holzschnitt oder Stich herzustellen; noch für die frühesten Gesangbücher bauten die Drucker die Noten auf diese Weise in ihre Setzer-Arbeit ein. Doch bei längeren Kompositionen war dieser Aufwand zu groß. So zerlegte man schließlich den Notentext in Einzel-Einheiten: Für jeden Notenwert in jeder denkbaren Tonhöhe stand dann eine einzelne Letter zur Verfügung; sie umfasste also Notenkopf, Notenhals und die erforderlichen Notenlinien. Auch das war nur ein Kompromiss; denn so aus Einzellettern zusammengestückelt, kommen nie ungebrochen waagrechte Notenlinien zustande, sondern diese ähneln eher den Schienenverläufen vorsintflutlicher Eisenbahnstrecken. Immerhin aber ließ sich mit diesem Verfahren Musik irgendwie im Druck vervielfältigen; ab etwa 1530 hatte es das westliche Europa im Griff – als Luxus. Denn noch im späten 18. Jahrhundert war es typisch, nach handschriftlich vervielfältigten Noten zu musizieren. So erfasst das Neue des Buchdrucks zwar auch die Musik, nicht aber mit denselben weitreichenden Konsequenzen wie bei der reinen Vervielfältigung von Worttext.
Vorreformatorischer Gottesdienst · Der Priester zelebriert ihn vor dem Altar – mit Messbuch und Abendmahlskelch. Der Gemeinde wendet er seinen Rücken zu.
Vignette im Zwickauer Gesangbuch von 1525.
Wie die gottesdienstlichen Wandlungen sich auf die Musik auswirkten, lässt sich aus der Warte der Zuhörer verstehen. Bei ihnen können Worte, die ein Zelebrant in der Messe sprach (dem Altar zu- und von einer Laienschar abgewandt), nur als undifferenziertes Geräusch angekommen sein, bestenfalls als Gemurmel; dass die Wortbotschaft den Weg in das ferne Kirchenschiff einer gotischen Hallenkirche schadlos überstand, ist auszuschließen. Im Prinzip war es also auch gleichgültig, ob ein Text auf Latein oder in der Volkssprache gesprochen wurde. Dasselbe gilt für liturgische Gesänge: Auch von ihren Texten kann kaum etwas die irdische Zuhörerschaft erreicht haben. Und Nachhall verzerrte das, was die Musiker sangen. Für geistliche Laien jener Zeit muss dieses Klangbild ein Kennzeichen von Gottesdienst gewesen sein: Es machte den Gesamteindruck von »Kirche« ebenso aus wie das visuell Erlebbare, also der Raum als solcher und dessen Bildersprache. Die Vermutung läge nahe, dass diesem distanzierten Klangbild und der Passivität des Publikums das »lutherische Kirchenlied« entgegengesetzt worden wäre; sinnvoller ist zunächst sich vorzustellen, wie radikal eine solche Veränderung gewesen wäre – und tatsächlich hat sie in dieser Form auch nicht stattgefunden. Das zu zeigen ist eines der Themen dieses Kapitels.
Das typische kirchliche Klangbild schloss die Orgeln ein; seit dem 14. Jahrhundert traf man ihre Klänge häufiger auch in den Kirchen reicher Kaufmannsgemeinden an, nicht mehr also nur in kirchlichen Zentren (in Klöstern, Bischofs- und Wallfahrtskirchen). Orgelmusik hat selbstverständlich keinen Text; doch es ist fraglich, ob dies für das Musik-Erleben überhaupt von Belang war. Denn wenn zu den Gläubigen auch ein Gesangstext nicht durchdrang, machte es nichts aus, wenn die Musik von vornherein keinen Text hatte; wichtiger war also, dass auch auf den Orgeln etwas gespielt wurde, das mit den liturgischen Melodien verbunden war. Orgelkunst entwickelte sich also im Rahmen des etablierten Erlebens kirchlicher Musik, für das die liturgischen Melodien das Zentrale waren, nicht aber die irdische Verständlichkeit der zugehörigen Texte.
Dennoch äußert sich in dem Vordringen der Orgeln in Gemeindekirchen ein Wandel. Das Instrument war im späten Mittelalter maßgeblich verändert worden: Der Gesamtklang ließ sich fortan in einzelne Register zergliedern. Diese Neuentwicklung fügt sich nahtlos an die technischen Umbrüche der Zeit an. Und das Orgelinteresse des Patriziats passt gleichfalls dazu: Das Ästhetische spielte eine neue Rolle, also das Klangerlebnis als sinnlicher Reiz. Doch größere Entwicklungen der Orgelkunst liegen wiederum erst in nachreformatorischer Zeit.
Diese Zeit, die für die Musik offensichtlich so ruhig war, wurde von der uneingeschränkten Macht der Kirche geprägt. Deren traditionelles Schriftmonopol brachte es mit sich, dass die Nachwelt vor allem über die Musik informiert ist, für die sich die Kirche interessierte. Sicher: Die schon früh einsetzende italienische Renaissance2 und das gleichzeitige französische Spätmittelalter hatten auch Musik mit nichtkirchlichen Texten hervorgebracht; auch sie stieß bei Klerikern auf Interesse, und diese weltliche Musik ließ sich mit denselben Techniken aufzeichnen, die für das Notieren kirchlicher Gesänge verfügbar waren. Was damit ausgespart worden ist, lassen nur Bildwerke erahnen: Sie zeigen eine verwirrende Vielfalt an Instrumenten. Wer sie betrachtet, muss sich wie taub fühlen, weil von der Musik, die sich mit ihnen verband, nichts auf die Nachwelt gekommen ist: Nicht das Mittelalter wurde von Vokalmusik dominiert, sondern die Musiküberlieferung der Kirche. Wenn damalige Instrumentalmusik überhaupt je aufgezeichnet wurde, dann eben nicht mit Notationssystemen, die sich die Kirche erschlossen hatte – um zuallererst den gregorianischen Choral überzeitlich zu sichern. Instrumentalmusik war der Kirche offensichtlich nur für die Vorstellung des Himmels wichtig.
Ruhig war die Zeit für die Musik aber auch auf ihrem ureigenen Feld, der Stilentwicklung; es ist nicht verkehrt, von einer Blütezeit zu sprechen. Das vokalmusikalische Geschehen wurde beherrscht von der Kunst »der alten Niederländer«: den Musikergenerationen des 15. Jahrhunderts, die vor allem aus einem breiten Grenzraum zwischen Nordfrankreich und den südlichen Niederlanden stammten. Den Kern des Gebietes bildete der Norden des bis 1477 bestehenden Herzogtums Burgund, des extrem wohlhabenden, kulturell reichen Korridorstaats zwischen dem Englischen Kanal und den Westalpen. Kurz vor 1500 profilierte sich Josquin des Prez als beherrschender Repräsentant dieser Kunst, und zwar dort, wo es unter den gegebenen Umständen zu erwarten ist: am Petersdom in Rom. Er war der Erste, dessen Berühmtheit maßgeblich durch die Drucktechniken gefördert wurde. Die 1502 erschienene Messensammlung Misse Josquin ist der erste Musikdruck, der einen Autorennamen im Titel trägt, und Werke Josquins wurden in gedruckten musiktheoretischen Lehrwerken als satztechnische Vorbilder präsentiert. Ohnehin beherrschte er die Musikkultur in der Westhälfte Europas; davon zeugen die Werkwiedergaben in zahllosen Chorbüchern, also den zeitgenössischen Aufführungsmaterialien.3
Neben Josquins Messen und zeitgenössischen Motetten gelangte vor allem ein anderes Repertoiresegment der Musikkultur in Druck: französische Chansons. Die Anforderungen an die Drucklegung dieser Musikstücke waren ähnlich überschaubar wie deren Länge; die Nachfrage rechtfertigte diese Luxus-Pionierprodukte und verhalf umgekehrt auch der Gattung zu einer besonderen Popularität. Diese Mechanismen prägten seit 1530 den Umgang mit dem kurz zuvor neu erstandenen italienischen Madrigal. Dessen frühe Komponisten, Philippe Verdelot und Jacob Arcadelt, stammten aus französischen Teilen jener nicht näher differenzierten »Niederlande« und entfalteten ihre Kunst vor allem in Florenz. Der fortentwickelte Notendruck konnte diese Musik nun verbreiten; und mit dieser Chanson-Madrigal-Gruppe kommt man unvermittelt auch der reformatorischen Kultur nahe.